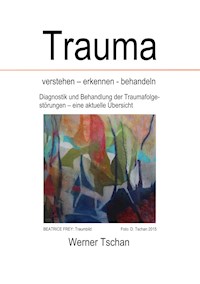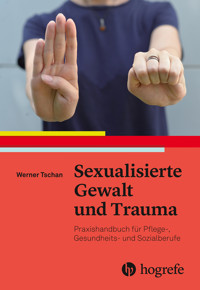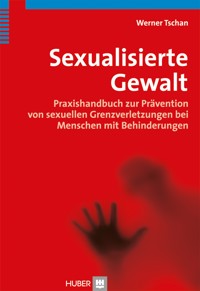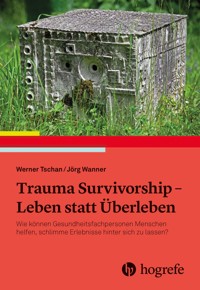
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch bietet Pflegefachpersonen und Gesundheitsberufen eine fundierte, praxisnahe Einführung in die Entwicklung, Anerkennung und Behandlung von Traumafolgestörungen – mit Fokus auf die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und die komplexe PTBS. Es verbindet aktuelles Fachwissen, gesellschaftliche Perspektiven und konkrete Handlungsempfehlungen – interdisziplinär und alltagsnah. Die erfahrenen Mediziner und Traumatherapeuten liefern: - einen kompakten Überblick über die historische Entwicklung traumabezogener Diagnosen – von der "Kriegsneurose" bis zur komplexen PTBS - verständliche Darstellungen der diagnostischen Merkmale und zentralen Symptome - praxiserprobte Behandlungskonzepte wie die IRRT-Methode - praxisnahe Hinweise zum Einbezug von Angehörigen in den Genesungsprozess - Impulse zur gesellschaftlichen Anerkennung von Traumafolgestörungen als Gesundheitsproblem - Aufklärung über sekundäre Traumatisierung von Helfenden – inklusive Schutzstrategien - klare Kompetenzprofile für Pflege- und Gesundheitsfachpersonen, von der Beziehungsgestaltung über Methodenwissen bis hin zur Selbstreflexion - eindrucksvolle Fallgeschichten, persönliche Erlebnisse und Überlebens-Geschichten von Betroffenen - eine Einführung in das Survivorship-Konzept und dessen Übertragung auf Menschen mit Traumafolgestörungen – mit Impulsen zur Langzeitbegleitung und Resilienzförderung Trauma Survivorship bietet ein Fachbuch, das berührt, bildet und befähigt. Ein Buch für alle, die traumatisierte Menschen professionell begleiten – im Pflegealltag, in der Therapie und im interdisziplinären Austausch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Werner Tschan
Jörg Wanner
Trauma-Survivorship – Leben statt überleben
Wie können Gesundheitsfachpersonen Menschen helfen, schlimme Erlebnisse hinter sich zu lassen?
Interview mit
Naoko Miyaji
Trauma-Survivorship – Leben statt überleben
Werner Tschan, Jörg Wanner
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Pflege:
André Fringer, Winterthur; Manela Glarcher, Salzburg; Doris Schaeffer, Bielefeld; Christine Sowinski, Köln; Angelika Zegelin, Dortmund
Dr. med. Werner Tschan. Psychiater und Psychotherapeut, FMH. Basel.
E-Mail: [email protected]
Dr. med. Jörg Wanner. Psychiater, und Psychotherapeut, FMH, Aesch.
E-Mail: [email protected]
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt. Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
All rights, including for text and data mining (TDM), Artificial Intelligence (AI) training, and similar technologies, are reserved.
Alle Rechte, auch für Text- und Data-Mining (TDM), Training für künstliche Intelligenz (KI) und ähnliche Technologien, sind vorbehalten.
Verantwortliche Person in der EU: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Merkelstraße 3,
37085 Göttingen, [email protected]
Anregungen und Zuschriften bitte an den Hersteller:
Hogrefe AG
Lektorat Pflege
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel. +41 31 300 45 00
www.hogrefe.ch
Lektorat: Jürgen Georg, Amélie Oberson, Swantje Kubillus
Redaktionelle Bearbeitung: Martina Kasper
Herstellung: Daniel Berger
Umschlagabbildung: Peter Moilliet „Traumhaus“ (Foto: Werner Beetschen)
Umschlag: Verlag intern
Satz: punktgenau GmbH, Bühl
Format: EPUB
1. Auflage 2026
© 2026 Hogrefe Verlag, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-96425-6)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-76425-2)
ISBN 978-3-456-86425-9
https://doi.org/10.1024/86425-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet umrandete Seitenzahlen (Beispiel: 1) und in einer Seitenliste, die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Need to know
Inhalt
Glossar
Inhaltsverzeichnis
Dank
Einführung
Need to know
Teil I: Historischer Rückblick und Entwicklung des Störungskonzepts
1 Historische Anerkennung und Entwicklung des Störungskonzepts
1.1 Trauma – Psychotrauma
1.2 Geschichtlicher Hintergrund
Teil II: Diagnostik und rechtliche Aspekte
2 Störungsbilder: Diagnostische Kriterien und rechtswissenschaftliche Aspekte
2.1 Fallvignette: „… ein Unglück ruft das nächste …“
2.2 Diagnostische Kriterien
2.2.1 Die einzelnen Störungsbilder
2.2.2 Dissoziative Störungen
2.3 Was ist eine Krankheit, was ist ein Unfall?
2.4 PTSD im DSM-5-TR
2.5 Diagnostik und therapeutische Möglichkeiten mittels AI/KI
2.6 Anwendung des Störungskonzeptes in den Rechtswissenschaften
Teil III: Traumatische Erlebnisse
3 Beispiele traumatischer Erlebnisse
3.1 Behördentraumatisierung
3.2 Bewusste medizinische Fehlbehandlung
3.3 Vernachlässigung in der Kindheit
3.4 Psychische Gewalt
3.5 Körperliche Gewalt/häusliche Gewalt
3.6 Sexualisierte Gewalt
3.7 Rassistische Verbrechen
3.8 Flugzeugabsturz, Schiffsuntergang
3.9 Geiselnahme, Amoktaten, Entführung und Folterung
3.10 Mobbing und Stalking
3.11 Bedrohung, Mafia und staatliche Repression
3.12 Adoption
3.13 Kindswegnahme
3.14 Natur- und Umweltkatastrophen
3.15 Krieg, Flucht und Immigration
3.16 Unfälle und Verbrechen
3.17 Lebensbedrohliche Krankheiten
Teil IV: Therapieansätze und Schutz
4 Behandlungsansätze und Schutzkonzepte
4.1 Fallvignette: „Ich habe gemeint, ich habe es verarbeitet“
4.2 Das Modell Vulcano Island
|
Interview mit Naoko Miyaji durch Werner Tschan
4.3 Behandlungsansätze
4.4 Fallvignette: „Der lange Weg zurück ins Leben“
4.5 Stabilisierungstechniken und Notfallkoffer
4.6 Schutzkonzepte: Gewaltprävention
4.7 Die Situation in Afrika
4.8 Wir brauchen Schutzengel
4.9 Fallvignette: Einsamkeit
Teil V: Traumafolgestörungen in der Gesellschaft, im Gesundheitswesen und Solastalgie
5 Gesellschaftliche Anerkennung
5.1 Anerkennung des Leidens
5.2 Rolle von Justiz und Polizei als gesellschaftliches Problem
5.3 Rolle der Politik
5.4 Die Belastung Angehöriger
5.5 Fallvignette: „… endlich ernst genommen werden“
5.6 Trauma und Public Health
5.7 An den Folgen zerbrechen – Suizid, erweiterter Suizid
5.8 Fallvignette: „Du siehst heute aber alt aus“
5.9 Der Mensch und sein Umgang mit der Natur
Teil VI: Sekundäre Traumatisierung von Helfenden und Kompetenzen der Gesundheitsfachpersonen
6 Sekundäre Traumatisierung von Helfenden
7 Kompetenzen von Fachpersonen aus Pflege-, Gesundheits- und Sozialberufen
Teil VII: Aus Krisen lernen
8 Die stürmische See – Was lernt man aus Krisen?
Anhang
Literatur
Glossar
Autorenverzeichnis
Sachwortverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung: Das Traumhaus von Moilliet (Foto: Werner Beetschen; mit freundlicher Genehmigung)
Abbildung 1-1: (rechts) Chronologie der Entwicklung der Diagnostik der Traumafolgestörungen: Klinische Begriffe (links), Anwendungen aus Kriegsmedizin (Eigendarstellung).
Abbildung 2-1: Zunehmender Schweregrad der Traumafolgestörungen (Eigendarstellung)
Abbildung 2-2: Aussagequalität von Opfern mit Traumafolgestörungen (Angela Ohno, Stadtpolizei Zürich; mit freundlicher Genehmigung)
Abbildung 4-1: Ringförmiges Atoll (Naoko Miyaji; mit freundlicher Genehmigung)
Abbildung 4-2: Metaphorisches Modell “Welcome to Toroidal Island”, 2021 (Foto: W. Tschan; mit freundlicher Genehmigung von Naoko Miyaji)
Abbildung 4-3: Model im Sandkasten im Kannenfeldpark, Basel 2024 (Naoko Miyaji; mit freundlicher Genehmigung)
Abbildung 4-4: Das Vulkan-Atoll: Die Opfer befinden sich im Inneren, die Helfer zeigt das Modell am äußeren Rand (Naoko Miyaji; mit freundlicher Genehmigung)
Abbildung 4-5: Shugo Tenshi – der japanische Schutzengel (Foto: W. Tschan)
Abbildung 4-6: Im Museum der Kulturen in Basel kann man ein Amulett in Form einer Mondsichel gegen den Bösen Blick betrachten – Neapel, ca. 1900, aus Silber gefertigt (Foto: W. Tschan)
Abbildung 4-7: Webkunst: Schutzsymbol gegen Krankheiten und Unglücksfälle (Foto: W. Tschan)
Abbildung 4-8: Das Liebesschloss – eine moderne Version des Schutzsymbols (Foto: W. Tschan)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
117
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
195
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
225
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
239
241
242
243
244
245
246
247
249
251
260
261
262
263
9Dank
Wir danken allen, die uns mitgeholfen haben, dieses Buch zu verfassen. Dieser Dank gilt zunächst einmal allen Betroffenen, die uns ihre Geschichten überlassen haben und damit geholfen haben, das Buch anschaulich und praxisnah zu gestalten. Zum Schutz aller Beteiligten wurden die Fallbeispiele so verändert, dass ein Rückschluss auf bestimmte Personen ausgeschlossen ist. Weiter möchten wir unserer Beta-Leserin Marianne Lüthi herzlich danken. Sie hat uns geholfen, Orthografie und Schreibstil signifikant zu verbessern. Dann möchten wir uns bei allen bedanken, die eine erste Version dieses Buches gelesen haben und mit ihren Rückmeldungen wesentliches zum besseren Verständnis und der Lesbarkeit beigetragen haben: Agnes Stupler, Therese Klaus, Jörg Fritschi, Felix Krucker, Daniela Heimberg, Myriam & Markus Geiter, Silvia und Rolf Köster, Danica Graf, Markus Tanner, Christoph Rehmann-Sutter, Fritz Ramseier, und Melanie Kast. Herzlichen Dank für die Unterstützung und die lobenden Worte!
Ganz besonders danken möchten wir Naoko Miyaji für das Interview, das wir mit ihr führen durften. Danken möchten wir auch Benard Okot Kasozi für seine Bereitschaft, uns einen Beitrag über die Situation in Afrika beizusteuern. Mitten in der Vorbereitung wurde er von einer schlimmen Erkrankung getroffen. Wir wünschen ihm gute Genesung und alles Gute. Wir haben deshalb grundlegende Informationen zu der Situation in Afrika selbst verfasst, um auf das Erfordernis von Behandlungskonzepten hinzuweisen.
Wir erhofften mit den beiden Beiträgen eine umfassende Sichtweise auf Traumasurvivorship beizutragen, um unsere Horizonte und Behandlungsansätze zu reflektieren sowie die Vorgehensweisen in Medizin, Psychologie und Public Health zu verbessern.
Jürgen Georg vom Hogrefe Verlag und der Redakteurin Martina Kasper danken wir für die jahrelange Zusammenarbeit und den stimulierenden Austausch. Der 10Verlagsleitung danken wir für die Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen.
Ein großer Dank geht an Eva Moilliet und Bruno Holinger sowie den Fotografen Werner Beetschen für die Einwilligung, das Bild des Traumhauses von Peter Moilliet für unser Buch verwenden zu dürfen ([email protected]).
Werner Tschan und Jörg Wanner
April 2025
11Einführung
Ein Traumhaus für die Seele
Abbildung: Das Traumhaus von Moilliet (Foto: Werner Beetschen; mit freundlicher Genehmigung)
Der Traum kommt aus unserem Innern und zeigt sich in Bildern – nur das Individuum kann diese Bilder sehen. Der Künstler Peter Moilliet (1921–2016) hat mit dem Traumhaus einen geschlossenen Raum geschaffen, wie eine Schatzkammer, die nur dem Träumenden offensteht und in die niemand eindringen kann. Betroffene von schweren traumatischen Erfahrungen schweigen oft und versuchen, ihre Erfahrungen vor anderen zu verstecken. Sie schämen sich, fühlen sich schuldig, 12können nicht über das Vorgefallene sprechen oder wollen es nicht, weil sie merken, dass sie damit auf Unverständnis oder Ablehnung stoßen, wenn sie die Wahrheit offenlegen. Also verschließen sie die Gedanken und Erinnerungen tief in ihrer Seele – nicht einmal mehr für sie selbst zugänglich. Dann, eines Tages, bricht alles hervor – wie wenn ein Staudamm bricht, drängen die Gefühle an die Oberfläche.
Peter Moilliet hat als Bildhauer zahlreiche eindrückliche Skulpturen geschaffen. Die Pietà am Grab der Einsamen auf dem Friedhof „Hörnli“ in Basel ist eines seiner ersten Werke. Das Leben von Peter Moilliet ist überschattet von vielen traumatischen Erfahrungen – nach der Geburt kam er ins Bernische Säuglings- und Mütterheim. Im Alter von vier Jahren kann die verwitwete Großtante Rosi den Jungen bei sich in Grabs aufnehmen. Ein Jahr später kam er zum ersten Mal zu seiner Mutter nach St. Moritz, die dort mit seinen beiden Halbbrüdern, zwei Söhnen aus erster Ehe der Mutter, lebte. Der Vater kam hin und wieder zu Besuch. Nach den ersten beiden Schulklassen wurde der Knabe bei seinem Onkel in Klosters platziert. Im Alter von 15 Jahren ging der Jüngling an die Evangelische Lehranstalt in Schiers – diese Ausbildung brach er ab und verbrachte erstmals seine Ferien beim Vater in Staufen (Breisgau). Von 1937 bis 1940 konnte Peter erfolgreich eine Lehre als Steinbildhauer in Basel abschließen. Dank Unterstützung durch Maja Oeri konnte Peter seine Bildhauer-Ausbildung bei Germaine Richier in Zürich absolvieren. Kurz nach seiner Verlobung mit Maria Marcella Vanz nahm sich die Mutter 1944 das Leben. Peter Moilliet gewann 1946 den Wettbewerb des Basler Kunstkredits und konnte von 1947 bis 1949 die Pietà auf dem Hörnli ausführen.
Die Traumhäuser heben sich vom sonstigen Schaffen von Peter Moilliet deutlich ab. Die Gestaltung geht auf tatsächliche Träume von einem Dorf in Afrika zurück, die der Künstler hatte. Auf der Außenseite brachte der Künstler seine Werkzeuge an: Hammer, Meissel und Zangen. Das Haus steht für den Ort, wo die Seele wohnt – noch verstärkt durch seine Werkzeuge. Peter Moilliet hat wohl zeitlebens nach Sicherheit und Geborgenheit gesucht – im Alter von vier Jahren hatte er erstmals eine Familie für sich, als er zur Mutter kam. Das Traumhaus hat weder Fenster noch Türen, höchstens kleine Öffnungen. Ein Bunker, aber auch ein Panzer – und gleichzeitig ein sicherer Ort. Als Metapher auch für den Ort, wo die Erinnerungen eingeschlossen und aufbewahrt sind. Es ist auch der Ort, wo die Seele oder das Innere Kind, wie wir es in der Traumaaufarbeitung nach IRRT kennen, zu Hause ist. Dank seiner Gestaltungs- und Schaffenskraft gelang es dem Künstler aus dieser Spannung heraus, die aus seiner Biografie resultiert, seine innere Welt in Bildern und Skulpturen darzustellen. Wer weiß, vielleicht hat ihm die Bildhauerei das gebracht, was anderen eine traumasensitive Aufarbeitung brin13gen kann. Eva Moilliet, die Tochter des Bildhauers, hat uns wiederholt geschildert, welche Lebensfreude der Vater zeitlebends ausgestrahlt habe. Auch mit seinem Schicksal habe er nicht gehadert.
Den berühmten Ausspruch von Martin Luther King: „I have a dream“ mögen viele Traumabetroffene entsprechend ihrer Lebensgeschichte interpretieren: die Hoffnung auf eine bessere und gerechtere Welt. Auch diesen Traum tragen sie in sich und wagen es kaum, ihn laut auszusprechen – allzu sehr laufen sie Gefahr, belächelt und als naiv hingestellt zu werden. Also verschließen sie den Traum tief in sich.
Um was geht es? Ein kurzer Überblick
Das mindset für Überlebende von katastrophalen Lebensereignissen wird im Englischen mit survivor umrissen – in einer etwas anderen Bedeutung meint „to be a survivor“, dass jemand nicht unterzukriegen oder hart im Nehmen ist. Der Begriff „survivorship“ wurde zunächst in der Krebsbehandlung bekannt, wo sich spezifische Probleme in der Nach- und Langzeitbetreuung von Erkrankten zeigten. Mit der eigentlichen Krebsbehandlung ist es nicht getan – analog verhält es sich mit Trauma-Überlebenden, wo sich die Schwierigkeiten der Bewältigung oft erst im weiteren Verlauf zeigen, obwohl das traumatische Geschehen längst vorbei ist. Der englische Begriff mindset umschreibt die Einstellungen und Haltungen zu bestimmten Themen. Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Text ist also eine Haltung gemeint, die dem Individuum die Einordnung des Geschehenen und dessen Folgen für sein Leben erleichtert. Häufig ist die Situation für Angehörige beinahe unerträglich – immer wieder flash backs und sich die Traumaerinnerungen anhören sowie die körperlichen Beeinträchtigungen mit ansehen zu müssen, ohne recht zu verstehen, wieso dies alles geschieht. Traumafolgestörungen zeigen sich in Zusammenhang mit einem weiten Spektrum an möglichen Ursachen: Katastrophen aller Art, sexualisierten Gewalterlebnissen, Unfällen, schlimmen Krankheiten bis zu sozialer Ausgrenzung. Ob etwas als „traumatisch“ erlebt wird, hängt von der individuellen Verarbeitung ab und weniger vom eigentlichen Ereignis.
Es stimmt einen nachdenklich, dass Traumafolgestörungen erst seit rund 40 Jahren erfasst werden; über die Entwicklung des entsprechendes Störungskonzeptes wird in diesem Buch ausführlich berichtet. Neben ökonomischen und militärstrategischen Gründen für die lange währende Nicht-Anerkennung von Traumafolgestörungen mag auch eine generelle Kränkung der Gesellschaft als Folge des Krankheitsbildes eine Rolle spielen: Traumafolgestörungen können nicht mit den üblichen medizinischen und pflegerischen Maßnahmen kuriert werden. Ge14sellschaftliche Bedingungen spielen eine zentrale Rolle für die Ausbildung von Traumafolgestörungen. Es gibt keine Medikamente gegen Traumafolgen. Die Behandlung muss die gesellschaftlichen Dimensionen berücksichtigen und geht damit weit über die individuelle Situation hinaus. Auch für die Diagnostik stehen keine Laborbefunde zur Verfügung. Damit werden die derzeitigen wissenschaftlichen und diagnostischen Möglichkeiten infrage gestellt. Wir stellen fest, dass sowohl Fachleute wie auch eine weitere Öffentlichkeit Traumasurvivors vielfach mit Ignoranz und Unverständnis begegnen. Ähnlich wie bei der Covid-19 Pandemie und den damit verbunden Long-Covid oder ME/CFS Erkrankungen benötigen wir andere Strategien. Dass wir diesen Vergleich anführen, hat noch einen weiteren Grund: Es gibt erstaunliche Parallelen in der Symptomatik. Traumafolgestörungen können analog wie Infektionskrankheiten mit chronischer Erschöpfung, Schlafstörungen, Schmerzen und einer Reihe weiterer Symptome einhergehen.
Für die Ausbildung von Traumafolgestörungen ist nicht nur das ursprüngliche Ereignis entscheidend, sondern weit mehr die nachfolgende Verarbeitung. Es ist selten ein einzelnes Geschehen für die Ausbildung einer Traumafolgestörung maßgebend. Vielmehr ist das Zusammenwirken verschiedener Ereignisse vor dem Hintergrund der individuellen Dispositionen entscheidend – Fähigkeit der Bewältigung schwieriger Umstände (früherer Traumata, Resilienz, und genetische Disposition, etc.) und Eingebundensein und Ausmaß der sozialen Unterstützung sowie Anerkennung des Leidens. Wird das Krankheitsbild nicht richtig diagnostiziert, ist die Behandlung automatisch ungenügend oder sogar schädlich. Deswegen müssen alle Gesundheitsfachleute das Störungsbild kennen.
Traumafolgestörungen beruhen auf expliziten und impliziten Gedächtnis-Prozessen: Die expliziten sind der mentalen Verarbeitung direkt zugänglich und können erinnert und verbalisiert werden. Die impliziten Gedächtnisinhalte zeigen sich in Verhaltensweisen und vegetativen Reaktionen. Das Traumagedächtnis ist sowohl seelisch als auch körperlich abgespeichert. Für die Ausbildung der Symptome im Langzeitverlauf spielen epigenetische Regulationsvorgänge eine zentrale Rolle (McGowan et al., 2009). Wir gehen in unserem Werk ausführlich auf diese Hypothesen ein.
Die bisher umfangreichste Untersuchung zu den Auswirkungen von belastenden Kindheitserfahrungen (ACE, Adverse Childhood Study) ergab, dass 52 % der Teilnehmer über mindestens ein belastendes Kindheitstrauma berichteten. 12,5 % der Teilnehmer gaben an, vier und mehr belastende Ereignisse erlebt zu haben. Inzwischen wurden in zahlreichen Ländern analoge Untersuchungen durchgeführt, welche die Ergebnisse weitgehend bestätigen. Die Auswirkungen auf die Gesundheit zeigen sich Jahrzehnte später (Felitti et al., 1998). 90 % aller Patienten 15mit psychiatrischen Beeinträchtigungen haben mindestens ein signifikantes Trauma erlebt, mehrere sogar mehr als eines (Mueser et al. 1998). Drei Viertel aller Menschen, die an Suchtproblemen leiden, haben traumatische Ereignisse erlebt (IWOFR, 2025).
Das vorliegende Werk stellt Fakten und Hintergrundwissen zu Trauma und Traumafolgestörungen für Gesundheitsfachleute zusammen. Es kann auch für Betroffene und Angehörige hilfreich sein, welche dank unseren Ausführungen ihre Situation besser einordnen können. Im besonderen Fokus stehen Kinder und Jugendliche, die weitaus vulnerabler als Erwachsene sind. Die traumatischen Erfahrungen wirken sich unmittelbar auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aus und können zu lebenslang anhaltenden Beeinträchtigungen führen. Mit dem Titel „Leben statt Überleben“ wird ausgedrückt, wie entscheidend die subjektive Lebensqualität von Betroffenen nach katastrophalen Lebensereignissen ist – und wie sehr Betroffene der Unterstützung und Anerkennung ihres Leidens im Hier und Jetzt bedürfen, um wieder „leben“ zu können. In vielen Fällen überspielen Betroffene die Auswirkungen – sie möchten nicht als Feiglinge oder Schwächlinge dastehen. Diese Reaktion wird wesentlich durch die mangelnde gesellschaftliche Akzeptanz des Krankheitsbildes mitbestimmt.
Die englische Bildhauerin Emily Young hat eine Skulptur des Erzengels Michael geschaffen, die im Garten der Kirche von St Pancras in London steht. Der Erzengel Michael oder Mika’il verkörpert den himmlischen Schutz – wir alle brauchen solche Schutzengel – himmlische und irdische. Was gibt einem Halt und Sicherheit im Leben? Die Menschheit sah sich seit ihren Anfängen stets von Gefahren bedroht, gegen die man sich zu schützen versuchte. Heute sprechen wir von Schutzkonzepten und meinen damit nachhaltige Präventionsstrategien gegen Gewalt, Unfälle, Verbrechen, Krieg und Naturkatastrophen. Anhand diverser Beispiele werden Ursachen und Folgen von traumatischen Ereignissen auf die menschliche Entwicklung ausgeführt. Die Vernachlässigung in der Kindheit stellt dabei mit Abstand eine der schlimmsten Formen der Traumatisierung dar, häufig unsichtbar gegen außen – mit gravierenden Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung.
Ein kurzer Überblick über Trauma und Traumafolgestörungen soll dem Leser das heutige Verständnis vermitteln – was gleichzeitig die Basis für Bewältigungsstrategien und letztlich Heilung von Verletzungsfolgen bildet. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt die Kontroversen und Schwierigkeiten in der Anerkennung des individuellen und kollektiven Leidens auf – brisant nicht zuletzt wegen der ökonomischen Konsequenzen für die Gesundheitskosten, die Versicherungsindustrie und die sozialen Rentensysteme. Fallbeispiele schildern exemplarisch 16die Situation von Betroffenen und wie sie das Ganze bewältigen konnten. Während in den USA Ende der 1980er Jahre die Situation der Veteranen des Vietnamkrieges und die der Vergewaltigungsopfer die Auseinandersetzungen um Traumafolgestörungen prägten, waren es in Japan die Auswirkungen des verheerenden Great Hanshin Erdbebens und der Sarin Anschläge in der U-Bahn Tokios 1995 (Miyaji im Druck). In Europa fasste das klinische Konzept der Posttraumatischen Belastungsstörung nach der Einführung der ICD-10 nach 1991 langsam Fuß; im deutschen Sprachraum v. a. nach der Publikation des ersten Lehrbuches in deutscher Sprache durch Fischer und Riedesser (1998). Weltweit sind Millionen Menschen von Traumafolgestörungen betroffen – besonders tragisch, wenn Vorurteile bestehen, wie etwa die Ansicht zahlreicher Fachleute, dass Traumafolgestörungen eine Pseudo-Diagnose darstelle, die westlichen Vorstellungen entspreche und deswegen in Ländern des Globalen Südens keine Bedeutung habe (Njenga et al., 2006). Aber auch hierzulande gibt es Fachleute, welche die Bedeutung von Traumafolgestörungen infrage stellen. In einem Beitrag in der Sonntagspresse zur psychiatrischen Versorgung in der Schweiz bezeichnete der Präsident der bernischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie die PTSD zusammen mit ADHS und Autismus als Modediagnosen, welche dazu beitragen, dass schwere Erkrankungen, z. B. Schizophrenie, unterversorgt blieben (Althaus et al., 2025).
Das Störungsbild geht von einem kausalen Zusammenhang zwischen Trauma und resultierenden Beeinträchtigungen aus. Damit wurde das Konzept der Posttraumatischen Belastungsstörung rasch durch die Rechtswissenschaften aufgegriffen und sowohl in Strafverfahren als auch in Zivilverfahren angewandt. Ein wichtiger Punkt wurde bisher jedoch durch die Rechtswissenschaften kaum beachtet: je schwerwiegender die Traumatisierung, desto mehr wird die Aussagequalität und damit die Zeugentauglichkeit beeinträchtigt.
Nicht allen Menschen gelingt die Überwindung persönlicher Katastrophen – einige zerbrechen an den Folgen und beenden ihr Leben mit Suizid. Andere entwickeln abgrundtiefen Hass und reißen Mitmenschen in den Tod. Die Rolle der Gesellschaft und der politischen Systeme ist essenziell zum Verständnis der Traumafolgen und deren Bewältigung, ebenso die Rolle der Fachleute und professionellen Helfer. Das Buch ist damit auch geeignet, die Konzeption von Curricula zu begleiten und die Ausgestaltung des öffentlichen Gesundheitswesens (Public Health) und der humanitären Hilfen den Herausforderungen anzupassen, die aus der emotionalen Bewältigung traumatischer Lebenserfahrungen resultieren. Die involvierten Fachleute erhöhen mit diesem Wissen ihre Kompetenzen in signifikanter Weise. Mit der Berücksichtigung der psychischen Gesundheit im Verständ17nis von Public Health gerieten auch die traumatischen Erfahrungen seelischer Art in den Fokus der wissenschaftlichen Forschung.
Die Aufgaben und Vorgehensweisen der professionellen Helfer werden im Buch diskutiert. In den 1960er Jahren tauchte erstmals die Idee des Inneren Kindes auf, das sich für die Bewältigung traumatischer Erfahrungen als äußert hilfreich erweisen sollte. Gelingt es, die individuellen Selbstheilungskräfte zu mobilisieren, können schlimmste Ereignisse und Erfahrungen überwunden werden. Heilung heißt nicht vergessen und auch nicht ungeschehen machen – das kann ohnehin niemand. Heilung heißt hinter sich lassen. Der Therapieansatz der IRRT (Imagery Rescripting & Reprocessing Therapy) hat sich dabei neben anderen als wirkungsvolle Methode einer traumafokussierten Behandlung erwiesen. Wir zeigen anhand von Fallvignetten die Vorgehensweise und die Ergebnisse auf.
Den Abschluss bildet eine Metapher „Die stürmische See“, anhand derer die Bedeutung für die Bewältigung von Krisen und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Selbstorganisation dargestellt wird.
Wir hoffen auf eine kritische Auseinandersetzung mit der hier vorgelegten Thematik und dass daraus die richtigen Lehren für die Zukunft gezogen werden. Betroffene dürfen nicht allein gelassen werden – das mindeste, was wir als Fachleute angesichts von traumatischen Lebenserfahrungen heute für Betroffene und ihre Angehörigen tun können, ist die Anerkennung des Leidens im Hier und Jetzt.
Angehörige spielen beim Thema Traumasurvivorship eine zentrale Rolle. Ihre Situation wird in den medizinischen Lehrbüchern allzu oft nur am Rande erwähnt; es wird zwar immer wieder betont, wie wichtig sie für die Bewältigung sind, aber wirklich einbezogen werden sie kaum. Auch an Tagungen und Weiterbildung ist ihre Stimme selten zu hören.
Triggerwarnung
In diesem Buch erfahren Sie von Gewalthandlungen und Katastrophen, die als Trigger wirken können. Für Betroffene können die Schilderungen aufwühlend sein und retraumatisierend wirken. Lassen Sie sich Zeit beim Lesen dieses Buches – legen Sie es weg, wenn Sie merken, dass es Ihnen zu viel wird.
18Need to know
Traumafolgestörungen gehören zu den häufigsten Beeinträchtigungen der Gesundheit. Unser Buch ist nach dem Prinzip „Need to know“ (das Wesentliche in Kürze) verfasst, um es möglichst kurz zu halten. Das Wesentliche in aller Kürze, so könnte man dies auf Deutsch umschreiben – das Prinzip „Need to Know“ dient bei vielen Behörden, Industriebetrieben, Finanzdienstleistern und Organisationen als Anleitung an die Mitarbeitenden. Man könnte auch von „Wissensgrundlagen“ sprechen. Dabei wurden viele Details weggelassen, die zwar wichtig zum Verständnis sind, aber gleichzeitig die Seitenzahl massiv vergrößert hätten. Anhand ausführlicher Darstellung über therapeutische Prozesse erhalten die Leser*innen einen vertieften Einblick in die Aufarbeitung und Bewältigung.
Rund ein Drittel bis zur Hälfte aller Menschen leiden an den Folgen traumatischer Lebenserfahrungen. Zahlreiche Betroffene meiden es, über die durchgemachten Erfahrungen zu sprechen, ja teilweise hindern sie sogar Fachleute aktiv daran, mit ihnen diese Geschehnisse zu explorieren. Diese Tendenz kann zusätzlich durch passive Vermeidung wie Numbing (emotionale Taubheit) und Amnesien an das Vorgefallene verstärkt werden. Wir verwenden den englischen Begriff mindset, um die Einstellungen und Erklärungsansätze gegenüber der Symptomatik zu beschreiben. Besonders tragisch sind die Auswirkungen von traumatischen Erfahrungen in der Kindheit.
Der Begriff Adverse childhood experiences (ACE) beschreibt alle Formen von traumatischen Kindheitserfahrungen (sexualisierte Gewalt, Vernachlässigung und weitere traumatische Erfahrungen), welche Personen unter 18 Jahren erleben. ACE haben gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und können die Lebensdauer signifikant verkürzen. ACE tragen oft zu riskantem und selbstschädigendem Verhalten bei.
19Die traumatischen Erfahrungen lassen sich nicht einfach ungeschehen machen – sie hinterlassen Spuren und wirken sich negativ auf die individuelle Lebensgestaltung aus. Den Hintergrund bilden veränderte Hirnstrukturen im Sinne mentaler Furchtnetzwerke (fear network), d. h. neuronale Verschaltungen im Gehirn, die das Verhalten prägen. Betroffene bringen die Dinge nicht zusammen – im Fachausdruck als Dissoziation bezeichnet – und können sich häufig keinen Reim darauf machen, wieso sie immer wieder auf bestimmte Umstände reagieren. Die Dissoziation ist Folge einer Gedächtnisstörung unter Beteiligung des Hippocampus. Ohne Dissoziation gibt es keine Traumafolgestörung: „Dissociation is the essence of trauma“ (Dissoziation ist das Grundelement des Traumas) (van der Kolk, 2014, S. 66). Als Dissoziation versteht man die (phasenweise) Störung der integrativen Funktion des Bewusstseins mit Trennung von Wahrnehmungs- und Gedächtnisfunktion (Tschan, 2019). Dissoziation ist das Gegenteil von Assoziation (zusammenfügen, miteinander in Beziehung setzen). Die traumatischen Erfahrungen sind sowohl seelisch als auch körperlich verankert und manifestieren sich auch so (Damasio, 2021). Flashbacks, Intrusionen, Albträume und Triggerphänomene sind die untrüglichen Zeichen dieser Dissoziation (Van der Hart et al., 2006). Die traditionelle Unterscheidung zwischen seelischen und körperlichen Folgen zum Verständnis der Traumafolgestörungen ist damit irreführend – „Körper und Psyche sind als Einheit zu verstehen. Als Ausdruck eines und desselben lebendigen Organismus, welcher auf die durchgemachten Erfahrungen reagiert“ (Tschan, 2019, S. 21), und nicht als zwei voneinander unterscheidbaren Bereichen.
Nachfolgend nun die wichtigsten Leitsätze aus der Forschung zu Traumafolgestörungen. Von Maggie Schauer stammt der Satz: „Wir Menschen tragen die Fähigkeit in uns, das Trauma zu entmachten“ (Schauer, 2024, S. 39). Mit anderen Worten: Betroffene können etwas gegen die immer wieder auftauchenden Symptome und Beeinträchtigungen tun – das naheliegende wäre, darüber zu sprechen, was geschehen ist. Nun ist das leider nicht so einfach. Wieso sich also mit belastenden Ereignissen auseinandersetzen? „Trauerarbeit öffnet die Tür in die Gegenwart“ (Olbricht, 2004, S. 195). Es muss den Betroffenen erklärt werden, warum sie heute – manchmal Jahre nach den belastenden Ereignissen – an einer Traumafolgestörung leiden und dass es inzwischen gute Behandlungsmöglichkeiten dafür gibt.
Sprechen ist nicht einfach, zuhören ist ebenfalls nicht einfach (Emcke, 2015). Es erfordert von Fachleuten gewissen Kompetenzen: „Wirksame therapeutische Arbeit ist nur möglich, wenn der Klient sich in der Therapiesituation sicher fühlt“ (Porges, 2019, S. 190). Fachleute müssen über das erforderliche Wissen, spezifi20sche Fertigkeiten und entsprechende Haltungen verfügen. Sonst sind sie nicht in der Lage, sich in die Situation von Betroffenen zu versetzen oder einzufühlen und die Hintergründe wie auch ihr mindset zu verstehen. Ohne traumaspezifisches Wissen wird dies nicht gelingen. Zudem muss die Gesellschaft bereit sein, das Schreckliche, häufig auch das Unrecht, anzuerkennen.
„Die Essenz der Psychotherapie ist der Therapeut/die Therapeutin“ (Rufer, 2013, S. 49). Die Fachleute bestimmen, was als Beeinträchtigung gilt: „Die Aufgabe des Arztes besteht darin, die somatischen, psychischen und sozialen Faktoren in ihren Zusammenhängen zu erfassen, zu gewichten und daraus Handlungsanweisungen für das ärztliche Tun abzuleiten“ (Adler, 2022, S. 18). Diese Aussage gilt in Analogie für Traumatherapeut*innen. Fachleute benötigen Theorien und Konzepte, und die einzelnen Handlungselemente der beteiligten Fachleute müssen in der Behandlungskette ineinander verzahnt sein. „Diagnosen sind nicht ‚gegeben‘, existieren nicht einfach so, sondern sie entstammen Vorstellungen in uns, die auf einer Theorie der Medizin beruhen“ (Adler, 2022, S. 38). Aber Vorsicht: Hypothesen sind noch keine Tatsachen – sie sind Erklärungsansätze, die gegebenenfalls aufgrund neuer Feststellungen und Erkenntnissen revidiert werden müssen.
Viele Betroffene leiden unter funktionellen Beschwerden, die sich als körperliche Symptome manifestieren. In der Regel sind sie Ausdruck einer vegetativen Dysregulation des autonomen Nervensystems, welches für die Aufrechterhaltung der Homöostase (des inneren Gleichgewichts) verantwortlich ist. Bei schweren Traumafolgestörungen können Reizüberforderung, Filmrisse (Amnesien), Brainfog (Konzentrationsstörungen) und Migräne, allgemeine Malaise, Schmerzen und weitere stressbedingte Symptome auftreten, wie sie auch bei anderen chronischen Krankheiten bekannt sind. Für die Betroffenen sind diese Beeinträchtigungen meist unverständlich und rätselhaft, was in einem Teufelskreis Krankheitsbefürchtungen verstärkt und regelmäßig durch ärztliches und therapeutisches Unverständnis noch zusätzlich akzentuiert wird.
Zahlreiche Traumata werden durch Menschen verursacht – als „man-made trauma“ bezeichnet. Gerade bei solchen Traumata ist die Beziehungsfähigkeit erschüttert und Vertrauen muss zuerst aufgebaut werden. „Es ist ein permanenter Zustand, dass Menschen durch menschliches Handeln traumatisiert werden“ (Vyssoki & Schürmann-Emanuely, 2004, S. 59). Eine Pflegefachfrau hat darauf hingewiesen, dass man den Menschen mit Trauamfolgestörungen nicht ansieht, was sie durchgemacht haben und deshalb ihre Hilfsbedürftigkeit oft nicht ohne weiteres zu erkennen ist (Reichel, 2019). Der therapeutische und pflegerische Prozess ist als interaktives Geschehen zu verstehen: „… a patient’s way of const21ructing his relationship with his therapist is not determined solely by the patient’s history: it is determined no less by the way the therapist treats him“ (Die Art der Beziehungsgestaltung des Patienten zu seinem Therapeuten ist nicht bloß durch seinen individuellen Erfahrungshintergrund bestimmt, sondern ebenso durch die Art und Weise, wie der Therapeut dem Patienten begegnet.) (Bowlby, 1988, S. 141). Da viele Traumafolgestörungen man-made Ursachen haben, kommt der Beziehungsgestaltung im therapeutischen Prozess eine zentrale Bedeutung zu. „Ausgestattet mit entsprechendem Wissen können Pflegende Betroffenen genau die Formen traumasensibler Beratung, Stabilisierung und Nachsorge anbieten, die für erfolgreiche Traumatherapie grundsätzlich benötigt werden – sowohl im stationären als auch im ambulanten Sektor“ (Reichel, 2019, S. 9). Der beste Schutz gegen Bedrohungsgefühle sind menschliche Beziehungen: „Our attachment bonds are our greatest protection against threat“ (Unsere Bindungen bilden den größten Schutz gegen Bedrohungsgefühle) (van der Kolk, 2014, S. 210). Leider gilt auch das Umgekehrte, dass Vernachlässigung zu den schlimmsten traumatischen Erfahrungen führt.
Der Mensch verfügt über eine gewisse Resilienz (Fähigkeiten, Belastungen auszuhalten) in der Bewältigung traumatischer Lebenserfahrungen, sonst hätte die Menschheit als Spezies nicht überlebt. Die Forschungsergebnisse haben inzwischen klar gemacht, dass die meisten Menschen mit Traumafolgestörungen eine ganze Reihe von traumatischen Ereignissen durchgemacht haben, bevor sie die entsprechenden Symptome zeigten (Schauer, 2024). Nur wenige Betroffene haben das Vollbild der Posttraumatischen Belastungsstörung nach einem einmaligen Ereignis.
Traumafolgestörungen können bis zu einem gewissen Grad auch als Selbstschutzmechanismen verstanden werden: „Nicht zu fühlen, was ist, ist einer unserer wichtigsten Überlebensmechanismen bei Bedrohung. Funktionieren, verdrängen, verleugnen, sich zurückziehen, nichts mehr zeigen von der inneren Wirklichkeit – ohne diese Fähigkeit könnten Menschen in einer traumatischen Situation geistig und seelisch nicht überleben“ (Alberti, 2019, S. 9). Das gilt zumindest für den Zeitpunkt der traumatischen Erfahrungen – im Hier und Jetzt der Behandlungssituation sind die Betroffenen in der Regel nicht mehr den Belastungen hilflos ausgesetzt. Naoko Miyaji verdeutlicht in ihrem Beitrag, wie letztlich auch Fachleute denselben Prozessen von Nicht-Wahrhaben, von Tabuisierung, von Nicht-Glauben-Können, ausgesetzt sind, analog den Opfern. Das Modell von Miyaji, welches sie in unserem Buch ausführt (Kap. 4.2), verdeutlicht auch sehr anschaulich, wie Menschen nach schlimmen Erfahrungen zum Schweigen gebracht werden können.
23Teil I: Historischer Rückblick und Entwicklung des Störungskonzepts
251 Historische Anerkennung und Entwicklung des Störungskonzepts
Traumafolgestörungen wurden nach der Publikation der „Posttraumatischen Belastungsstörung“ innerhalb der Gesundheitswissenschaften seit den 1980er Jahren bekannt. Historisch fand der Traumabegriff jedoch schon länger Verwendung, insbesondere in der Chirurgie haben sich seit vielen Jahren Traumakliniken auf die Behandlung von Unfällen spezialisiert. Die Psychotraumatologie ist dagegen ein vergleichsweise junges Gebiet – die Gründe dafür werden in diesem Kapitel über den geschichtlichen Hintergrund ausgeführt. Ein Trauma verändert die eigene Wahrnehmung irreversibel – nach dem Trauma ist nichts mehr so, wie es vorher war. Folge davon ist eine tiefgreifende Beeinträchtigung des eigenen Befindens (Gefühl der eigenen Sicherheit, des Aufgehobenseins, des Wohlbefindens) – das innere Gleichgewicht gerät völlig durcheinander, die Homöostase kann nicht mehr aufrechterhalten werden. Schutzfunktionen wie Dissoziation, Amnesien und Numbing bewahren viele scheinbar vor den schlimmen Erinnerungen – v. a. in entspannten Momenten tauchen diese inneren Bilder unerbittlich wieder auf oder sie werden durch Triggerphänomene ausgelöst.
Aus Überlebensgründen versuchen Betroffene, diese innere Balance wieder ins Gleichgewicht zu bringen und den Energieaufwand, der aus den Auseinandersetzungen mit den Folgen resultiert, zu minimieren (Damasio, 2021). Analog, wie die Medizin Fieber als Folge einer Infektion versteht, werden heute Flashbacks als Folge des Traumas angesehen. Betroffene müssen lernen, ihre Symptome anzunehmen und nicht gegen sie anzukämpfen. Die Beeinträchtigungen sind ein Gradmesser des eigenen Befindens und weisen den Weg der Heilung.
Um einer ausufernden Verwendung des Begriffs „Traumafolgestörung“ vorzubeugen, haben verschiedene Autoren vorgeschlagen, belastende Lebenserfahrungen von traumatischen Erfahrungen abzugrenzen (Gysi, 2025, S. 30). Dies ist jedoch illusorisch, weil die Traumafolgestörung nicht allein über das auslösende 26Ereignis definiert werden kann, sondern auch durch die Art und Weise der „Bewältigung“ (van der Watt et al., 2023). Zudem spielen die gesellschaftlichen Bedingungen für die Verarbeitung traumatischer Erfahrungen eine wesentliche Rolle. Im Vergleich: Auch wenn jemand auf einer Bananenschale ausrutscht und sich dabei das Genick bricht, würden wir Bananenschalen nicht als ‚gefährlich‘ bezeichnen. Ausgangspunkt der klinischen Diagnostik und Folgenabschätzung bei traumatischen Erfahrungen muss stets die resultierende Symptomatik sein, wie dies im nachfolgenden Kapitel ausgeführt wird.
1.1 Trauma – Psychotrauma
Trauma kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Wunde“ resp. Verletzung. In der somatischen Medizin haben sich für die körperlichen Verletzungen, wie eingangs festgehalten, Begriffe wie „Unfallchirurgie“, „Unfallmedizin“ oder allgemein „Traumatologie“ eingebürgert. Die „Wiederherstellungschirurgie“ hat sich heute in eine Vielzahl von Spezialdisziplinen aufgesplittert, um der Vielfalt an Verletzungsfolgen zu begegnen – dazu gehören neben anderem die Behandlung von Verbrennungen, Verletzungen des Bewegungsapparates und der inneren Organe, Strahlenschäden, Hautverletzungen sowie Verletzungen der Zähne. Die Auswirkungen auf das seelische Befinden werden als Psychotraumata bezeichnet, resp. als Traumafolgestörungen in der psychiatrischen Literatur aufgeführt. Während die körperlichen Folgen durch die Medizin seit langem fachgerecht behandelt werden, kann man dies für die psychischen Folgen leider nicht sagen. Viele Beeinträchtigungen in Zusammenhang mit Traumafolgestörungen sind körperlicher Natur, weshalb die Einteilung unter den psychiatrischen Leiden umstritten ist.
Eine weitere Kontroverse dreht sich um die Gültigkeit des aktuellen Traumakonzepts. Vor allem in nichtwestlichen Ländern ist die Meinung verbreitet, dass die entsprechenden Diagnosen wie die Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) (Kasten 1.1) in Ländern des Globalen Südens nicht zu gebrauchen seien: „Many experts consider PTSD in Africa as a pseudo-diagnosis by Western agencies who medicalize social consequences of war and who bring about Western models of management that are inappropriate“ (Njenga et al., 2006). (Übers. des Autors: Zahlreiche Experten betrachten PTSD in Afrika als eine Pseudo-Diagnose, welche die sozialen Auswirkungen von Kriegen ‚medizinalisiert‘. Damit werden westliche Konzepte propagiert, die für den Globalen Süden ungeeignet sind.) Die Fakten sprechen leider eine andere Sprache – Millionen von Menschen weltweit benötigen Hilfe wegen Traumafolgestörungen. Wir haben deshalb zwei Fachleute 27zu Beiträgen in diesem Buch eingeladen, die jeweils aus ihrer Sicht die Situation darlegen sollen: Japan für den asiatischen Raum (Kap. 4.2) und Uganda für Afrika (infolge akuter Erkrankung des Autors konnte er den vorgesehenen Beitrag nicht erstellen; eine kurze Zusammenfassung zu der Situation in Afrika steht in Kap. 4.7). Besonders interessant ist das Faktum, dass weltweit um die Anerkennung von seelischen Folgen traumatischer Erlebnisse gerungen wird – den Gründen dafür werden wir in unserem Buch nachgehen.
Kasten 1.1:Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD)
Das Störungskonzept wurde 1980 eingeführt und beruht auf einem streng psychopathologischen Verständnis:
Traumatisches Ereignis → clusterartige Folgen:
Intrusionen, Flashbacks
Vermeidungsverhalten
Hyperarousal
Numbing (emotionale Taubheit)
Die Symptome bestehen über mind. 4 Wochen.
Es resultiert eine deutliche funktionelle Einschränkung.
Auch bei uns bietet die Anerkennung der psychischen Folgen von traumatischen Ereignissen ein seltsames Bild: „… dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der Medizinerschaft das Psychische in ihrem Herantreten an den kranken Menschen ausklammert, und dass das psychische Trauma allzu oft auch von Psychiatern übersehen oder nicht spezifisch diagnostiziert wird“ (Friedmann, 2004, S. 5). Obwohl drei berühmte Forscher bereits im 19. Jahrhundert den Weg geebnet haben, der schliesslich 1980 zur Formulierung von zwei Diagnosen führte: Die Posttraumatische Belastungsstörung und die Multiple Persönlichkeit, später in Dissoziative Identitätsstörung umbenannt. Die drei Männer waren: Emil Kraepelin, der die biologischen Grundlagen von psychischen Beeinträchtigungen herausarbeitete, Emile Durkheim, der die soziologische Dimension beschrieb und Pierre Janet, der die Folgen traumatischer Erfahrungen in den psychischen Auswirkungen dokumentierte. Dieser lange Weg zur Anerkennung psychischer Traumafolgen ist wie gesagt erklärungsbedürftig.
Im Jahre 2022 wurde in der ICD-11 neu die Komplexe Posttraumatische Störung als Diagnose eingeführt, was das Spektrum diagnostischer Beurteilungen nochmals erheblich erweiterte. Ebenfalls neu wird die Borderline Störung nicht 28mehr als Persönlichkeitsstörung aufgeführt, sondern überwiegend als Folge traumatischer Erfahrungen betrachtet, wie dies von diversen Autoren schon vor einiger Zeit vorgeschlagen wurde (Van der Hart et al., 2006). Gleichzeitig wurde mit den neuen Diagnosemöglichkeiten eine einheitliche und kongruente Erfassung von Traumafolgestörungen erheblich erschwert – die Diskrepanz liegt in unterschiedlichen Ansätzen zwischen dem DSM-5 und der ICD-11. Im DSM-5 werden umfassende spezifische Kriterien für die Diagnostik aufgeführt (vier Symptomcluster mit 20 unterschiedlichen Symptomen), während die ICD-11 nur drei Symptomcluster für die Diagnose verlangt. Die in ICD-11 aufgenommene Diagnose der Komplexen Posttraumatischen Belastungsstörung verlangt neben der PTSD-Symptomatik weitere drei Symptomcluster: (1) Schwere und anhaltende Probleme der Affektregulation; (2) Überzeugungen über sich selbst als vermindert, besiegt oder wertlos, begleitet von Scham-, Schuld- oder Versagensgefühlen im Zusammenhang mit dem traumatischen Ereignis; und (3) Schwierigkeiten, Beziehungen aufrechtzuerhalten und sich anderen nahe zu fühlen. „So, in the coming years, patients, clinicians, and researchers are faced with two official PTSD concepts which do not convey much unity in the trauma field“ (Jongedijk et al., 2023). (Übers. des Autors: Damit sind in den kommenden Jahren sowohl Kliniker als auch Forscher mit zwei offiziellen PTSD-Konzepten konfrontiert, die nicht sonderlich zu einer einheitlichen Sicht über Traumafolgestörungen beitragen.) Diese Diskrepanz zeigt sich in der Konzeption des Störungsbildes – welche Ereignisse führen zu Traumafolgestörungen und welche Symptome sind charakteristisch? Diesbezüglich herrscht in der Forscherwelt alles andere als Einigkeit – obwohl das Störungsbild auf einer klaren pathophysiologischen Konzeption beruht, die bei den meisten anderen psychiatrischen Störungsbildern nicht so ausgeprägt gegeben ist. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass mit jeder Neuausgabe der beiden Diagnosemanuale die Traumafolgestörungen anders formuliert wurden. Wurde die Posttraumatische Belastungsstörung zu Beginn noch als Angststörung bezeichnet, wurde im DSM-IV eine neue Kategorie von „disorders related to stressful events“ (Beeinträchtigungen durch stressvolle Ereignisse) geschaffen. Weil die Traumafolgestörungen seit ihrer Kreation 1980 mehr Änderungen als jede andere psychische Störung erfahren haben (Hoge et al., 2016), sind viele Fachleute mit der Diagnostik der Traumafolgestörungen überfordert und suchen nach Orientierungshilfen – die unterschiedlichen Konzepte, wie sie heute bestehen, machen es jedenfalls nicht leichter. Zudem erfüllen um die 80 % aller Traumafolgestörungen zusätzlich die diagnostischen Kriterien anderer Störungsbilder – als Komorbiditäten bezeichnet (Tschan, 2019). Die Kontroversen zum Traumakonzept sind in Kasten 1.2 aufgeführt.
29Kasten 1.2:Kontroversen zum heutigen Traumakonzept
Andauernde Änderungen der diagnostischen Kriterien
Seit der Einführung 1980 wurden mit jeder Neuausgabe von DSM und ICD neue diagnostische Kriterien formuliert, zudem wurde das Störungsbild zunächst den Angststörungen zugerechnet. Die Dissoziation als pathophysiologische Ursache der Symptomatik ist vielen Fachleuten unvertraut.
Weltweite Gültigkeit wird in Frage gestellt
Von nicht westlichen Forschern wird die universelle Gültigkeit des Traumakonzepts infrage gestellt – dabei sind die Auswirkungen von traumatischen Ereignissen auf Menschen überall dieselben.
Diskrepanz zwischen DSM und ICD
Die Störungskonzepte und die charakteristischen Symptome werden unterschiedlich erfasst und klassifiziert. DSM-5 verlangt für die Diagnose vier Symptomcluster mit 20 unterschiedlichen Symptomen, die ICD-11 verlangt drei Symptomcluster. Die Diagnose der Komplexen Posttraumatischen Belastungsstörung ist nur in der ICD-11 aufgeführt.
Diskrepanz zu AI/KI
Die heutigen Systeme der künstlichen Intelligenz stellen die Symptomatik gegenüber ICD und DSM umfassender dar. Insbesondere werden die körperlichen Beeinträchtigungen im Gegensatz zu den geltenden Kriterien als Teil der Diagnostik verstanden.
Spektrum der Traumafolgestöungen
Die dissoziative Identitätsstörung (DID) wird in der offiziellen Diagnostik nicht zu den Traumafolgestörungen gezählt – obwohl die Forschung schon längst von einem Kontinuum von Traumafolgestörungen spricht und die DID als gravierendste Folge ansieht.
Komorbiditäten
In über 80 % erfüllen die diagnostischen Kriterien der Traumafolgestörungen diejenigen anderer Störungsbilder – damit ist die gewünschte Trennschärfe zwischen den einzelnen Diagnosen erschwert. Würde man jedoch in der klinischen Diagnostik beispielsweise bei Depressionen oder Suchterkrankungen den pathophysiologischen Zusammenhang mit den traumatischen Ereignissen berücksichtigen, wäre das Ergebnis eindeutig.
Klinische Marker für den Schweregrad fehlen
Der Schweregrad der Traumafolgestörung richtet sich nach den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten sowie der resultierenden Symptomatik, und nicht nach dem auslösenden Ereignis – dies erschwert die korrekte Erfas30sung des Störungsbildes. Die Unterscheidung von belastenden Lebensereignissen versus traumatische Erfahrungen ist deshalb obsolet.
Die Versorgung der Betroffenen resp. das Gesundheitswesen stößt an seine Grenzen, personell und ökonomisch.
Es besteht ein eklatanter Mangel an Fachkräften, die für Traumabehandlung zur Verfügung stehen. Die große Zahl von Betroffenen stellt eine enorme Herausforderung für Public Health dar. Die Nachsorge für Traumaüberlebende steht erst in ihren Anfängen.
Zusätzlich wird die Sache erschwert, wenn man die Dissoziative Identitätsstörung (DID) den Traumafolgestörungen zuordnet. Die DID ist das Resultat von erheblichen Traumatisierungen, insbesondere Vernachlässigung, in der frühen Kindheit mit gravierenden Auswirkungen auf die Entwicklung der Persönlichkeit (Tschan, 2019). Die Integration zu einem einheitlichen Selbst ist bei Betroffenen beeinträchtigt – einem schwer nachvollziehbaren Phänomen. Fragen tauchen auf: „Die Möglichkeit der Existenz solcher separaten Persönlichkeiten innerhalb eines Individuums nährt Zweifel daran, ob die allgemein akzeptierten Grundannahmen über die Einheit der Persönlichkeit und der Bewusstseinsstruktur noch haltbar sind“ (Putnam, 2021, S. 45). C. G. Jung (1971) sprach im Zusammenhang mit der Persönlichkeit von einem Ich-Komplex neben anderen autonomen Anteilen – damit stellte er die Einheit unserer psychischen Struktur in Frage.
Die Entwicklung des Störungskonzepts läuft parallel mit der Geschichte der modernen Psychiatrie (Ellenberger, 1980) und alle für diesen Prozess maßgebenden Exponenten des Faches waren gezwungen, sich mit den durch die DID aufgeworfenen Fragen auseinanderzusetzen (Putnam, 2021). Auch die Frage, was „Bewusstsein“ ist, wird nach wie vor sehr vorsichtig formuliert (Damasio, 2021).
Die Ausformung der Persönlichkeit ist das Resultat eines hochkomplexen Prozesses, maßgeblich beeinflusst durch interaktionelle Bindungserfahrungen (Siegel, 2012). Weiter spielen gesellschaftliche Gegebenheiten, evolutionsbiologische Faktoren (Cozolino, 2014) und konkrete Lebenserfahrungen, insbesondere traumatische Ereignisse, sowie genetische Faktoren eine wesentliche Rolle. Die Persönlichkeit ist alles andere als statisch, vielmehr unterliegt sie einer steten dynamischen Anpassung an die jeweilige Lebensrealität. Ungeklärt ist nach wie vor die Frage, was jeweils darüber bestimmt, welcher Persönlichkeitsanteil das aktuelle Wesen „steuert“. Fast beiläufig wird manchmal gesagt, sie oder er ist wie „ein anderer Mensch“; oder „so kenne ich sie/ihn gar nicht“, er oder sie ist wie ein umgekehrter Handschuh. Triggermechanismen können zu solchen Persönlichkeits-Än31derungen führen – die oft lange zurück liegenden Erfahrungen dringen plötzlich ins Bewusstsein ein und beeinflussen so das momentane Befinden und Verhalten.
Bekannt und explizit erforscht sind heutzutage die epigenetischen Steuerungsprozesse in Zusammenhang mit traumatischen Lebenserfahrungen (McGowan et al., 2009). Ein weiteres Verständnis liefert die Polyvagaltheorie, welche das Funktionieren des autonomen Nervensystems zur Aufrechterhaltung eines stabilen inneren Gleichgewichtes und damit der Homöostase zum Gegenstand hat (Porges, 2019). Ein weiterer Baustein stellt die Bindungstheorie dar, welche die Bedeutung der sozialen Interaktionen, insbesondere in nahe Bezugspersonen, untersucht (Brisch, 1999; Levy et al., 1998). Diese unterschiedlichen Faktoren beeinflussen die Ausformung der Persönlichkeit. Die Traumaforschung lieferte in den letzten Jahrzehnten wesentliche Beiträge zum Verständnis der Persönlichkeitsentwicklung (Herman, 2003; Siegel 2012).
1.2 Geschichtlicher Hintergrund
Im historischen Rückblick orientierte sich die Konzeption der Traumafolgestörungen hauptsächlich an vier Bereichen:
kriegerischen Auseinandersetzungen und Flucht
der industriellen Revolution mit Unglücksfällen mit einer großen Zahl von Verletzten (in erster Linie: Eisenbahnunglücke verbunden mit der parallelen Ausbildung von Haftpflichtregelungen, Versicherungsgesellschaften und staatlichen Versicherungssystemen)
Naturkatastrophen aller Art
sexualisierte und partnerschaftliche Gewalt.
Die Forschung zeigte rasch die unterschiedlichen Auswirkungen von man-made Trauma (durch Menschen verursachte Ereignisse) gegenüber Schicksalsschlägen wie Naturkatastrophen (z. B. Hochwasser, Lawinenniedergänge, Erdbeben oder Vulkanausbrüche, etc.). Je mehr allerdings menschliche Einflüsse bei der zweiten Kategorie eine Rolle spielen, desto mehr „man-made“ Auswirkungen wurden erkannt (fehlende Warnungen, kriminelle Baumethoden, ungenügende Gefahreneinschätzung, mangelhafte Rettungsmöglichkeiten, etc.).
Die Entwicklung eines pathophysiologischen Verständnisses über Traumafolgestörungen in der Medizin lässt sich über einen Zeitraum von gegen zwei bis drei Jahrhunderten verfolgen. Berichte aus dem Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648) lassen die Gräuel erahnen, unter denen die Überlebenden litten. Viele Menschen 32wurden damals nachhaltig traumatisiert, wie der Schweizer Historiker Arthur E. Imhof aufzeigte. Bei den Menschen jener Zeit galt der Leitsatz: „Verschone uns vor Pest, Hunger und Krieg. Oh Gott!“ (Imhof, 1983).
Der französische Arzt, Philippe Pinel (1745 – 1826), war wohl einer der ersten Mediziner, der die Auswirkungen der Horrorerlebnisse des Schlachtfeldes auf die mentale Gesundheit erkannte – er schuf 1798 den Begriff der „cardiorespiratorischen Neurose“, die man heute am ehesten mit „Herzneurose“ bezeichnen würde (Crocq et al., 2000). Betroffene leiden unter Herz- und Atembeschwerden, die sich nicht auf eine organische Ursache zurückführen lassen – sie haben Panikattacken und Todesangst. Die französischen Militärärzte sprachen damals von „vent du boulet syndrome“, erzeugt durch vorbeifliegende Kanonenkugeln. Pinels großer Verdienst war die Befreiung der psychisch Kranken von Ketten und Zwangsbehandlungen und er war einer der maßgeblichen Wegbereiter der Entwicklung der Psychiatrie zu einer modernen medizinischen Wissenschaft. Die Ärzteschaft der damaligen Zeit sah jedoch die Ursache von Nervenzusammenbrüchen von Soldaten in Zusammenhang mit körperlichen und konstitutionellen Faktoren, sowie Umgebungseinflüssen (z. B. Hitze und dgl. mehr) (Jones et al., 2001). Während des amerikanischen Bürgerkrieges (1861–1865) beschrieben Ärzte das Leiden der Soldaten mit „soldiers heart“, mit Herzrhythmusstörungen, Palpitationen (starkes Herzklopfen), Brustschmerzen, Atemnot und extremer Erschöpfung sowie Müdigkeit. Ausgeprägte Schlafstörungen gehörten ebenfalls zum Störungsbild (Jones et al., 2001). Da Costa sprach 1871 von einem „psychovegetativen Syndrom“. Eine deutliche Änderung in der medizinischen Auffassung stellte die Beschreibung der „Neurasthenie“ (Nervenschwäche) dar, 1869 durch den amerikanischen Arzt George Miller Beard (1839–1883). Im deutschen Raum wurde die Krankheit bald als „Amerikanische Krankheit“ bezeichnet. Hauptsymptom der Neurasthenie ist eine ausgeprägte Erschöpfung und generelle Ermüdung – ohne organisch fassbare Ursache. Vielfach wurden auch Kopfschmerzen, Freudlosigkeit und depressive Verstimmung sowie Störungen der Libido beschrieben. Beard stellte Überlegungen zur Krankheitsursache an, die als soziologisch bezeichnet werden können – damit war er seiner Zeit weit voraus. Gleichzeitig wurde durch die Ärzte ein Mangel an „Spurenelementen“ als Ursache angenommen, dem man mit entsprechenden Kurbehandlungen und Diäten zu begegnen versuchte.
Neben den Kriegsschauplätzen stellten Eisenbahnunglücke zu Beginn der Industriellen Revolution die großen „man-made“ Katastrophen dar – wo die Ärzte neben den körperlichen Schädigungen mit einer Vielzahl von traumatisierten Menschen konfrontiert waren, die unter psychischen Folgen nach dem Unglück litten. Der englische Chirurg John Eric Erichsen (1818–1896) sprach von „railway 33spine“ (Eisenbahn-Rückgrat) und vermutete die Ursache in Mikroläsionen im Nervensystem. Der deutsche Nervenarzt Hermann Oppenheim war schließlich der erste, der 1884 den Begriff der „traumatischen Neurose“ prägte (Tschan, 2019). Um dieselbe Zeit entdeckte Pierre Janet die Dissoziation als pathophysiologische Ursache der Traumafolgestörungen. Weiter entdeckte er die Bedeutung „vergessener Erinnerungen“ und ihre Bedeutung für das Traumagedächtnis. Und schließlich war Janet der Erste, der die Wirkung einer „kathartischen“ Behandlung von Traumafolgestörungen beschrieb.
Der deutsche Arzt Honigmann prägte 1907 nach dem Russisch-Japanischen Krieg (1904–1905) den Ausdruck „Kriegsneurose“ und stellte einen Zusammenhang zwischen den Symptomen der Soldaten und den zivilen Opfern her, wie sie Oppenheim beschrieben hatte (Crocq et al., 2000). In England führte Myers den Begriff „shell shock“ (Granatschock) in die Literatur der Militär-Psychiatrie ein (Myers, 1940). Man ging davon aus, dass die Druckwellen explodierender Granaten die Beschwerden ähnlich wie bei Gehirnerschütterungen verursachten. Einer der ersten Ärzte, der das Leiden der Soldaten als Krankheit ansah und entsprechend behandelte, war William H. R. Rivers. Er war englischer Militärarzt im Royal Medical Corps und arbeitete im Craiglockhart Hospital in Edinburgh. Entgegen der vorherrschenden Auffassung jener Zeit sah er die Beschwerden nicht als Ausdruck von Feigheit und dergleichen. Er forderte die Betroffenen auf, anstatt zu schweigen und die Symptome zu ertragen, über ihre Erlebnisse an der Front zu sprechen. Rivers verstand das Leiden der Soldaten als Ausdruck des Selbsterhaltungstriebes jedes Lebewesens – damit war Rivers seiner Zeit weit voraus. In ihrem Roman „Niemandsland“ (engl.: Regeneration) verarbeitete die englische Schriftstellerin Pat Barker aus der Perspektive der Psychiatrie die Geschehnisse um den ersten Weltkrieg (Barker, 1992