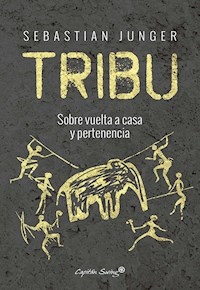19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Unser Trauma: eine Gesellschaft ohne Gemeinschaft
»Entbehrungen machen dem Menschen nichts aus, er ist sogar auf sie angewiesen; worunter er jedoch leidet, ist das Gefühl, nicht gebraucht zu werden. Die moderne Gesellschaft hat die Kunst perfektioniert, Menschen das Gefühl der Nutzlosigkeit zu geben. Es ist an der Zeit, dem ein Ende zu setzen.« Sebastian Junger
Warum beschließen Soldaten nach ihrer Rückkehr aus dem Krieg und in die Heimat, sich zu neuen Einsätzen zu melden? Warum sind Belastungsstörungen und Depressionen in unserer modernen Gesellschaft so virulent? Warum erinnern sich Menschen oft sehnsüchtiger an Katastrophenerfahrungen als an Hochzeiten oder Karibikurlaube? Mit Tribe hat Sebastian Junger eines der meistdiskutierten Werke des Jahres vorgelegt. Er erklärt, was wir von Stammeskulturen über Loyalität, Gemeinschaftsgefühl und die ewige Suche des Menschen nach Sinn lernen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Zum Buch
»Wir Menschen können mit Entbehrungen leben – sie spornen uns sogar an. Womit wir nicht leben können, ist das Gefühl, nicht gebraucht zu werden. Die moderne Gesellschaft hat die Kunst perfektioniert, Menschen das Gefühl der Nutzlosigkeit zu geben. Das muss sich ändern.« Sebastian Junger
Warum beschließen Soldaten nach ihrer Rückkehr aus dem Krieg und in die Heimat, sich zu neuen Einsätzen zu melden? Warum sind Belastungsstörungen und Depressionen in unserer modernen Gesellschaft so virulent? Warum erinnern sich Menschen oft sehnsüchtiger an Katastrophenerfahrungen als an Hochzeiten oder Karibikurlaube? Mit Tribe hat Sebastian Junger eines der meistdiskutierten Werke des Jahres vorgelegt. Er erklärt, was wir von Stammeskulturen über Loyalität, Gemeinschaftsgefühl und die ewige Suche des Menschen nach Sinn lernen können.
Zum Autor
Der Journalist Sebastian Junger, geboren 1962, ausgezeichnet mit dem National Magazine Award, veröffentlichte die Reportagensammlung Feuer und den Weltbestseller Der Sturm, der mit George Clooney und Mark Wahlberg verfilmt wurde. Sein Buch War – Ein Jahr im Krieg (Blessing, 2010) war ein New-York-Times- und SPIEGEL-Bestseller, sein Film Restrepo erhielt den Grand Jury Prize des renommierten Sundance Film Festival und eine Oscar-Nominierung als bester Dokumentarfilm. Junger lebt in New York.
SEBASTIAN
JUNGER
TRIBE
Das verlorene Wissen
um Gemeinschaft und
Menschlichkeit
Aus dem Englischen
von Teja Schwaner und Iris Hansen
BLESSING
Originaltitel: Tribe – On Homecoming and Belonging
Originalverlag: Twelve, Hachette Book Group, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Copyright © 2016 by Sebastian Junger
Copyright © 2017 by Blessing Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Geviert, Grafik & Typografie, München
Umschlagmotiv: Shutterstock/Stephane Bidouze
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-20361-0V001
www.blessing-verlag.de
Dieses Buch ist meinen Brüdern
John, Emery und Chief gewidmet.
INHALT
ANMERKUNGEN DES AUTORS
EINLEITUNG
DIE MÄNNER UND DIE HUNDE
DER KRIEG MACHT DEN MENSCHEN ZUM TIER
IN BITT’RER SICHERHEIT ERWACH ICH
ANRUF DAHEIM VOM MARS
NACHBEMERKUNG
DANKSAGUNG
QUELLEN
ANMERKUNGEN DES AUTORS
Dieses Buch geht auf einen Artikel zurück, den ich für die Juni-Ausgabe 2015 von Vanity Fair geschrieben habe: »How PTSD Became a Problem Far Beyond the Battlefield« (»Wie Posttraumatische Belastungsstörungen zu einem Problem wurden, das längst nicht nur bei Kampfeinsätzen auftritt«). Kurze Abschnitte des Artikels finden sich nahezu unverändert in diesem Buch wieder. (Anm. d. Übers.: Im Folgenden wird die englische Abkürzung PTSD für Posttraumatische Belastungsstörung beibehalten.)
Im Schlussteil »Quellenangaben« ist sämtliches Material aufgeführt, das mir als Grundlage gedient hat. Da Fußnoten den Lesefluss stören können und dieses Buch kein akademisches Werk ist, habe ich auf ihre Verwendung verzichtet. Nichtsdestoweniger war ich der Ansicht, dass gewisse wissenschaftliche Studien zur modernen Gesellschaft, zu Kampfeinsätzen sowie zur PTSD durchaus geeignet sind, bei manchen Lesern Erstaunen oder sogar Bestürzung hervorzurufen. Daher beschloss ich, die infrage kommenden Quellen im Text zumindest kurz zu erwähnen, sodass der Leser imstande ist, die Informationen ohne großen Aufwand persönlich zu verifizieren.
Im Buch ebenso wie im Artikel sind Ausdrücke enthalten, die mancher Leser als problematisch oder sogar anstößig empfinden mag. Da wäre als Erstes »American Indian«. Viele Leute bevorzugen den Ausdruck »Native American«, aber als ich versuchte, diese Bezeichnung in einem Interview mit einem Apachen namens Gregory Gomez zu verwenden, bedeutete er mir, dies sei die angemessene Bezeichnung für Menschen jeder beliebigen Ethnie, die in den USA geboren wurden. Er bestand darauf, »American Indian« zu verwenden, und daran habe ich mich gehalten.
Der andere problematische Ausdruck ist die oben genannte »post-traumatic stress disorder«. Einige Leute glauben verständlicherweise, das Wort »disorder« könne Menschen stigmatisieren, die nach wie vor unter einem Kriegstrauma leiden. Ich habe jedoch an dem Wort festgehalten, da jede langfristige traumatische Reaktion doch wohl als »disruption of normal physical oder mental functions« (dt. »Behinderung der normalen physischen oder mentalen Funktionen«) bezeichnet werden dürfte, wie das Wort »disorder« im Oxford American Dictionary definiert wird. Die meisten im Gesundheitswesen beschäftigten Personen – und viele Soldaten – stimmten dieser Ansicht zu.
Schließlich sind in meinem Buch mehrere in der Ich-Form geschriebene Berichte von Ereignissen enthalten, die sich vor vielen Jahren zugetragen haben, in einigen Fällen sogar, bevor ich Journalist wurde. Diese Szenen habe ich ohne Hilfe von Notizen so niedergeschrieben, wie sie mir in Erinnerung sind, und die Gespräche wurden ausschließlich von meinem Gedächtnis protokolliert. Üblicherweise sollte jede in Anführungszeichen gesetzte wörtliche Rede mit einem Tonbandgerät oder Notebook aufgezeichnet sein, und jedes Ereignis gehört direkt oder kurze Zeit später schriftlich festgehalten. Bei diesen wenigen Geschichten musste ich mich jedoch voll und ganz auf meine Erinnerungen verlassen. Nachdem ich eingehend über diesen Aspekt nachgedacht hatte, kam ich zu dem Schluss, dass eine solche Vorgehensweise meinen journalistischen Ansprüchen genügen würde, solange ich den Lesern nicht vorenthielt, dass dokumentarische Nachweise fehlten. Die Erinnerungen an jene Begegnungen bewohnen schon lange mein Gedächtnis und haben mir oft als maßgebliche moralische Wegweiser für mein eigenes Verhalten gedient. Zu gerne wüsste ich, wer alle diese Menschen waren, damit ich ihnen irgendwie danken könnte.
EINLEITUNG
Nachdem ich im Herbst 1986 das College abgeschlossen hatte, machte ich mich auf den Weg, den Nordwesten der USA per Anhalter zu erkunden. Ich war kaum je westlich des Hudson River gewesen und malte mir aus, dass mich in Dakota und Wyoming und Montana nicht nur das wahre Amerika, sondern auch mein wahres Ich erwarteten. Aufgewachsen war ich in einem Vorort von Boston, wo die Häuser hinter dichten Hecken standen oder durch riesige Gärten geschützt wurden und die Nachbarn einander kaum kannten. Was auch unnötig war, denn in meiner Stadt ereignete sich nie irgendetwas, das Gemeinschaftseinsatz erfordert hätte. Wann immer etwas Schlimmes passierte, kümmerten sich Polizei, Feuerwehr oder zumindest ein Instandhaltungstrupp der Stadt darum. (Ich habe einen Sommer lang in einem solchen Trupp gearbeitet und erinnere mich, einmal so eifrig geschaufelt zu haben, dass ich vom Vorarbeiter mit den Worten »Einige von uns müssen diese Arbeit ihr ganzes Leben durchhalten« gebeten wurde, es ruhiger angehen zu lassen.)
Die Vorhersehbarkeit des Lebens in einem amerikanischen Vorort ließ mich, ziemlich verantwortungslos, auf einen Hurrikan oder Tornado oder sonst etwas hoffen, das uns zwingen würde, in gemeinsamem Interesse zu handeln, um zu überleben. Etwas, das uns das Gefühl verleihen würde, zu einem Stamm zu gehören. Ich wünschte mir nicht Zerstörung und Chaos, sondern das Gegenteil: Solidarität. Ich wollte die Chance haben, meinen Wert für die Gemeinschaft und meinesgleichen unter Beweis zu stellen, aber zu der Zeit und an dem Ort, wo ich lebte, geschah nie etwas wirklich Gefährliches. Das müsse wohl eine ganz neue Erfahrung für die Menschheit sein, vermutete ich. Wie kann man in einer Gesellschaft erwachsen werden, die dem Einzelnen keine Opfer abverlangt? Wie wird man in einer Welt, die keinen Mut erfordert, zum Mann?
Diese Art von Bewährungsprobe würde in meiner Heimatstadt nicht stattfinden, aber ich hielt es für einen angemessenen Ersatz, mich in eine Situation zu begeben, in der ich nur sehr wenig Kontrolle ausüben konnte: etwa beim Trampen quer durchs Land. Und so stand ich eines Morgens Ende Oktober 1986 außerhalb von Gillette, Wyoming, an der Straße. Meinen Rucksack hatte ich an die Leitplanke gelehnt, und in meiner Hosentasche steckte eine Fernstraßenkarte. Sattelschlepper rumpelten über Brückenstöße und rasten den hundert Meilen entfernten Rockies entgegen. Pick-ups fuhren vorbei, und die Männer hinterm Steuer glotzten mich an. Einige kurbelten die Fenster herunter und warfen mit Bierflaschen, die mich jedoch nicht trafen, sondern harmlos auf dem Asphalt zerschellten.
In meinem Rucksack befanden sich ein Zelt, ein Schlafsack, ein Kochtopf-Set aus Aluminium und ein Benzin-Campingkocher schwedischen Fabrikats, bei dem der Brennstoff mit einer Pumpe unter Druck gesetzt werden musste. Diese Dinge und Verpflegung für etwa eine Woche hatte ich an jenem Morgen bei mir, als ich außerhalb von Gillette stand und sah, dass mir auf der Highwayauffahrt, die aus der Stadt führte, ein Mann entgegenkam.
Aus der Entfernung konnte ich erkennen, dass er eine wattierte alte Hemdhose aus Leinen trug und eine schwarze Brotdose bei sich hatte. Ich nahm die Hände aus den Taschen und drehte den Kopf, um ihm ins Gesicht zu sehen. Er trat an mich heran und musterte mich. Sein Haar war struppig und verfilzt, seine Hemdhose an den Oberschenkeln glänzend von Schmutz und Schmiere. Er wirkte zwar nicht unfreundlich, aber ich war jung und allein, und ich beäugte ihn wie ein Falke. Er fragte, wohin ich wolle.
»Kalifornien«, sagte ich. Er nickte.
»Wie viel Proviant hast du bei dir?«, wollte er wissen.
Ich dachte nach. Ich hatte – zusammen mit der restlichen Ausstattung – jede Menge Proviant dabei. Er dagegen hatte offensichtlich nicht viel. Ich würde jedem zu essen geben, der mir sagte, er sei hungrig, nur ausgeraubt werden wollte ich nicht, und genau das schien mir zu drohen. »Ach, ich habe nur ein wenig Käse«, log ich. Ich stand da, auf alles gefasst, aber er schüttelte nur den Kopf.
»Mit ein bisschen Käse kommst du nicht bis nach Kalifornien«, sagte er. »Da brauchst du etwas mehr.«
Der Mann sagte, er wohne in einem liegen gebliebenen Fahrzeug in der Stadt und laufe jeden Morgen drei Meilen zu einem Kohlebergwerk außerhalb von Gillette, um zu fragen, ob er für jemanden einspringen könne. An manchen Tagen gab es Arbeit, an anderen nicht, und dieser Tag war einer, an dem man keine Verwendung für ihn hatte. »Darum brauche ich das hier nicht«, sagte er und öffnete seine schwarze Brotdose. »Ich habe dich von der Stadt aus gesehen und wollte nur sichergehen, dass du klarkommst.«
Die Brotdose enthielt ein Sandwich, einen Apfel und eine Tüte Kartoffelchips. Das Lunchpaket war vermutlich eine Spende der örtlichen Kirche. Mir blieb keine Wahl, ich musste es annehmen. Ich dankte ihm, verstaute den Proviant in meinem Rucksack und wünschte ihm alles Gute. Er drehte sich um und machte sich auf den Weg hinunter nach Gillette.
Während der gesamten Reise dachte ich über diesen Mann nach. Mein Leben lang dachte ich über diesen Mann nach. Er war großzügig gewesen, schön, aber großzügig sind viele Leute; was ihn von den anderen unterschied, war die Tatsache, dass er Verantwortung für mich übernommen hatte. Er hatte mich von der Stadt aus gesichtet und war eine halbe Meile an einem Highway entlanggelaufen, um sich zu vergewissern, dass es mir gut ging. Aus der Feder von Robert Frost stammen die berühmten Worte, dass dein Zuhause der Ort ist, wo die Leute dich aufnehmen müssen, wenn du auftauchst. Das Wort »Stamm« ist ungleich schwieriger zu definieren, aber ein möglicher Anfang wäre folgende Definition: Menschen, bei denen wir uns veranlasst sehen, die letzte Nahrung mit ihnen zu teilen. Aus Gründen, die ich nie erfahren werde, beschloss der Mann in Gillette, mich wie ein Mitglied seines Stammes zu behandeln.
Dieses Buch handelt davon, warum diese Geisteshaltung in der modernen Gesellschaft so selten zu finden und so kostbar ist. Und wie ihr Fehlen sich auf uns alle ausgewirkt hat. Es handelt davon, was wir von Stammesgesellschaften über Loyalität und Zugehörigkeit und die unaufhörliche Suche des Menschen nach einem Sinn lernen können. Es handelt davon, wieso sich – für viele Menschen – Krieg besser anfühlt als Frieden und warum sich Zeiten der Entbehrung als großer Segen entpuppen können und Katastrophen manchmal positiver in Erinnerung bleiben als Hochzeiten oder Strandurlaube. Entbehrungen machen dem Menschen nichts aus, er ist sogar auf sie angewiesen; worunter er jedoch leidet, ist das Gefühl, nicht gebraucht zu werden. Die moderne Gesellschaft hat die Kunst perfektioniert, den Menschen das Gefühl der Nutzlosigkeit zu geben.
Es ist an der Zeit, dem ein Ende zu setzen.
DIE MÄNNER UND DIE HUNDE
Das möglicherweise Erstaunlichste an Amerika ist die Tatsache, dass es unter den modernen Nationen, die sich zu Weltmächten entwickelten, das einzige Land ist, dem der Aufstieg gelang, obwohl es mit dreitausend Meilen unwirtlicher, von Steinzeitstämmen bewohnter Wildnis konfrontiert war. Vom King Philip’s War im siebzehnten Jahrhundert bis zu den letzten Viehdiebstählen durch die Apachen am Rio Grande im Jahr 1924 führte Amerika fortwährend Krieg gegen eine eingeborene Bevölkerung, die sich technologisch gesehen seit 15 000 Jahren kaum verändert hatte. Im Verlauf von drei Jahrhunderten entwickelte Amerika sich zu einer boomenden Industriegesellschaft, gespalten durch Klassenunterschiede und Rassenungerechtigkeit, aber zusammengeschweißt durch ein Gesetzeswerk, vor dem alle Menschen zumindest theoretisch als gleich angesehen werden. Die Indianer dagegen lebten gemeinschaftlich in mobilen oder halbstationären Lagern, die mehr oder weniger konsensorientiert und weitgehend egalitär geführt wurden. Niemand konnte individuelle Autorität einfach an sich reißen, sie musste verdient werden. Ausgeübt werden konnte sie einzig gegenüber den Menschen, die bereit waren, sie anzunehmen. Wer das nicht wollte, dem stand es frei zu gehen.
Die Nähe dieser beiden Kulturen über viele Generationen bot der einen wie der anderen Seite die Wahl zwischen krass unterschiedlichen Lebensweisen. Zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts wurden in Chicago Fabriken errichtet, und in New York entstanden die ersten Slums, während die Indianer tausend Meilen entfernt noch mit Speeren und Tomahawks kämpften. Es sagt wohl etwas über die menschliche Natur aus, dass eine überraschend hohe Anzahl von Amerikanern, hauptsächlich Männern, sich irgendwann indianischen Gesellschaften anschloss, statt in ihrer eigenen zu bleiben. Sie eiferten den Indianern nach, heirateten, wurden von ihnen adoptiert und kämpften in einigen Fällen sogar an ihrer Seite. Das Gegenteil geschah so gut wie nie: Indianer liefen nicht über, um Mitglieder der weißen Gesellschaft zu werden. Emigration schien ausschließlich von der zivilisierten zur Stammesgesellschaft stattzufinden, und westliche Denker konnten sich eine so deutliche Ablehnung ihrer Gesellschaft beim allerbesten Willen nicht erklären.
»Wenn ein indianisches Kind, das bei uns aufgewachsen ist, unsere Sprache erlernt hat und an unsere Bräuche gewöhnt wurde«, so schrieb Benjamin Franklin 1753 an einen Freund, »sich aber irgendwann zu seinen Verwandten begibt und sie auf nur einem Streifzug begleitet, dann lässt es sich nie wieder zur Rückkehr bewegen.«
Andererseits, fuhr Franklin fort, war es fast unmöglich, weiße Gefangene nach ihrer Befreiung aus den Händen der Indianer zu Hause zu halten: »Obwohl von ihren Freunden freigekauft und mit aller denkbaren Behutsamkeit behandelt, um sie davon zu überzeugen, bei den Engländern zu bleiben, sind sie schon nach kurzer Zeit von unserer Lebensart angewidert … und nutzen die erstbeste Gelegenheit, um wieder in die Wälder zu entkommen.«
Die Tatsache, dass viele Weiße das Stammesleben bevorzugten, war ein Problem, das während der pennsylvanischen Grenzkriege der 1760er-Jahre auf besonders bittere Weise zum Tragen kam. Im Frühling 1763 berief Pontiac, ein indianischer Anführer aus Ottawa, einen Rat der Stämme ein, die an dem kleinen Fluss Ecorces in der Nähe des ehemaligen französischen Handelspostens in Detroit im heutigen Bundesstaat Michigan lebten. Die stetige Ausbreitung weißer Siedlungen war bedrohlich, einte aber die indianischen Stämme, wie kein Ausmaß an Frieden und Wohlstand es jemals gekonnt hätte, und Pontiac glaubte, mit einer ausreichend breiten Allianz die Weißen dorthin zurückdrängen zu können, wo sie eine oder zwei Generationen zuvor gewesen waren. Unter den Indianern befanden sich Hunderte weißer Siedler, die nach ihrer Verschleppung aus Grenzsiedlungen von den Stämmen adoptiert worden waren. Einige gaben sich mit ihren neuen Familien zufrieden, andere nicht, aber in ihrer Gesamtheit sorgten sie bei den Kolonialbehörden für erhebliche politische Bedenken.
Das Treffen der Stämme wurde von Läufern koordiniert, die hundert Meilen am Tag zurücklegen konnten. Sie überbrachten Wampumgürtel aus Muscheln und Schnecken oder auch Tabak als Geschenke mit der Botschaft, dass dringend eine Versammlung abgehalten werden müsse. Die Verzierung der Gürtel war so gestaltet, dass selbst Angehörige entfernter Stämme die Botschaft herauslesen konnten: Die Zusammenkunft war für den fünfzehnten Tag des Iskigamizige-Giizis anberaumt, des Monats, in dem Ahornsirup gekocht wurde. Gruppen von Indianern kamen am Ecorces zusammen und schlugen an seinen Ufern ihr Lager auf, bis schließlich am Morgen des Tages, den die englischen Siedler als den 27. April bezeichneten, die Ältesten durch das Lager zogen, um den Rat der Krieger einzuberufen.
»Sie traten aus ihren Hütten: die großen, nackten Gestalten der wilden Ojibwas, auf dem Rücken trugen sie Köcher, in ihren Armbeugen ruhten leichte Kriegskeulen«, schrieb der Historiker Francis Parkman ein Jahrhundert später. »Ottawas, fest in ihre farbenprächtigen Decken gehüllt; Wyandot mit wallenden bemalten Hemden, ihre Köpfe mit Federn geschmückt, die Gamaschen mit Glocken verziert. Bald saßen alle in einem großen Kreis im Gras, Reihe an Reihe, eine ernste und stille Versammlung.«
Pontiac war für seine große Redekunst bekannt, und am Abend hatte er die versammelten Krieger davon überzeugt, dass die Zukunft ihres Volkes auf dem Spiel stand. Dreihundert Krieger marschierten gegen das englische Fort, während in den Wäldern zweitausend weitere Kämpfer auf das Signal zum Angriff warteten. Nachdem sie zunächst versuchten, das Fort mit List und Tücke einzunehmen, zogen sie sich zurück und griffen dann nackt und mit Geschrei an – um schneller nachladen zu können, hatten sie sich die Kugeln in den Mund gesteckt. Der Versuch scheiterte, aber bald danach brach im gesamten Grenzgebiet Krieg aus. Praktisch alle noch so abgelegenen Forts und jeder eingefriedete Posten vom oberen Allegheny River bis zum Blue Ridge wurden gleichzeitig angegriffen. Le Boeuf, Venango, Presque Isle, La Baye, St. Joseph, Miamis, Ouchtanon, Sandusky und Michilimackinac wurden überrannt, ihre Verteidiger massakriert. Skalpiertrupps schwärmten durch die Wälder aus und fielen über abgelegene Farmen und Siedlungen entlang des gesamten östlichen Vorgebirges her. Es wird geschätzt, dass dabei zweitausend Siedler ums Leben kamen. Überlebende flohen ostwärts, bis an die Grenze Pennsylvanias bei Lancaster und Carlisle.
Die englische Reaktion erfolgte langsam, aber unaufhaltsam. Die verbleibenden Soldaten der 42sten und 77sten Highlander-Infanterie, die jüngst vom Militäreinsatz in Kuba zurückgekehrt waren, wurden in die Kasernen in Carlisle einberufen und auf den 200-Meilen-Marsch nach Fort Pitt vorbereitet. Begleitet wurden sie von siebenhundert Mitgliedern der örtlichen Miliz und dreißig erfahrenen Spähern und Jägern aus dem Hinterland. Die Highlander wurden von ihrer eigentlichen Aufgabe, die Kolonne an den Flanken zu sichern, praktisch umgehend wieder abgezogen, weil sie sich immer wieder in den Wäldern verirrten. Ihr Kommandeur war ein junger Schweizer Oberst namens Henry Bouquet, der in Europa Kampferfahrung gesammelt hatte und sich nun den Engländern anschloss, um seine Karriere voranzutreiben. Seine Anweisungen waren simpel: quer durch Pennsylvania marschieren, den Weg für seine Wagen von Männern mit Äxten frei machen lassen und Fort Pitt und andere belagerte Garnisonen an der Grenze unterstützen. Gefangene sollten nicht gemacht werden. Frauen und Kinder der Eingeborenen hingegen waren zu ergreifen und in die Sklaverei zu verkaufen. Für jeden Skalp, männlich oder weiblich, den weiße Siedler von einem indianischen Kopf schnitten, winkte eine Belohnung.