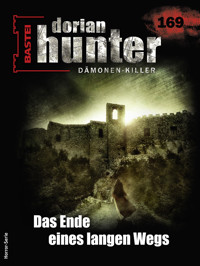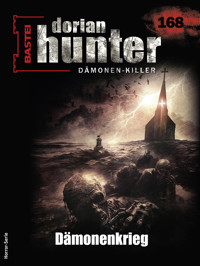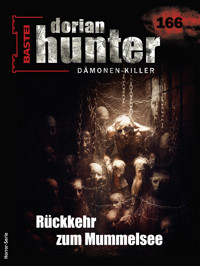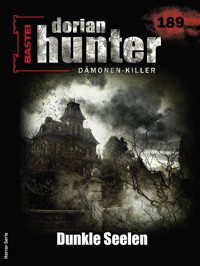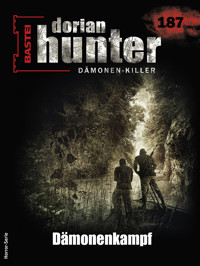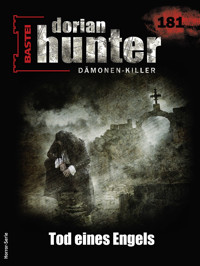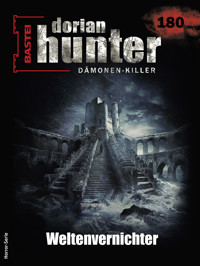Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Es beginnt in Schweden und breitet sich von dort über die ganze Welt aus. Das große Sterben. Menschen fallen ohne ersichtlichen Grund tot um. Die Experten sind ratlos und vermuten zunächst den Ausbruch einer viralen Pandemie. Doch sie sind nicht in der Lage, einen Erreger zu identifizieren. Da macht Major Albin Nielsen von der schwedischen Armee eine seltsame Entdeckung. Ein blinder Mann ist von dem seltsamen Sterben ebenso verschont geblieben, wie ein schreiendes Neugeborenes. Mysteriös wird es, als die deutsche Wissenschaftsjournalistin Ariane Hellenberg und ihre schwedische Freundin Ella Degerlund ebenfalls Opfer der neuen Krankheit werden - und überleben. Während Ariane das Erlebnis unbeschadet übersteht, mutiert Ella jedoch. Zum ersten Mal keimt der Verdacht, dass die Pandemie außerirdischer Herkunft ist. In Sundsvall errichten die Überlebenden eine Militärbasis und gründen die Joint Defense Initiative, um einer möglichen Alieninvasion zu begegnen. Aber zu diesem Zeitpunkt scheint jedes Handeln bereits zu spät, denn der unsichtbare Gegner hat die Erde sprichwörtlich ... ÜBERRANNT.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog Beginn
Teil 1 Vorhut
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Teil 2 Ausnahmezustand
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Teil 3 Erwachen
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Teil 4 Schimäre
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Teil 5 Überleben
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Epilog Hoffnung
Nachwort
Weitere Atlantis-Titel
Prolog Beginn
Der Tag, den Vincent Degerlund mit Faulenzen nutzte, markierte das Ende der Menschheit. Die meisten Menschen verbrachten zu viel Zeit in der Vergangenheit. Im Gestern. Ihnen fehlte der Mut und die Zuversicht, nach vorn zu blicken. Dabei vergaßen sie oft, sich im Jetzt aufzuhalten und das zu tun, wozu sie auf Erden waren: zu leben.
Einfach zu leben. Den Tag zu genießen. Jedem Tag die Chance zu geben, der schönste zu werden. Das war Vincent Degerlunds Maxime und Devise. Er hatte oft genug miterlebt, was geschah, wenn man der Vergangenheit nachhing. Das Leben stagnierte. Statt zu sich weiterzuentwickeln, stapfte man auf der Stelle. Daraus ergab sich oft eine Unzufriedenheit mit sich selbst und dem Rest der Welt. Und diejenigen, die mit sich selbst im Argen lagen, zogen meist ihre Mitmenschen noch mit hinein. Tagein, tagaus hatten sie nichts Besseres zu tun, sich über alles zu beschweren, und gewannen noch Sympathien und Zustimmung für ihre Meinung.
Vincent Degerlund lächelte, als er daran dachte, dass er dies alles hinter sich gelassen hatte. Er konzentrierte sich auf das, was er erlebte und erleben wollte. Er lenkte seine Gedanken und Wünsche in die richtigen Bahnen und bekam dafür vom Leben das geschenkt, was er wollte: Glück und Freude.
Ja, er war ein glücklicher Mann geworden, seit er aufgehört hatte, in der Vergangenheit zu leben. Er hatte eine wunderschöne Frau, zwei prächtige Söhne, erfreute sich bester Gesundheit und war als freischaffender Berater von börsenorientierten Unternehmen finanziell unabhängig. Letzterer Punkt ermöglichte es ihm und seiner Familie, des Öfteren eine Auszeit zu nehmen. Wenn Geld keine große Rolle spielte, war man frei genug, einfach mal seine Sachen zu packen und übers Wochenende wegzufahren.
So wie an diesem verlängerten Osterwochenende. Sie hatten Glück mit dem Wetter. Die Temperaturen lagen zwar um die zehn Grad, doch der Himmel war wolkenlos und sonnig.
Die Jungs tollten am Ufer im Gras und warfen Steine ins Wasser, während Mia den Picknickkorb auspackte und Vincent immer wieder einen ihrer strahlenden Blicke zuwarf. Sie war genauso glücklich wie er. Das sah er. Er spürte es.
Es war perfekt.
Vincent war heute Morgen in aller Früh mit seiner Familie von Luleå nach Boden aufgebrochen und hatte einen schönen Platz am Ufer des Buddbyträsket gefunden, noch bevor andere Osterurlauber auf die gleiche Idee kamen. Am späten Vormittag begann sich das Grasufer zu füllen. Keine zwanzig Meter von ihrem Picknickplatz entfernt hatte sich eine Gruppe junger Leute niedergelassen, die Drachen steigen ließen.
»Ist dir nicht kalt?«, fragte Mia und riss Vincent aus den Gedanken.
Er sah sie an und wollte den Kopf schütteln, doch dann überlegte er, ob ein Vorwurf in ihrer Stimme lag. Immerhin rekelte er sich auf der ausgebreiteten Decke und faulenzte, während seine Frau die Arbeit machte.
»Möchtest du eine Jacke?« Er sah, wie Mia den Kragen ihrer Strickjacke hochgezogen hatte. Im Wagen hatten sie noch Windjacken. Vielleicht war es besser, sie zu holen.
»Du bist ein Schatz.« Mia beugte sich vor und gab ihm einen Kuss auf den Mund.
Als Vincent aufstand und zum Wagen ging, wehten die Klänge von Lenny Kravitz’ Stand zu ihm herüber. Er warf einen Blick zurück und sah, wie einige der jungen Leute tanzten und ausgelassen feierten. Sollten sie ihren Spaß haben, solange niemand im betrunkenen Zustand begann Stunk zu machen.
Vincent fischte die Jacken aus dem Wagen und hörte über die Musik hinweg plötzlich einen Laut, der jeden Vater sofort alarmierte: das Schreien seines Knirpses Casper. Er sah, wie der Kleine und sein jüngerer Bruder Linus auf Mia zurannten, die die beiden in ihre Arme schloss.
»Was ist denn los?«, fragte Vincent.
Linus begann zu weinen, während Casper in Richtung der jungen Leute zeigte. Eine Handvoll von ihnen hatte sich um einen Mann geschart, der offenbar neben der Picknickdecke auf dem Boden lag. Anscheinend war etwas passiert.
»Wartet, ich schau mal nach«, sagte Vincent. Doch bevor er Mia die Jacken reichen und gehen konnte, fiel einer der anderen Männer ohne Vorwarnung hin. Direkt aus dem Stand. Er knickte in den Knien ein und stürzte, als hätte man einer Marionette die Fäden durchgeschnitten.
Ehe einer der anderen überhaupt begriff, was geschah, fiel der Nächste.
Dann noch einer.
Eine Frau folgte. Zwei, drei Menschen sahen sich an, ehe sie einfach umkippten und nicht wieder aufstanden.
Casper brüllte wie am Spieß.
»Was geht da vor sich, Vincent?«, rief Mia verzweifelt. Ein hysterischer Unterton schwang in ihrer Stimme mit.
Vincent stand wie angewurzelt da. Er fühlte sich mit einem Mal überhaupt nicht mehr verpflichtet, nach dem Rechten zu sehen. Ihn beschlich das Gefühl, dass das, was die Jugendlichen heimsuchte, ihn selbst befallen konnte, wenn er nur in deren Nähe geriet.
Jetzt erwischte es auch die Leute, die vorher am Seeufer getanzt hatten. Wie die Fliegen fielen sie, einer nach dem anderen. Zwei Frauen kreischten und rannten davon. Eine kam keine zwei Meter weit, als sie hinfiel und sich nicht mehr rührte. Die andere schaffte es bis zu einem der Vans, mit dem sie hergekommen waren, doch kaum dass sie die Tür berührte, brach auch sie zusammen.
»Rasch, weg hier!« Vincent spürte Panik in sich aufsteigen. »Lasst alles stehen und liegen!«
»Mama!« Linus. »Was war das?«
Der Junge entglitt Mias Hand und sackte zu Boden.
Nein, nicht Linus!
Mias und Vincents Blicke trafen sich. Entsetzen stand in ihren Augen, gepaart mit tiefgründiger Furcht und der Gewissheit, dass es kein Entkommen gab.
Dann änderte sich Mias Ausdruck. Eine Falte entstand zwischen ihren Brauen. »Was … was war das?«
Im nächsten Moment klappte sie zusammen.
Casper hörte auf zu brüllen. Er sah Vincent an. Dieser wollte irgendetwas tun, seinen Jungen packen und rennen, doch das, was um ihn herum geschah, lähmte ihn. Nicht nur sein Körper war wie festgefroren, auch seine Gedanken schienen in einem Eisblock festzustecken.
»Papa?«
Casper sank vor seinen Augen zu Boden. Er verdrehte die Augen. Die Lider schlossen sich, dann fiel er in sich zusammen. Neben seinem Bruder und seiner Mutter.
Vincent verfolgte den Sturz wie in Zeitlupe. Er war nicht fähig, zu denken, zu fühlen oder zu begreifen. Er merkte nicht, wie ihm der kalte Schweiß ausbrach, wie Übelkeit einen Würgereiz verursachte, ohne dass er in der Lage war, sich zu übergeben.
Fassungslos starrte er auf die leblosen Körper.
Dann jedoch erwachte für einen Sekundenbruchteil sein Verstand, als er etwas registrierte, das er nicht einordnen konnte: etwas Fremdes, nicht Greifbares.
Irritiert hob er die Brauen und sah sich um.
»Was war das?«, hörte er sich selbst sagen.
Nur einen Augenblick darauf wurde es dunkel um ihn.
Vincent war bereits in dem Moment tot, in dem seine Beine nachgaben.
Teil 1 Vorhut
Kapitel 1
Der Traum war intensiver als die Realität. Er kehrte in unregelmäßigen Abständen zurück und quälte die junge Frau im Bett aufs Neue. Ariane Hellenberg befand sich mit ihrer Freundin Sybille in New York und genoss den Hubschrauberrundflug über die Wolkenkratzer der Stadt. Das Wetter war ihnen wohlgesinnt. Sonnig, nicht zu warm, nicht zu kühl. Man konnte von hier oben bis zum Horizont sehen. Das One World Trade Center ragte imposant aus den Türmen der anderen Hochhäuser hervor. Doch an ein sprichwörtliches Kratzen an den Wolken war nicht zu denken, denn keine Cumulus-Gebilde trübten den Himmel. Hinter dem riesigen Gebäude war die Freiheitsstatue auf Liberty Island zu sehen.
»Wahnsinn!«, sagte Sybille Stobbe und lachte. »Wenn Rainer das wüsste, hätte er mich nie allein mit dir den Urlaub verbringen lassen.«
Ariane grinste. »Dein bescheuerter Freund hätte es uns nur vermasselt.«
Dafür fing sie sich einen Stoß in die Rippen ein und hätte aus einem Reflex heraus beinahe zurückgeboxt. Ariane machte keinen Hehl daraus, dass sie Sybilles Lebensabschnittsgefährten nicht mochte. Das hatte nichts mit Eifersucht zu tun, auch wenn sie und ihre Freundin mehr als einmal gemeinsam im Bett gelandet waren. Das war rein sexuell gewesen, hatte nichts mit Liebe zu tun und ihrer tiefen Freundschaft keinen Stein in Weg gelegt.
»Ich such mir ja einen neuen«, sagte Sybille nach einer Weile. »Aber erst … wenn mir Rainer zu langweilig wird. Er ist gut im Bett, weißt du?«
»Das sind andere auch. Und du kannst dich in Hannover aufs Messegelände stellen, mit den Armen wedeln und rufen: ›Ich bin Single.‹ Was glaubst du, wie viele Kerle sich plötzlich um dich scharen und um dich werben werden?«
»Als ob gutes Aussehen alles wäre. Übrigens trifft das auf dich noch mehr zu. Du bist doch viel hübscher als ich.«
»Quatsch! Erzähl nicht so einen Unfug.«
Sybille blickte aus dem Fenster. Sie überquerten gerade den Central Park.
»Rainer ist loyal. Und hilfsbereit.«
»Aber er ist dumm«, sagte Ariane. »Zumindest kann er dir nicht das Wasser reichen. Meine Mutter hat immer gesagt, du musst dir einen Mann angeln, der mindestens so intelligent ist wie du selbst.«
»Das sind doch alte Weisheiten, die heute nicht mehr gelten.« Sybille machte eine wegwerfende Handbewegung. »Alte Wertvorstellungen haben sich doch grundlegend geändert. Zu alt, zu jung, ob Mann mit Frau, Mann mit Mann, Frau mit Frau, eine Beziehung zu dritt oder ein offenes Verhältnis … das alles gab es zu Zeiten der weisen Worte deiner Mutter doch gar nicht.«
Natürlich hatte Sybille recht und Ariane wusste das. Das änderte jedoch nichts an der Tatsache, dass sie Rainer nicht mochte. Dabei konnte sie noch nicht einmal sagen, warum. Sie blickte auf ihrer Seite aus dem Fenster des Hubschraubers.
»Wo sind wir eigentlich?«
»Das sollte jetzt New Jersey sein«, sagte Sybille. »Wir fragen mal den Pil… Was ist das denn?«
Der Tonfall in Sybilles Stimme alarmierte Ariane und sie folgte dem Blick der Freundin aus dem anderen Fenster. Von einem Moment auf den anderen hatte sich der Himmel verdunkelt, als würde gleich ein Gewittersturm losbrechen. Doch was da aus den pechschwarzen Wolken kam, waren keine Blitze, sondern lodernde Feuerbälle, die auf die Erde niederregneten.
»Ein Meteoritenhagel?«
Sie hatte noch nie einen miterlebt und wusste nicht, was da aus der Wolkenformation herabfiel. Die Objekte sahen aus wie ein halbes Dutzend brennender Medizinbälle, die, einen Feuerschweif hinter sich herziehend, auf die Erde fielen. Ariane hörte den Piloten fluchen. Er verriss das Steuer des Hubschraubers. Das Fluggefährt kippte zur Seite, die Turbinen heulten empört auf und der Rotor kämpfte gegen die plötzliche Überlastung an. Ariane wollte den Piloten anschreien, ob er noch ganz bei Trost wäre, doch dann erkannte sie, dass seine hektische Aktion ihnen das Leben gerettet hatte. Nur wenige Meter von ihrem Fenster entfernt fiel einer der Feuerbälle vorbei. Die Flammenbrunst, die ihm folgte, schlug durch den Fallwind peitschend um sich und erwischte den Rumpf des Helikopters. Ein Ruck ging durch die Maschine. Glas barst. Ariane und Sybille schrien gleichzeitig auf und wichen entsetzt von dem zersprungenen Fenster zurück auf die andere Seite. Der Hubschrauber geriet ins Trudeln und drehte sich in einer Schleife unaufhaltsam dem Boden entgegen. Der Pilot funkte Mayday, zerrte und riss an den Steuerelementen, während seine Füße die Pedale traten, doch der Flug wollte sich nicht mehr stabilisieren.
Der Hubschrauber sackte durch und stürzte ins Bodenlose.
Kurz vor dem Aufprall schreckte Ariane aus dem Albtraum auf. Schweißgebadet. Stoßweise atmend. Der Puls hämmerte hinter ihren Schläfen. Sie war die ersten Sekunden orientierungslos und fühlte sich erst wieder in die Wirklichkeit zurückgeholt, als ihr Berner Sennenhund Rocky aufs Bett sprang und sich an sie kuschelte.
»Ein Traum …« Ihre Stimme war heiser. Der Mund fühlte sich so trocken an, dass sie nicht einmal genug Spucke sammeln konnte, um ihn zu befeuchten. Ariane schwang die Beine über die Bettkante und stand auf, nur um sich rasch an einer Kommode festzuhalten, ehe sie zu Boden stürzen konnte. Nicht nur, dass ihre Beine nachgaben und der Gleichgewichtssinn versagte, auch ein hämmernder Kopfschmerz schoss ihr durchs Gehirn und zwang sie in die Knie.
Rocky bellte, tanzte um sie herum, schleckte sie ab, winselte, als sie nicht reagierte.
Ariane brauchte ein paar Minuten, ehe sie auf die Beine kam und ins Bad gelangte. Sie drehte den Hahn am Waschbecken auf und spritzte sich eiskaltes Wasser ins Gesicht. Dann tauchte sie den ganzen Kopf unter den Hahn und nahm anschließend zwei, drei Schlucke vom Leitungswasser.
So schlimm war es nie gewesen. Ja, ihr Urlaub in New York vor drei Jahren war beinahe in eine Katastrophe ausgeartet, doch so wild, wie es der Traum ihr weismachen wollte, war es niemals zugegangen. Das Ereignis hatte so nicht stattgefunden, sondern ganz anders.
Sie waren auf einem Rundflug gewesen und ein einzelner Meteorit war aus dem Himmel auf die Erde gestürzt. Doch er hatte den Hubschrauber niemals in Gefahr gebracht. Der Pilot hatte den Rundflug abgebrochen und war notgelandet. Allerdings gab es einen Nachzügler des Meteoriten, der sie fast doch das Leben gekostet hätte. Er schlug unmittelbar neben der Landestelle des Helikopters ein und setzte Ariane und Sybille beim Aussteigen einer Strahlung aus. Den Rest ihres Urlaubs verbrachten sie in einem Strahlenzentrum in der Nähe von New York City. Die Ärzte waren besorgt über mögliche Mutationen und Bildung von Krebszellen, weshalb man ihnen eine Gentherapie anbot, die sie beide annahmen. Sie kehrten völlig genesen aus dem Urlaub zurück. Während Sybille keine Probleme mit dem Vorfall zu haben schien, wurde Ariane die nächsten drei Jahre von Albträumen verfolgt. Anfangs einmal wöchentlich, später reduzierten sie sich und traten nur noch alle paar Monate auf. Doch sie liefen immer ähnlich ab und machten aus dem Meteoritenfall ein Weltuntergangsszenario mit Feuerbällen und einem Absturz ihrer Maschine. Kopfschmerzen und Desorientierung waren nach dem Aufwachen die Folge, aber das verging nach ein paar Minuten wieder. Dieses Mal brauchte Ariane wesentlich länger und rief in der Redaktion an, dass sie sich heute um eine Stunde verspäten würde.
Die Kopfschmerzen waren wie weggeblasen, als Ariane Hellenberg die Wohnungstür hinter sich schloss und Rocky ihr förmlich in die Arme sprang. Der hüfthohe Berner Sennenhund stellte sich auf die Hinterläufe, streckte seine Pfoten aus und begann mit einer Schlabberorgie, die Ariane halb angewidert, halb erfreut über sich ergehen ließ.
»Ist ja schon gut, mein Dicker, ist ja schon gut.« Sie drückte den Hund von sich, kraulte ihm das Halsfell und gab ihm dann zu verstehen, dass sie in die Küche wollte.
Ariane wischte sich mit dem Handrücken über das feuchte Gesicht. Sie hatte sich heute schon früher aus der Redaktion verabschiedet, weil die Kopfschmerzen vom Morgen nicht nachlassen wollten. Doch kaum dass sie in Reichweite ihrer Wohnung war, ging es ihr wesentlich besser. Sie stellte ihre Laptoptasche auf dem Küchentisch ab, streifte die Stöckelschuhe von den Füßen und schlenderte barfuß zum Schrank. Rockys Napf war leer. Sie füllte ihn zur Hälfte mit Trockenfutter, erneuerte das Wasser in der zweiten Schale und schaltete anschließend ihre Nespresso-Maschine ein. Sie blätterte in dem Rondell mit Kaffeekapseln und entschied sich für einen Espresso Arpeggio.
Rocky machte sich über sein Futter her.
»Na, du hast noch was vom Leben. Jemanden, der für dich sorgt und dich den ganzen Tag über in Ruhe lässt.«
Sie ließ den Espresso durchlaufen, gab einen Schuss frische Milch hinzu und setzte sich auf einen Barhocker an den Esstresen, der sich neben dem Küchentisch befand. Zuerst überlegte sie, ob sie noch an dem Artikel weiterschreiben sollte, den sie in der Redaktion abgebrochen hatte, doch sie verspürte nicht die geringste Lust. Vielleicht später.
Stattdessen fischte sie das iPad aus ihrer Laptoptasche und schaltete es ein, um nach neuen E-Mails zu sehen, während sie ihren Espresso genoss.
Sie scrollte durch die Nachrichten. Zehn Mal Spam. Davon sieben gewollter. Newsletter diverser Onlineshops, Parfümerien und Nachrichtenmagazinen. Sie löschte sie alle und stolperte über eine Mail von Sybille.
Hi du,
wie ist es? Bleibt es bei morgen Abend im Moonshine Still? Ich hab zwei Karten. Crazy Comets spielen und ab halb acht ist Happy Hour. Ich zähl auf dich.
LG
Bille
PS: Was macht die Liebe?
Ariane nippte an dem Espresso und lächelte. Das Moonshine Still war ihre und Sybilles Stammkneipe in Hannover. Gute Musik, gute Drinks, gute Unterhaltung. Und an den Wochenenden gab es Live-Gigs von lokalen Bands. Klar, sie war dabei. Jedoch beschloss sie, die Frage im Nachtrag zu ignorieren. Sybille wusste, dass sich Ariane vor dem New-York-Urlaub von ihrem Ex nach sechs Jahren getrennt und von da an beschlossen hatte, das Single-Dasein zu genießen. Daran hielt sie fest. Und wenn sie einen schlechten Tag hatte und eine Schulter zum Anlehnen brauchte, war da immer noch Rocky. Sie hätte es vorher nie für möglich gehalten, aber ein Hund war tatsächlich der beste Freund des Menschen.
Zumindest mein bester Freund, dachte sie und nahm einen weiteren Schluck von dem Espresso. Sie strich sich eine braune Haarsträhne hinters Ohr und wischte über das Display zur nächsten Nachricht.
»Oh.« Das war seltsam. Ella Degerlund. Von ihr hatte sie schon seit Ewigkeiten nichts gehört. Eine Urlaubsbekanntschaft aus Schweden und Facebook-Freundin. Sie hatten sich im Jahr nach Arianes Trennung kennengelernt, als sie auf einem Skandinavientrip über ihren Liebeskummer hinwegkommen wollte. Nach dem Urlaub hatten sie öfter telefoniert, gemailt und gechattet, doch der Kontakt war irgendwann eingeschlafen und man grüßte nur noch sporadisch im Facebook-Profil zum Geburtstag oder zu Weihnachten.
Wie gewohnt war Ellas Nachricht in Englisch verfasst.
Hallo Ariane,
du wunderst dich sicher, dass ich mich nach langer Zeit mal wieder bei dir melde. Es tut mir leid, dass ich so selten etwas von mir hören lasse. Hoffe, es geht dir gut. Bei mir ist momentan leider alles beschissen. Mein Bruder Vincent, du kennst ihn noch von deinem Aufenthalt in Luleå, seine Frau Mia, die beiden Kinder Casper und Linus – sie sind tot, Ariane, tot. Alle!
Es geschah vor einer Woche am Osterwochenende. Vincent war mit seiner Familie in der Nähe von Boden auf einem Ausflug. Er ist von dort nicht mehr lebend zurückgekehrt. Die Verwaltung von Boden sprach von einem Unfall. Angeblich sind sie in ein Sturmtief geraten, das das Ufer des Buddbyträsket überschwemmt hat. Merkwürdig ist nur, dass es für das Osterwochenende keine Unwetterwarnungen gab. Außer Vincent und seiner Familie befanden sich noch andere Leute am Ufer, die ebenfalls gestorben sind. Die Leichen werden unter Verschluss gehalten, sie wurden für Angehörige nicht freigegeben und das Gebiet rund um den Buddbyträsket ist von Polizei und Militär hermetisch abgeriegelt worden. Die Presse wurde mundtot gemacht. Niemand berichtet mehr über den Vorfall, als hätte er sich nie zugetragen.
Ich weiß nicht mehr weiter, Ariane. Ich bin verzweifelt.
Du arbeitest doch als Journalistin. Kannst du vielleicht irgendetwas herausbekommen? Ich will doch nur meine Familie sehen und wissen, was geschehen ist.
Wenn du Zeit hast, können wir heute Abend vielleicht skypen?
Deine Ella
Ariane merkte, wie ihre Augen beim Lesen feucht wurden. Sie griff nach einem Kleenex am Rande des Tresens und schnäuzte hinein. Das iPad wurde ihr plötzlich zu schwer. Sie legte es aus der Hand und schluckte. Rocky spürte ihre Traurigkeit und kam zu ihr herüber. Er legte sich vor ihre Füße auf den Boden und winselte leise vor sich hin.
Ariane las die E-Mail noch einmal. Sie berührte den Antworten-Button und tippte über die Bildschirmtastatur eine kurze Nachricht zurück, dass sie heute Abend Skype einschaltete und auf Ellas Anruf wartete. Sie wollte ihr Beileid ausdrücken, fand jedoch nicht die richtigen Worte und drückte grußlos auf Senden. Dann wechselte sie von der Mail-App zum Browser und rief die Google-Seite auf. Sie tippte Boden und Katastrophe Buddbyträsket in das Eingabefeld und wählte anschließend die Nachrichtensektion von Google. Dann grenzte sie die Suche nach Meldungen innerhalb der letzten Woche ein.
Nichts.
Sie tippte nur Boden ein.
Zurück am Boden. Lärm am Boden. Auf dem Boden der Tatsachen. Zu Boden geschlagen. In Grund und Boden. Doppelter Boden.
Keine Nachrichten zum schwedischen Ort Boden. Ariane trank den Rest des Espressos und merkte, dass er mittlerweile kalt war. Sie verzog das Gesicht, drückte zweimal die Home-Taste des iPads und wechselte zurück in das Mailprogramm, um sich Ellas Nachricht durchzulesen. Sie hatte sich nicht verlesen. Der Ort stimmte. Als sie anschließend Google Maps startete und den Ort suchte, fand sie ihn auf Anhieb, ebenso wie den besagten See.
Ella hatte erwähnt, dass die Presse mundtot gemacht worden war und niemand darüber berichtete. Das konnte doch nicht sein.
Ariane legte das Pad auf den Tisch und sah zu Rocky. Als der Berner Sennenhund ihren Blick bemerkte, sprang er hoch und legte seine Vorderläufe auf ihren Schoß, damit sie ihn im Nacken kraulen konnte.
»Das Ganze ist reichlich merkwürdig, mein Dicker. Was denkst du, sagt Ella die Wahrheit oder fantasiert sie sich was zusammen?« Sie kannte die Schwedin nicht gut genug, um jederzeit die Hand für sie ins Feuer zu legen. Momentan stand ihr Wort gegen eine fehlende Berichterstattung. Aber selbst wenn die Presse nichts berichtete, musste doch wenigstens feststellbar sein, dass ihr Bruder und seine Familie verstorben waren.
Ariane zog einen Zettel von einem Notizblock und schrieb einige Stichworte auf. Sie würde eine E-Mail nach New York schicken. Einer ihrer Bekannten war Arzt bei der Gesundheitsbehörde. Wenn Ella recht hatte und man das Gebiet um den See abgeriegelt hatte, musste mehr geschehen sein als nur ein Unwetter. Vielleicht eine Virusepidemie, die man eingrenzen wollte?
Morgan-Thorne schrieb sie auf den Zettel. Sie hatte ihn bei einem Symposium kennengelernt und stand in lockerem Kontakt zu ihm.
O’Connell war der nächste Name auf dem Zettel. Liam O’Connell, ein Brite, Inspektor bei Scotland Yard – vielleicht konnte er über seine Interpol-Verbindungen etwas herausfinden. Immerhin war er ihr noch einen Gefallen schuldig.
Kapitel 2
Sterbe ich oder sterbe ich nicht?
Die Chancen für Tod oder Leben standen nach Albin Nielsens Einschätzung fünfzig-fünfzig. Der Tod konnte sehr überraschend kommen, doch in diesem Fall war er auf ihn vorbereitet.
Er sah in die Runde und fühlte sich in einen Science-Fiction-Film versetzt. In seiner Gesellschaft befanden sich fünfzehn Männer und Frauen, die in futuristische Ganzkörperpanzeranzüge gehüllt waren, die direkt einem Space-Marine-Szenario entstammen konnten. Die Tyr-Rüstung, benannt nach dem nordischen Gott des Kampfes und des Sieges, war ein hermetisch abgeriegeltes und autark arbeitendes Hightechsystem, das vor allen erdenklichen Gefahren Schutz bieten sollte: vergiftete Luft, verstrahlte Areale, Hitzewände, Kugelfeuer und Explosionsdruckwellen. Mit einer Tyr-Rüstung war ein Überleben unter Wasser bis zu 200 Metern möglich, ebenso konnte man damit Mondspaziergänge unternehmen. Das Innenleben der Anzüge strotzte vor hochtechnologischem Equipment und verfügte über eine ausgezeichnete Sensorik, um die Umgebung wahrzunehmen und Messergebnisse an den im Helm integrierten Computer weiterzuleiten. Strahlungswerte, biologische Erreger, Feinstaubbelastungen, Windgeschwindigkeiten, Temperaturen, Gaskonzentration in der Umgebungsluft: All das war nur ein Bruchteil dessen, was die Messfühler aufnehmen konnten.
Darüber hinaus war jedes Teammitglied mit einer persönlichen Ausrüstung entsprechend seinem jeweiligen Fachgebiet ausgestattet. Bewaffnet waren sie jedoch alle mit dem gleichen Gewehr: einem Lokipuls-Sturmkarabiner. Trotz der nordischen Anlehnung war die Waffe nicht in Schweden entwickelt worden, sondern eine Koproduktion des deutschen Waffenherstellers Heckler & Koch und der belgischen Firma Fabrique Nationale d’Armes de Guerre. Das Gewehr war bisher nicht in Serienproduktion gegangen, sondern existierte in einigen Prototypvarianten, von denen das schwedische Militär welche zu Testzwecken im Einsatz hatte. Das Lokipuls, wie es die Soldaten kurz nannten, verschoss in Munitionsstreifen gelagerte hülsenlose Projektile, die elektromagnetisch beschleunigt wurden. Der ausbleibende Rückstoß war ein Vorteil für die Mitglieder von Nielsens Gruppe, die nicht jeden Tag mit Waffentraining unter Gefechtsbedingungen beschäftigt waren. Außerdem erzeugten die beschleunigten Geschosse einen Reibungsstreifen in der Luft, der dem Glühen von Leuchtspurmunition gleichkam und somit beim Zielen half.
Trotz der hervorragenden Ausstattung, die den 16-Mann-Trupp gut und gerne einen Krieg gewinnen lassen könnte, war Nielsen skeptisch, was ihre Erfolgschancen betraf. Er atmete tief durch und schaltete auf die Helmlautsprecher um.
Die sechzehn futuristischen Ritter standen auf einer Anhöhe, etwa einen Kilometer vom Südufer des Buddbyträsket entfernt. Hinter ihnen befand sich der Ort Boden. Nielsen eingerechnet bestand die Gruppe aus zehn Elitesoldaten der schwedischen Spezialeinheit Särskilda Syddsgruppen – SSG. Die anderen Mitglieder waren Wissenschaftler mit militärischer Ausbildung oder vorzugsweise beim Militär beschäftigt: zwei Mediziner, Mikro- und Molekularbiologen, Virologen, Strahlungsexperten.
»Meine Damen und Herren, wenn ich jetzt um Ihre Aufmerksamkeit bitten darf.« Auf der Innenseite von Nielsens Visier wurden die Vitalfunktionen jedes Teammitglieds projiziert und an das Einsatzcamp, das sich im Süden Bodens befand, übertragen. Sie waren mit zwei Großraumhelikoptern hergebracht worden, die nach dem Absetzen der Gruppe sofort wieder zur Basis zurückgeflogen waren.
»Jeder Einzelne von ihnen gehört zu den Besten Schwedens auf seinem Fachgebiet, zumindest zu den Besten, die das Militär aufbieten kann. Dennoch können wir uns nicht allein auf unsere Ausbildung und Ausrüstung verlassen, wenn wir dem Unbekannten gegenübertreten. Hier noch einmal die Lage: Vor einer Woche sind am Ufer des Buddbyträsket siebenundzwanzig Menschen umgekommen. Die Ursache ist bisher unklar. Ein Rettungsteam, das nach Überlebenden suchen und die Leichen bergen sollte, starb ebenfalls direkt vor Ort. Es konnte einen Notruf absetzen, aus dem nur hervorging, dass die Teammitglieder der Reihe nach und ohne sichtlichen Grund starben.
Daraufhin wurde das Militär hinzugezogen und die Gegend um den See in einem Umkreis von fünf Kilometern unter Quarantäne gestellt und abgeriegelt. Ein Ärzteteam der Seuchenbehörde betrat das Areal unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Niemand von ihnen ist je zurückgekehrt. Es gab noch zwei Zwischenfälle, bei denen die Quarantänemauer durchbrochen wurde. Ein paar Jugendliche fanden ein Schlupfloch und kamen bis auf fünfhundert Meter an das Seeufer heran, ehe sie von einem Bewachungstrupp gestellt wurden. Bevor man die Jugendlichen zurückbringen konnte, suchte sie und auch die Soldaten das gleiche Schicksal heim wie alle anderen, die vorher am See verstarben. Der zweite Vorfall bestand in dem Vorhaben eines Reporterteams, mit einem Hubschrauber das Quarantänegebiet zu überfliegen und Aufnahmen zu machen.«
Nielsen streckte den gepanzerten Arm aus und deutete nach Norden. »Das Wrack des Hubschraubers befindet am Westufer des Buddbyträsket.«
Allgemeines Gemurmel erhob sich in den Helmlautsprechern. Alle hatten die Berichte gelesen und wussten, worauf sie sich bei dieser Mission einließen – oder besser gesagt, sie wussten es nicht. Dennoch war es eine Sache, in Notizen zu lesen, jedoch eine gänzlich andere, noch einmal eine Zusammenfassung nahe am Ort des Geschehens zu hören. Nielsen konnte es den anderen nicht verübeln.
»Wir können eine Virusepidemie wohl ausschließen«, sagte jemand. Im Display seines Helmes wurde der Name Dr. Eggström eingeblendet.
»Woraus schließen Sie das?« Das war Dr. Hanna Agren aus der Forschungsabteilung für biologische Kampfstoffe. Nielsen hatte sie erst gar nicht mitnehmen wollen, da sie Betroffene war. Soweit er wusste, war sie mit der Schwester eines Mannes eng befreundet, der mit seiner Familie am Osterwochenende hier gestorben war.
»Nun, wenn bereits ein Seuchenbekämpfungsteam unter strengsten Quarantänevorschriften hier war, ist doch davon auszugehen, dass keine Viren für das plötzliche Sterben verantwortlich sind. Oder glauben Sie, die Leute haben sich gegenseitig ihre biologischen Schutzanzüge aufgeschnitten?«
»Mit Verlaub«, sagte jemand anderes. »Aber wir wissen doch gar nicht, womit wir es hier zu tun haben. Vielleicht handelt es sich um bisher unbekannte Virenstämme, die in der Lage sind, sich …«
»… durch Bioschutzanzüge zu fressen?« Die Stimme Eggströms troff vor Hohn. »Machen Sie sich nicht lächerlich! Wie soll das denn gehen?«
»Säure produzierende Viren?«, hakte Hanna ein.
Ein Lachen klang aus Eggströms Mikrofon. Bevor die anderen damit beginnen konnten, wild zu diskutieren, unterbrach Major Albin Nielsen die Unterhaltung.
»Herrschaften, es gibt sicherlich noch genug Gesprächsstoff. Bevor wir uns jetzt in Mutmaßungen ergehen, sollten wir die Lage vor Ort erkunden. Unsere Tyr-Rüstung ist gegen biologische Erreger gleich welcher Form immun. Selbst wenn es so etwas wie Säure erzeugende Viren oder Bakterien geben …«
»Es gibt Säure produzierende Bakterien …«
Nielsen ließ sich nicht beirren, erhob seine Stimme und sprach einfach weiter: »… geben sollte, wird der Schutz unserer Außenummantelung ausreichen. Die Tyr-Rüstung wurde in Salz- und Schwefelsäurebädern getestet. Sie ist raum- und seetauglich und strahlungsresistent. Was immer das Seuchenteam hingerafft hat, wird uns kein Haar krümmen.«
Er fand, dass seine Worte ziemlich überzeugend herüberkamen, und hätte sich fast selbst geglaubt. Doch die Skepsis und Zweifel blieben.
»Also schön, wir gehen in zwei Gruppen zu je acht Mann. Löjtnant Larsen, Sie nehmen Dr. Eggströms Gruppe. Dr. Agren, folgen Sie mir bitte.«
Der federgesteuerte Antrieb der Tyr-Rüstung unterstützte die Gehbewegung der Muskeln, sodass der schwere Schutzpanzer kaum zu spüren war. Über das Gelände zu marschieren, fühlte sich fast wie ein Spaziergang im Park an. Tatsächlich lud das Grün des Areals zum Wandern ein. Die beiden Gruppen stapften über einen unbefestigten Weg mitten durch einen Mischwald. Sie näherten sich parallel zum See dem Nordufer, das nicht bewohnt war.
Nielsen rief sich eine Übersichtskarte der Umgebung auf das Helmdisplay und studierte das Südufer. Am Rand in Seenähe gab es mehrere Gebäude auf weiträumigen Parzellen. Den Daten nach einige Ferienhäuser und -siedlungen sowie Wanderhütten, dazu ein paar Gutshöfe. Das Gebiet war bis zu der Stadtgrenze der Gemeinde Boden evakuiert worden, auch wenn sich die Vorfälle bisher auf den nördlichen Bereich des Sees beschränkten.
Nielsens Aufgabe bestand nicht nur darin, die Leichen zu bergen, sondern auch festzustellen, ob eine Evakuierung Bodens notwendig war. Die Stadt hatte fast 20 000 Einwohner. So etwas ließ sich nicht mehr vor der Presse und der Öffentlichkeit verheimlichen.
»Noch knapp hundert Meter bis zur Sperrzone«, meldete sich Löjtnant Larsen über den Helmfunk.
Die Zone befand sich im angeblich sicheren Territorium. Erst knapp hundert Meter hinter ihr waren die ersten Todesfälle aufgekommen.
»Weiter. Wir halten an der Grenze.«
Nielsen stellte auf den privaten Kanal um und wählte direkt Hanna Agrens Tyr-Rüstung an. »Ist alles in Ordnung, Doc?«
Die Frau klang überrascht. »Warum fragen Sie?«
»Ich meine nur … wegen …«
»Schon gut, Major. Ich habe die Familie nur vom Sehen her gekannt. Es ist nichts, was mich in meiner Arbeit behindern würde.«
Nielsen nickte, auch wenn Hanna die Geste nicht sehen konnte. »Tut mir leid, dass ich gefragt habe.«
»Keine Ursache. Beten wir, dass unsere Ritterrüstungen wirklich einen Schutz gegen das darstellen, was das Massaker angerichtet hat.«
Der Wald lichtete sich und gab den Blick auf eine große Lichtung frei, die direkt in das Seeufer mündete. Ein paar Baumgruppen versperrten die Sicht auf den Buddbyträsket, doch es gab auch offene Stellen weiter nördlich. Zu jeder anderen Zeit wäre die Aussicht fantastisch gewesen, doch was die Mitglieder von Nielsens Team zu Gesicht bekamen, war der reinste Horror.
Die Lichtung und das Ufer waren gesäumt von Leichen. Sie lagen kreuz und quer verteilt auf dem Rasen und im Moos. Einige trugen Freizeitkleidung, andere die Westen von Rettungssanitätern und wieder andere lagen in Bioschutzanzügen dort. Manche befanden sich am Ufer des Sees. Etliche waren um eine riesige Picknickdecke verstreut. Eine Frau lag neben einem Wagen, der neben mehreren anderen am Rand der Lichtung geparkt war.
Nielsens Blick schweifte zu der Familie, die sich nur knapp zwanzig Schritt von ihnen entfernt befand. Das mussten die Degerlunds sein, die Familie, die Dr. Agren über die Schwester des Verstorbenen kannte.
»Mein Gott, haben wir die Zone bereits überschritten?«, rief jemand über Funk.
Tatsächlich befanden sie sich bereits innerhalb des Gefahrenperimeters. Nielsen sandte ein Signal an seinen Leutnant, doch Larsen reagierte nicht. Er ging auf den privaten Kanal.
»Isak, was ist los?«
»Major, wir haben ein Problem. Die Sensoren hätten uns anzeigen müssen, an welcher Stelle die Warnbojen platziert waren. Da war nichts. Wir sind in ein offenes Messer gelaufen. Ich hab es nicht über den offenen Kanal gesendet, um unsere Weißkittel nicht in Panik zu versetzen.«
»Verstanden, Löjtnant.« Nielsen wechselte auf die allgemeine Frequenz. »Äußerste Vorsicht. Wir befinden uns bereits im kontaminierten Bereich. Sobald irgendjemand irgendetwas Außergewöhnliches bemerkt, körperliche Symptome wie Schwindel, Übelkeit, Schmerzen oder Ähnliches, geben Sie sofort Bescheid und wir brechen die Mission ab. Volle Konzentration auf die Anzugsensoren. Dr. Agren, Viren und Bakterien. Dr. Eggström, atmosphärische Bedingungen. Dr. Emgren, Strahlungswerte. Soldaten, Verteidigungsring bilden!«
Sie teilten sich in zwei Gruppen. Nielsen lenkte seine absichtlich zu den Leichen des Seuchenteams, damit der Anblick von Degerlunds Familie keine unvorhersehbaren Reaktionen bei Dr. Agren auslöste.
Zwei Mediziner beugten sich über die Leichen in den Bioschutzanzügen und begannen mit einer Sichtuntersuchung.
»Keine äußeren Verletzungen«, sagte der eine.
»Das System ist intakt, wenn auch mittlerweile der Sauerstoff verbraucht ist.« Der zweite Arzt hob den behelmten Kopf und sah Nielsen an. »Wir werden erst bei einer Autopsie die Todesursache klären können.«
Der Major bezweifelte das. Siebenundzwanzig Menschen fielen nicht einfach ohne ersichtlichen Grund tot um, schon gar nicht, wenn sie in luft- und bakteriologisch dichten Anzügen steckten.
Nielsen blickte sich aufmerksam um. Die Gegend wirkte ruhig und friedlich auf ihn. Zu friedlich. Keine Vögel am Himmel oder den nahen Bäumen. Keine Tiere in der Nähe der Leichen. Nicht einmal Fliegen.
»Major?« Jemand aus dem anderen Team winkte Nielsen zu. »Das sollten Sie sich ansehen.«
»Bleiben sie hier, Dr. Agren, und bereiten Sie das Team für einen Abtransport vor.«
»Wie wollen Sie die Leichen von hier fortschaffen?«, fragte Hanna.
Nielsen deutete auf den Einsatzwagen des Seuchenteams und die beiden Rettungswagen, die hinter den anderen Fahrzeugen am Lichtungsrand parkten. »Wir nehmen die da. Schon eine Idee, wohin Sie sie bringen wollen?«
»Normalerweise ins EU-Seuchenzentrum nach Stockholm, aber solange wir nicht wissen, was hier geschehen ist, sollten wir vorsichtig sein und eine Untersuchungsbasis vor Ort einrichten.«
»Gut. Bereiten Sie alles vor.« Nielsen ging zu der anderen Gruppe, die sich um die Jugendlichen geschart hatte.
Dr. Eggström erhob sich. »Das ist merkwürdig, Major. Die Leute sind seit gut einer Woche tot. Es gibt keine Anzeichen von Leichenflecken, die spätestens dreißig Minuten nach Eintritt des Todes auftreten müssten. Der Verwesungsgrad ist minimal bis gar nicht vorhanden. Alle Leichen wirken konserviert.«
»Wie Mumien?«, fragte Löjtnant Larsen.
»Nein, eher wie für die Beisetzung aufgebahrte Tote.«
»Das ist möglich?«
»Nicht ohne Weiteres. Dazu hätten die Leichname präpariert werden müssen. Das Blut muss durch eine verwesungshemmende Lösung ersetzt werden, aber … wer sollte das hier getan haben? Wir werden erst Weiteres herausfinden, wenn wir …«
»Eine Autopsie durchgeführt haben«, vollendete Nielsen Eggströms Erläuterung. Er behielt die Messwerte seiner Anzugsensoren im Auge. Bisher war nichts Ungewöhnliches registriert worden. Zehn Grad Celsius Temperatur, schwacher Wind. Keine Form radioaktiver Strahlung. Keine Erreger, die die Sensoren erkennen konnten.
»Ich will nicht länger als nötig hier bleiben. Alle Leichen werden in die Fahrzeuge da drüben verfrachtet. Ich weiß, dass wir nicht genug Platz haben, also müssen wir sie stapeln. Wir werden sie zum Basiscamp hinter Boden bringen, das als Seuchenstation eingerichtet wird. Ich will maximal in einer Stunde von hier verschwunden sein.«
Die Teamleiter bestätigten und begannen mit der Arbeit. Währenddessen sah sich Nielsen weiter am Ufer um. Tatsächlich konnte er nirgendwo eine intakte Fauna erkennen. Kein Wild in der Nähe, keine Insekten. Normalerweise sah man im Buddbyträsket Fische, doch auch hier Fehlanzeige.
Von Tieren fehlte jede Spur.
Von ihren Leichen auch.
Albin Nielsen ließ seinen Blick in die Runde schweifen. Er sah die Soldaten, die Wissenschaftler, die Toten. Das Gefühl, von jetzt auf gleich der Nächste sein zu können, saß ihm im Nacken. Er ließ eine Uhrzeit im Innendisplay seines Helmvisiers projizieren. Sie waren bereits seit gut vierzig Minuten hier. Das Seuchenteam war zu diesem Zeitpunkt schon fünfunddreißig Minuten tot gewesen. Es hatte sie innerhalb der ersten fünf Minuten ihrer Ankunft erwischt.
Hielten die Tyr-Rüstungen, was sie versprachen? Konnte, was immer dort draußen lauerte, nicht oder nur schwerlich durch den Schutzpanzer dringen? Oder war das, was diese Leute dahingerafft hatte, gar nicht mehr hier?
Nielsen sog die Luft ein und schmeckte den leicht scharfen Geschmack des Luftgemisches aus seinen Sauerstoffflaschen. Für einen winzigen Moment dachte er daran, es zu riskieren: das Visier zu öffnen und die Außenluft einzuatmen, um zu sehen, was geschah. Er lachte leise und schüttelte im Helm den Kopf. Es war nicht die Zeit für Heldentaten. Dass er und die anderen noch lebten, hatte etwas zu bedeuten. Er musste herausfinden, was. Je eher, sie von hier fortkamen und die Leichen obduzieren konnten, desto besser.
Kapitel 3
Das Streichholz rieb am Zündblättchen und flammte auf. Wie gewöhnlich wartete Liam O’Connell damit, sich die Zigarette anzuzünden, und zögerte den Moment so lange hinaus, bis die Flamme fast die Haut seiner Fingerkuppen verbrannte. Er beobachtete fasziniert, wie sich die Energie durch das Holz fraß und sich Daumen und Zeigefinger näherte, während er in der anderen Hand die Benson & Hedges hielt. Viel zu teuer, um sie in drei oder vier Minuten zu inhalieren und dabei zuzusehen, wie der erlesene Tabak in Qualm aufging. In jeder ruhigen Minute wie dieser spielte O’Connell mit dem Gedanken, mit dem Rauchen aufzuhören.
In jeder ruhigen Minute wie dieser verlor er den Kampf.
Die Flamme berührte den Tabak und das Zigarettenblättchen. Würziges Aroma stieg auf. O’Connell nahm einen Zug und blies das Streichholz aus, ehe seine Fingerkuppen Brandblasen warfen. Er stieß den Rauch aus, schnippte das heruntergebrannte Streichholz in den Aschenbecher auf seinem Tisch und stützte sein Kinn in die freie Hand. Er sah auf den Bildschirm vor sich und klickte sich durch ein paar Google-Seiten im Internet. Eigentlich wäre er heute gar nicht im Büro gewesen, sondern würde jetzt in einem Flieger nach Hongkong sitzen, um an einer Übergabe von Dokumenten teilzunehmen. Das Treffen war in letzter Minute abgesagt worden. Der Flug wurde storniert und O’Connells Gepäck befand sich noch auf dem Weg vom Flughafen zu seiner Wohnung in London. So etwas passierte hin und wieder. Doch dann gab es unerträgliche Leerläufe, die in Langeweile gipfelten. Er überlegte, ob er einige Berichte aufarbeiten sollte, befand jedoch, dass er nach der Zigarette für den Rest des Tages freinehmen würde, um sich zu Hause auf der Couch zu entspannen. Den tausendseitigen Neal-Stephenson-Wälzer Reamde hatte er zum Glück im Handgepäck. Er würde ein paar Kapitel lesen, Scotch dabei schlürfen und am Abend eine Blu-Ray einwerfen. Irgendwie ließ sich ein geplatzter Auftrag schon kompensieren. Zumindest heute. Morgen sah die Welt ganz anders aus.
O’Connell wurde jäh aus seinen Gedanken gerissen, als die Tür aufflog und Noah Zabot seinen wirren Blondschopf durch den Rahmen streckte.
»Ah, du bist noch da.«
»Ich hau auch nicht ab.«
Zabot trat ein, hielt aber die Türklinke fest, als wolle er jeden Moment wieder gehen. »Hongkong?«
O’Connell schüttelte den Kopf.
»Autsch! Na, hast du dir schon einen Alternativplan überlegt?«
»Ich geh mit Stephenson auf die Couch.« O’Connell nahm einen weiteren Zug aus der Zigarette und lehnte sich in seinem Bürostuhl zurück.
»Ist Stephenson dein Hund oder deine Flamme?«
Statt zu antworten, beugte sich O’Connell vor, griff in seine Reisetasche und zog den Schmöker hervor. Er knallte das Buch auf den Tisch.
»Verstehe.« Zabot grinste. »Falls du nichts Besseres zu tun haben solltest, als deine Nase in einen Science-Fiction-Roman zu stecken, könntest du dich der Realität widmen. Da hat jemand für dich angerufen.«
O’Connell runzelte die Stirn, als der Kollege nicht weitersprach. »Und? Verrätst du auch, wer, oder muss ich dafür einen Vokal kaufen?«
»Eine Frau. Sie kam über die Rufumleitung deiner alten Scotland-Yard-Nummer.«
Scotland Yard. Es war schon drei Jahre her, dass er beim Metropolitan Police Service London als Detective Inspector gearbeitet hatte. Danach gab er ein Gastspiel bei der Royal Navy, als er während des Afghanistan-Konflikts als Reservist einberufen und abkommandiert wurde. Sein Vorgesetzter bei der Polizei war alles andere als begeistert, doch die Navy brauchte einige Soldaten, die in verdeckten Operationen ausgebildet waren. O’Connell begrüßte die Abwechslung zunächst. Sein Wechsel zum britischen Auslandsnachrichtendienst, der Military Intelligence, Sektion 6 – kurz MI6 –, war abrupt gekommen. Dabei half ihm seine militärische Laufbahn und ein heldenhafter Einsatz in Afghanistan, bei dem er eine Gruppe Zivilisten vor einem Anschlag der Taliban rettete. Die Rekrutierungsoffiziere des Secret Service arbeiteten schnell und zuverlässig. Sie warben ihn von New Scotland Yard direkt nach Vauxhall Cross ab, beförderten ihn vom Sub-Lieutenant der Royal Navy zum Lieutenant im Feldeinsatz Ihrer Majestät.
Es gab zwei, drei Übergabeszenarien und Infiltrationsaufträge, doch die meiste Zeit saß Liam O’Connell tatsächlich am Schreibtisch und wertete Satellitenaufnahmen, Telefonmitschnitte und E-Mails aus, besprach sich mit anderen Sicherheitsbehörden und fand das Geheimagentenleben alles andere als spannend. Bei der Kriminalpolizei war zumindest etwas los gewesen.
»Du sagst deinen Frauen immer noch, dass du bei der Polizei beschäftigt bist?«, stichelte Zabot mit breitem Grinsen, das O’Connell dem anderen am liebsten aus dem Gesicht geschlagen hätte.
Noah Zabot war sein Verbindungsoffizier während der Auslandseinsätze gewesen. Er war kein gebürtiger Brite. Sein Vater stammte aus Algerien, die Mutter aus Frankreich. Die Großeltern mütterlicherseits kamen allerdings aus London. Zabot lebte nach eigenen Angaben seit über fünfzehn Jahren wieder in England, hatte die britische Staatsbürgerschaft erworben und war nach seiner Militärzeit zunächst zum MI5, dem Inlandsnachrichtendienst, und später dann zum MI6 gekommen. Trotz O’Connells Bemühungen, mehr über Zabots Privatleben bei einem Bier nach Feierabend zu erfahren, blockte der Kollege stets ab. Dabei war er selbst äußerst neugierig, alles über O’Connell zu erfahren. Seine Sticheleien und taktischen Fragen widerten O’Connell mittlerweile an.
»Vergiss es einfach, Zabot. Wer hat angerufen?«
Zabot blickte auf einen Zettel. »Ihr Name ist Ariane Hellenberg. Deutsche Rufnummer.« Er trat an O’Connells Tisch heran und legte ihm den Zettel mit krakelig geschriebenem Namen und Nummer auf die Computertastatur.
»Sie sagte, es gehe um einen Vorfall in Schweden, den die Regierung vertuschen würde, und ob du über Interpol etwas herausbekommen könntest.«
O’Connell runzelte die Stirn. »Das hat sie dir erzählt?«
»Na klar, ich bin doch dein bester Kollege bei Scotland Yard.«
»Arschloch!« O’Connell machte eine Handbewegung, um den anderen zu verscheuchen, und griff nach dem Hörer. Von Ariane hatte er schon seit über einem Jahr nichts gehört.
»Woher kennst du sie?«, fragte Zabot auf dem Weg zur Tür.
»Pass mal auf, Franzose, das geht dich überhaupt nichts an.«
»Ganz wie du meinst, Ire, aber ich denke, wir werden noch darüber reden.« Zabot verließ das Bürozimmer, ließ die Tür aber offen.
O’Connell seufzte. Die alte Leier zwischen ihnen. Wenn er wütend auf Noah war, nannte er ihn einen Franzosen, und der hatte nichts Besseres zu tun, als ihn wegen seines Namens als Iren zu beschimpfen. Natürlich hatte er irische Wurzeln, aber die lagen wesentlich weiter zurück als Zabots französisch-algerische.
Während er die Nummer wählte, rief sich O’Connell Arianes Gesicht in Erinnerung. Sie waren sich durch Zufall in London begegnet. Ariane war auf Urlaubsreise gewesen und sie hatten sich ein Taxi von Heathrow in die Innenstadt geteilt. Anschließend waren sie in der Lounge des Hotels, in dem Ariane ein Zimmer gebucht hatte, hängen geblieben und hatten über vier Stunden bei Tee und Latte macchiato über Gott und die Welt gequatscht. O’Connell war sich sicher, dass er sie rumgekriegt und sie ihn mit auf ihr Zimmer genommen hätte, aber er wahrte An- und Abstand. Sie hielten losen Kontakt per E-Mail und einmal hatte er sie angerufen, weil sie für ihn in ihrer Journalistenfunktion eine Recherche betreiben sollte. Er schuldete ihr etwas dafür, denn dank ihrer Hilfe musste er nicht den bürokratischen Weg wählen und offizielle Kanäle bemühen, was nur zu unzähligen Antragsformularen und dem Warten auf Genehmigungen geführt hätte. Selbstredend hatte er ihr gegenüber erwähnt, dass er für die Londoner Kriminalpolizei arbeitete. Im Umgangsjargon redeten alle von Scotland Yard, als ob es eine Behörde wäre, doch der New Scotland Yard war nur das Gebäude, in dem die Dienststellen des Metropolitan Police Service of London untergebracht waren.
»Hellenberg?«
O’Connell schrak auf. Er war ziemlich vertieft in Erinnerungen gewesen und hatte nicht damit gerechnet, dass jeden Moment jemand abheben konnte.
»Hallo!«, sagte er rasch. Seine Stimme klang heiser. Verflucht!
»Wer ist denn da? Liam?«
»Ja, entschuldige. Ich hatte gerade – wie sagt ihr? – einen Frosch im Hals …«
»… der keine Miete zahlt, ja.« Ariane lachte.
Er hatte ganz vergessen, wie schön ihre Stimme klang. Nicht zu dunkel und weit davon entfernt, schrill zu sein. Angenehm. Mit einem Mal wünschte er sich, er hätte sich nicht zu rasch von ihr verabschiedet, als sie hier gewesen war.
Reiß dich zusammen!
»Wie geht es dir?«, fragte er.
Sie prustete. »Eigentlich ganz gut, aber … ach, tut mir leid, wenn ich gleich zur Sache komme. Ich bin auf dem Sprung und hab einen Flug gebucht, den ich erwischen muss.«
Einen Flug? O’Connell merkte, wie sein Herz einen Satz bei dem Gedanken machte, sie könnte nach London kommen. Er atmete tief durch.
»Wohin geht es denn?«
»Schweden.«
O’Connell erinnerte sich an Zabots Worte, dass Ariane wegen Schweden angerufen hatte.
»Das ist alles nicht so einfach. Ich hab mittlerweile einen putzigen Hund, den ich bei jemandem unterbringen muss, aber Bille hat sich bereit erklärt, auf ihn aufzupassen, solange ich fort bin.«
Ein Hund. Bille. Er hatte keine Ahnung, wer Bille war, und ertappte sich dabei, dass er hoffte, es handele sich um einen weiblichen Kosenamen. Arianes Englisch war ausgezeichnet. Sie sprach akzentfrei, als käme sie direkt von der Oxford University.
»Aber darum geht es nicht. Ich habe in Schweden eine Freundin, na ja, eher eine Brief- und Internetfreundin, obwohl ich sie schon mal gesehen habe. Ihr Bruder und seine Familie sind vor etwa einer Woche plötzlich verstorben. Soweit Ella, das ist meine Freundin, also … soweit sie sagen kann, war ihr Bruder mit Frau und Kindern über Ostern an einem See in der Nähe von Boden.«
O’Connell notierte den Ort und tippte ihn gleich bei Google Maps ein. Eine Karte erschien auf dem Bildschirm, während Ariane weiterredete.
»Die Behörden haben sie vom Tod der ganzen Familie unterrichtet. Angeblich ein Unwetter, das zu Überschwemmung an einem Seeufer geführt hat. Als Ella die Leichen sehen wollte, wurde ihr das verwehrt, weil die Gerichtsmedizin sie noch nicht freigegeben hätte. Von Unwetterwarnungen war auf keinem Nachrichtensender die Rede. Ella meint, dass es noch weitere Todesfälle am See gibt.«
Ariane hielt inne.
»Nun, vielleicht ist die Todesursache noch nicht ganz klar, daher die fehlende Freigabe«, sagte O’Connell. »Glaubt deine Ella denn, dass es kein Unfall war?«
»Ich fürchte, sie hat sich das in den Kopf gesetzt. Wir haben gestern geskypt, sie war völlig aufgelöst und aufgebracht und sprach von einer Verschwörung.«
»Offenbar hat sie dich damit angesteckt, Ariane.«
»Wie meinst du das?«
»Du sprichst so schnell, wenn du dich aufregst oder erregt bist.«
»Oh!«
»Macht nichts. Aber wie komme ich ins Spiel?«
»Nun … ich weiß auch nicht, ich möchte nur etwas herausbekommen. Ich dachte mir, wenn es irgendetwas gibt, das die schwedische Regierung der Öffentlichkeit vorenthält, dann kann es doch nur ein Skandal oder ein Verbrechen sein. Und wenn es ein Verbrechen ist, vielleicht Brandstiftung, ein Chemieunfall, ein terroristischer Angriff oder irgendetwas, dann könntest … du … vielleicht …?«
Sie stockte bei den letzten Worten. O’Connell musste lächeln und zwang sich, nicht das Wort süß laut auszusprechen. Er schnalzte mit der Zunge und wollte erwidern, dass er das nicht für sie tun konnte, aber er wusste, dass sie ihm dann mit dem Gefallen kam, den er ihr schuldete. Zu dumm nur, dass sie damit recht hatte. Es konnte sicherlich nicht schaden, sich etwas umzuhören, nur um ihr den Gefallen zu tun. Wie viele Informationen er dann an sie weitergab, stand auf einem anderen Blatt.
»Ich kann mich mal umhören«, sagte O’Connell. »Versprechen kann ich natürlich nichts, aber unter uns, ich glaube nicht, dass etwas da dran ist. Ich kenne deine Ella nicht, aber vielleicht ist sie nur etwas hysterisch. Das kann ihr niemand angesichts ihres Verlusts verübeln. Du willst trotzdem ihretwegen nach Schweden?«
»Ich hab es ihr versprochen. Sie ist völlig aufgelöst und daneben.« Ein Seufzen drang aus dem Telefon. »Ich muss jetzt los, Liam. Mein Flieger landet um 18:30 Uhr in Stockholm. Kannst du mich anrufen?«
»Falls ich bis dahin was habe. Bleibst du in Stockholm?«
»Nein«, sagte Ariane. »Ich hab einen Anschlussflug nach Luleå und bin dann wieder nicht erreichbar. Falls mein Telefon ausgeschaltet ist, schick mir doch bitte eine Mail. Ich rufe sie ab, sobald ich gelandet bin.«
»Okay. Ich hoffe, ich kann dir helfen oder dich zumindest beruhigen, dass die Verschwörungstheorien deiner Freundin keinen realen Hintergrund haben. Schön, mal wieder was von dir zu hören, Ariane. Wir könnten vielleicht öfter mal reden.« Was sag ich da? »Nur wenn du magst«, beeilte er sich zu sagen.
Ein Lachen. »Klar. Mach’s gut, bis später, okay?«
»Bye!«
Die Verbindung wurde unterbrochen. O’Connell legte den Hörer zurück auf die Gabel, schürzte die Lippen und dachte nach. Schweden. Ausgerechnet Schweden.
Er schüttelte den Kopf, stand auf und ging ins Nebenbüro, wo Zabot sich durch einen Stapel Berichte kämpfte. Als O’Connell anklopfte, blickte der Blonde auf und zog fragend eine Braue hoch.
»Na? Wird’s ein Date?«
O’Connell legte den Kopf schief und funkelte sein Gegenüber an. »Das geht dich einen Scheißdreck an, Zabot. Sag mal, hattest du nicht Aktien in Schweden?«
Zabot hob abwehrend die Hände. »Schon gut, ich wollte dich nur aufziehen.«
»Das kenn ich ja von dir.« O’Connells Stimme glich dem tiefen Brummen eines Baggermotors.
»Schweden? Ja, ich hab da ein paar Kontakte aus einer alten Operation.«
»Irgendetwas Frisches dabei?«
»Russische Flottenbewegungen im Nordpolarmeer?«, fragte Zabot und grinste. »Die Zeiten sind eigentlich längst vorbei.«
»Eher Ostsee. Luleå.«
Zabot machte eine wegwerfende Geste. »Da tut sich nachrichtendienstlich so gut wie gar nichts. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Verlegung der Truppenstützpunkte ziemlich uninteressant geworden.«
»Kannst du deine Quellen anzapfen und hören, ob es irgendwelche Vorfälle in der letzten Woche gab, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind? Am Seeufer bei Boden?«
»Klar. Wenn du mir verrätst, was mit der Kleinen aus Deutschland ist?«
O’Connell verzog die Mundwinkel. »Noah Zabot, du bist und bleibst ein kleines Arschloch.«
Zabots Grinsen wurde breiter. »Ich weiß.«
O’Connell drehte sich um und hatte bereits die Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit mit Zabot aufgegeben, als dieser ihm hinterherrief: »Gib mir eine halbe Stunde, alter Schwede.«
Exakt neunundzwanzig Minuten und drei Benson & Hedges später läutete Liam O’Connells Telefon. Der Anrufton signalisierte ein internes Gespräch, das von irgendwo aus dem Gebäude kam. O’Connell kannte die Nummer nicht. Er hob ab.
»O’Connell.«
»Ich bin’s, Noah.«
»Von wo aus rufst du an?«
»Satellitenraum. Du solltest mal hier runterkommen. Aber beeil dich.«
Satellitenraum? »Ich komme.«
O’Connell legte auf. Der SAT-Raum befand sich drei Stockwerke unter der Erde. Um dorthin zu gelangen, brauchte er eine Freigabe der Stufe 1 und normalerweise eine zusätzliche Genehmigung durch seinen Vorgesetzten. Als O’Connell den Hauptkorridor nahm und dann im Aufzug das dritte Untergeschoss anwählte, wurde seine ID-Card anstandslos akzeptiert. Offenbar hatte sein Abteilungsleiter seinem Aufenthalt bereits zugestimmt.
Tatsächlich befand sich Colonel Gilbert Aidan Smythe gemeinsam mit zweien seiner Analysten und Noah Zabot im Satellitenraum, als O’Connell diesen betrat. Was zum Henker war hier los?
»O’Connell, woher haben Sie die Schweden-Information?« Smythe rauchte Zigarre, obwohl der Konsum von Nikotin und Speisen im SAT-Raum strengstens untersagt war. Der Mann hatte breite Schultern und war etwa 1,90 Meter groß. Sein Haar war voll, doch bereits so ergraut, dass er nicht mehr den Versuch unternahm, Stellen nachzufärben. Eine Narbe verunstaltete seine Nasenspitze. Das wenig rühmliche Andenken verdankte er keinen Kampfhandlungen, sondern einer Auseinandersetzung vor einigen Jahren mit der Katze seiner Tochter.
»Eine Journalistin aus Deutschland rief mich an. Ihre Brieffreundin aus Schweden ist die Schwester eines Verstorbenen, dessen Tod und der seiner Familie angeblich von den schwedischen Behörden unter Verschluss gehalten werden. Worum geht es überhaupt?«
Smythe nickte in Zabots Richtung.
Der schluckte sichtlich und sah O’Connell an. »Ich hab ein bisschen telefoniert: Interpol, schwedischer Geheimdienst, Botschaft. Der Polizei lagen keine Informationen vor, auch die Botschaft hatte keine Kenntnis von irgendwelchen Vorfällen. Allerdings hat mein Kontaktmann beim Nachrichtendienst das Gespräch gleich abgewürgt und mich gewarnt, die Finger davonzulassen. Dass mich das erst recht neugierig gemacht hat, muss ich nicht unbedingt erwähnen. Da dies keine offizielle Operation ist, hab ich die Finger von Anträgen auf einen Satelliten gelassen, aber ich kenne jemanden bei der ESA, der mir für den Zeitraum der letzten Woche Aufnahmen eines europäischen Wettersatelliten zur Verfügung hat kommen lassen. Wenn die Schweden etwas vertuschen wollen, ist das ihr Bier, aber sie haben keine Kontrolle über die Wettersatelliten.«
Zabot wandte sich zum riesigen Plasmaschirm an der Wand und drückte eine Taste auf einer Fernbedienung, die aussah wie ein Smartphone. Vermutlich war es eines.
»Auf den ersten Blick ist nichts Ungewöhnliches zu erkennen, man muss wissen, wonach man sucht. Mein Anhaltspunkt war das Seeufer nahe der Stadt Boden. Hier!«
Er berührte den Touchscreen der Fernbedienung und zoomte die Satellitenaufnahme auf maximale Vergrößerung heran. Das Bild wurde körnig, doch anhand der Farben konnte man deutlich Grünflächen wie Wälder von den Brauntönen der Wiesen und dem Blaugrau des Wassers unterscheiden. Zwischen einem blauen Farbklecks und einem grünen befanden sich menschliche Silhouetten.
O’Connell wusste, was das bedeutete. Arianes Freundin aus Schweden hatte recht.
»Ich habe die Aufnahmen über mehrere Stunden verfolgt. Nicht einer von denen hat sich bewegt. Es ist später Vormittag am Ostersonntag. Auch am späten Nachmittag liegen sie alle noch genauso da. Für andere Zeiträume gibt es keine Aufnahmen mehr, da die Satellitenkameras auf andere Regionen ausgerichtet wurden. Wir könnten einen unserer skandinavischen Überwachungssatelliten in Parkposition über Luleå bringen, wenn wir das zu einer offiziellen Operation machen wollen.«
»Wir machen es zu einer«, sagte Smythe. »Aber unauffällig.« Er wandte sich O’Connell zu und blies den Zigarrenrauch aus. »Und Sie haben eine Reise nach Schweden gewonnen. Finden Sie heraus, was da vor sich geht. Wenn es sich um einen terroristischen Angriff handelt, werden wir Maßnahmen treffen. Entpuppt sich das Ganze nur als Amoklauf irgendeines Wahnsinnigen, brechen wir ab.«
»Halten Sie das denn wirklich für notwendig?«, fragte O’Connell. »Wir könnten die Schweden mit diesen Fotos konfrontieren und eine Erklärung verlangen.«
»Wenn die sich jetzt noch nicht an die EU-Kommission gewandt haben, dann werden die uns nur mit irgendwelchen Lügen abspeisen. Fliegen Sie nach Schweden. Ach, nur aus Neugier, hat Ihre Kontaktperson gesagt, was sie vermutet, wie diese Leute gestorben sind?«
O’Connell schürzte die Lippen. »Nein. Aber was immer es gewesen ist – wenn man sich die Fotos betrachtet, gibt es zumindest drei Kategorien von Opfern.«
Alle wandten sich dem Schirm zu, während O’Connell sich einen Laserpointer von Zabot ausborgte und mit dem Lichtpunkt Kreise um die Menschen auf der Satellitenaufnahme zog.
»Wir sehen hier ein paar parkende Wagen und eine Gruppierung von Leuten. Das dürften die Erstbetroffenen sein, Menschen, die bereits vor Ort waren, als es geschah. Dann haben wir hier Rettungsfahrzeuge.« Der Lichtpunkt verharrte auf dem Dach eines Fahrzeugs, das einen Rufcode für Luftfahrzeuge aufgedruckt hatte. Von dort wanderte er weiter zu drei Körpern, die sich in der Nähe des Fahrzeugs auf dem Boden befanden. Auch wenn das Bild unscharf und grob war, war anhand ihrer Kleidung deutlich zu erkennen, dass es sich um Rettungssanitäter handeln musste.
»Ich gehe davon aus, dass die erst später dazugekommen sind.«
Der Lichtpunkt vollführte einen Satz zu einem größeren Fahrzeug am Rand der Lichtung. Offenbar ein Lkw.
»Das hier dürfte ein Fahrzeug der Seuchenbehörde sein und hier«, der Laser erfasste einige leblose Körper vor dem Wagen, »haben wir die Wissenschaftler des Teams, sauber eingepackt in ihre Bioschutzanzüge und dennoch tot. Was immer sie erwischt hat, ist über einen längeren Zeitraum dort gewesen oder immer noch da. Es sieht fast so als, als hätte etwas oder jemand sie aus heiterem Himmel ins Jenseits befördert. Als wären sie einfach tot umgefallen.«
Smythe sog scharf die Luft ein.
Ein Röcheln kam aus Zabots Richtung. O’Connell blickte seinen Kollegen an und stellte fest, dass er kreidebleich geworden war.
»Alles in Ordnung?«, fragte er.
»Einfach tot umge…« Zabot sah zur Seite und begegnete O’Connells Blick. Er fasste sich. »Schon gut, alles in Ordnung. Ich werde einen Satelliten anzapfen und sehen, ob wir aktuelle Bilder bekommen.«
»Gentlemen.« Smythe blickte in die Runde. »Sie wissen, was Sie zu tun haben. An die Arbeit!«
Kapitel 4
Der Flug von Hannover nach Luleå war abenteuerlich gewesen. Ariane Hellenberg nahm sich vor, bei ihren zukünftigen Reiseplanungen keine exotischen Ziele mehr in Angriff zu nehmen. Die meisten ihrer Redaktionskollegen wussten nicht einmal, wo Luleå lag. So war sie besser beraten, ihnen mitzuteilen, dass sie einen Trip nach Stockholm machte.
Von Hannover ging es mit einem Inlandsflug nach Frankfurt. Ihr Gepäck war allerdings irrtümlich nach München verschickt worden. Um den Anschlussflug nach Stockholm nicht zu verpassen, nahm sie die geplante Maschine der Scandinavian Airlines. Man versprach, ihr den Koffer hinterherzuschicken. In Stockholm hatte die Maschine nach Luleå zwei Stunden Verspätung und bis dahin war ihr Gepäck noch immer nicht eingetroffen. Ariane sah sich die Nacht schon in der Wartehalle im Flughafen verbringen, als dann doch der Flug nach Luleå angekündigt wurde. Ihr Koffer kam auf den letzten Drücker mit einer Maschine aus Berlin nach Stockholm. Zweifelsohne hatte er jetzt jeden Winkel Deutschlands gesehen. Glücklicherweise befand er sich noch in demselben Zustand, in dem sie ihn in Hannover aufgegeben hatte.
Glück im Unglück, dachte Ariane während sie den Trolley durch den Ankunftsterminal hinter sich her zog. Es war früher Abend und Ariane spielte mit dem Gedanken, sich an einem Kiosk mit Magazinen einzudecken, doch noch bevor sie den nächsten Zeitschriftenstand ansteuern konnte, erinnerte sie sich daran, warum sie hier war. Dies war weder eine Urlaubsreise noch eine Recherche für eine normale Reportage. Ariane hatte sich immer auf den Bereich wissenschaftlicher Fachjournalismus konzentriert und nie daran gedacht, Krisen- oder Sensationsreporterin zu werden. Sie verschmähte die Kollegen, die sich wie die Aasgeier auf jedes Fitzelchen Information stürzten, nur um ein aktuelles Thema bis zur Neige auszuschöpfen.
Ich bin hier, um einer Freundin zu helfen, sagte sie sich, auch wenn sie den Begriff Freundschaft wohl neu definieren musste, denn Ella war im Grunde nicht mehr als eine Urlaubsbekanntschaft, zu der Ariane anschließend einen lockeren Kontakt gehalten hatte. Wie gut, dass sie freischaffend tätig war. Zwar ließen sich die Kosten für die Flüge nach Schweden und zurück nicht über die Redaktion absetzen, aber zumindest konnte sie sich sofort freinehmen, ohne Urlaubsansprüche geltend machen und sich mit ihren Kollegen abstimmen zu müssen.
Der Flughafen von Luleå war überschaubar und glich den kleinen Regionalflughäfen in Deutschland. So passierte Ariane rasch die Ankunftshalle und wehrte einen beflissenen Mann ab, der ihren Koffer zu einem Taxi tragen wollte. Sie hoffte, dass Ella Wort hielt und sie am Flughafen abholte.
Kurz vor dem Ausgang blieb Ariane stehen und strich sich eine Strähne ihres brünetten Haares hinter das Ohr. Sie griff in ihre Jackentasche nach dem iPhone, entsperrte den Bildschirm mit einem Daumenwischen und und rief das Einstellungsmenü auf, um den Flugmodus zu deaktivieren. Es dauerte eine halbe Minute, bis sich das Telefon ins schwedische Netz eingebucht hatte. Dann poppte auch schon ein Nachrichtenfenster auf. Sie hatte drei SMS erhalten.
Die erste kam vom schwedischen Mobilfunkanbieter und teilte ihr auf Schwedisch und Englisch mit, dass sie von günstigen Roamingkosten profitieren konnte. Die zweite Nachricht war von ihrer Freundin Sybille Stobbe.
Ari, das war das letzte Mal, dass ich deine olle Töle zu mir genommen habe. Er hat mir die ganze Wohnung vollgemacht. Du schuldest mir was. Komm rasch zurück. Bille.
Ariane schmunzelte. Sie wusste, dass Sybille ihr nicht wirklich böse war, denn sie war in Rocky vernarrt und hätte ihn am liebsten behalten. Jedes Mal, wenn Ariane den Hund abholte, lag Sybille ihr in den Ohren, dass sie ihn gar nicht wieder hergeben wollte.
Die zweite SMS stammte von Liam O’Connell. Ariane runzelte überrascht die Stirn. Sie hatte eigentlich nicht mit einer Antwort von ihm gerechnet. Umso erstaunter war sie, als sie den schlichten, sachlichen Text las.
Ariane, wir sehen uns in Luleå. Liam.
Er kommt hierher? Was bildet sich dieser Kerl eigentlich ein? Will er die Situation ausnutzen, um mich wiederzusehen?