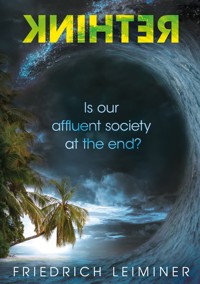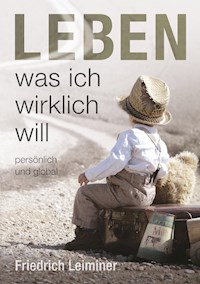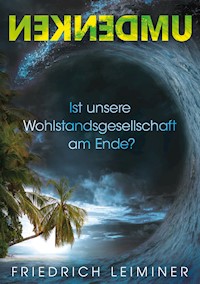
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ist unsere Wohlstandsgesellschaft am Ende? Bevölkerungswachstum, Naturzerstörung, Artensterben, Pandemien, Mobilität, Klimawandel, Kriege, Hunger und Armut stellen uns alle vor immense Herausforderungen. Wir leben in einer Zeit brodelnder Konflikte und massiven institutionellen Versagens. Wir leben auf einer dünnen Kruste aus Ordnung und Stabilität, die jederzeit auseinanderbrechen kann. Doch in unserer Gesellschaft steht gegenwärtig weiterhin die Befriedigung materieller Bedürfnisse im Vordergrund, die aktuell unserer Heimatplaneten und seine Ökosysteme in den Ruin treibt. Wir halten verbissen an Glaubensmustern und Hypothesen fest, selbst wenn diese eindeutig widerlegt wurden. Es dominieren planwirtschaftliche Gruppierungen, die ausschließlich um die eigene Ressourcenversorgung besorgt sind. Luxuskonsum und Aufrüstungswahnsinn dürfen wir uns nicht mehr leisten, wenn wir unseren Planeten nicht ruinieren wollen. Wir haben Grenzen überschritten, die zu überschreiten uns als Menschen schlicht und einfach nicht zusteht! Wir müssen Widersprüche realisieren und handeln. Wenn wir jetzt nicht aktiv werden, hat es für die gesamte Menschheit unabsehbare Folgen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
In welcher Welt leben wir?
Kollektiv und Individuum
Wie viele Herdentiere verträgt das Kollektiv?
Wo ist mein Platz in der Gesellschaft?
Verschwörungstheorien
Der Mythos vom besser sein
Warum gibt es Krieg?
Sie nannten es Demokratie!
Was macht Macht?
Wie können Menschen gerecht in einer Gesellschaft zusammenleben?
Die Würde des Menschen ist unantastbar
Wege zum Frieden
Warum hege ich Groll gegenüber anderen?
Konflikte und Konfliktlösungen
Die Macht unserer Gedanken
In welcher Zukunft wollen wir leben?
Wie frei bin ich?
Künstliche Intelligenz als Chance?
Klimawandel / globale Transformation?
Sind wir bereit für den Wandel?
Ubuntu – Die Philosophie der Menschlichkeit
Literatur
Hinweisverzeichnis
Vorwort
Bevölkerungswachstum, Naturzerstörung, Artensterben, Pandemien, Mobilität, Klimawandel, Kriege, Hunger und Armut stellen uns alle vor immense Herausforderungen. Wir leben auf einer dünnen Kruste aus Ordnung und Stabilität, die jederzeit auseinanderbrechen kann. Doch in unserer Gesellschaft steht gegenwärtig weiterhin die Befriedigung materieller Bedürfnisse im Vordergrund, die aktuell unseren Heimatplaneten und seine Ökosysteme in den Ruin treibt. Es dominieren planwirtschaftliche Gruppierungen, die ausschließlich um die eigenen Ressourcenversorgung besorgt sind. Luxuskonsum und Aufrüstungswahnsinn dürfen wir uns nicht mehr leisten, wenn wir unseren Planeten nicht ruinieren wollen. Wir haben Grenzen überschritten, die zu überschreiten uns als Menschen schlicht und einfach nicht zusteht! Wir müssen Widersprüche realisieren und handeln. Wenn wir jetzt nicht aktiv werden, hat es für die ganze Menschheit unabsehbare Folgen. Ist unsere Wohlstandsgesellschaft am Ende?
Wir leben in einer Zeit brodelnder Konflikte und massiven institutionellen Versagens. Die Krisen unserer Zeit offenbaren das Sterben einer veralteten sozialen Struktur und einer bestimmten Art des Denkens, einer überkommenen Art der Institutionalisierung und sozialer Formen. Wir halten verbissen an Glaubensmustern und Hypothesen fest, selbst wenn diese eindeutig widerlegt wurden. Wir verhalten uns so, als ob wir die Realität einfach ausblenden könnten. Die Missstände werden verwaltet, statt zu handeln. Die politische Führung hat in den letzten Jahrzehnten wichtige gesamtgesellschaftlicheAufgaben aus den Augen verloren. Wir dürfen nicht wegschauen und hoffen, dass unsere Probleme schon wieder verschwinden werden. Gregor Gysi schreibt: Wir leben in einem Krisenkapitalismus. Auswege müssen dringend gesucht werden. Auswege, die wieder Wege sind, nicht mehr nur Notausgänge und letzte Ausfahrten in die nächste Krise.
Unsere Zeit ist eine Zeit des Umbruchs und des Wandels und das alte System wird zunehmend infrage gestellt werden. War jedoch früher die Krise ein Aufbruchssignal, ein Durchgangsstadium in eine bessere Zukunft, ist sie heute für viele angsteinflößend aufgrund der Vielzahl und der Komplexität der aktuellen Herausforderungen unserer Zeit. Dafür soll dieses Buch eine Diskussionsgrundlage bieten. Ich nehme bewusst in Kauf, dass ich aufgrund der Inhalte dieses Buches, das es wagt, die alten Manifeste, Glaubensmuster und deren Strukturen infrage zu stellen, schnell diskreditiert werden kann. Wozu haben wir ein Gewissen, an dessen Stimme uns mehr gelegen sein muss als an dem Beifall der anderen? Ich versuche darauf eine Antwort zu geben, was jeden von uns zum UMDENKEN bewegen sollte, um die komplexen Herausforderungen anzunehmen und Wohlstand in diesem Leben so gut wie möglich zu gestalten. Ich will nicht Missstände kritisieren, sondern positive Visionen aufzeigen, die Zuversicht schenken. Nicht die Bedingungen in der Welt diktieren unser Leben, sondern die Entscheidungen, die wir treffen.
In welcher Welt leben wir?
Kollektiv und Individuum
In der Bibel steht, „es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.“ Dieses Urprinzip strebt nach Stabilität und Sicherheit. Solange es Menschen gibt, solange leben sie in Gemeinschaften zusammen in Ergänzung zum individuellen Lebewesen. Wir sind soziale Wesen und wollen integriert und nachhaltig eingebunden sein in unser soziales Umfeld, in Lebens- und Hilfsgemeinschaften, die sich in einem Kollektiv zusammenfinden. Menschen sind auf Kooperation angewiesen und können sich nicht nur isoliert voneinander verhalten. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe scheint diese Sicherheit und Geborgenheit in einer Umgebung zu bieten, in der wir Unterstützung und Gleichgesinnte finden, die unsere gemeinsamen Interessen schützen sollen.
In der Soziologie verstehen wir Gemeinschaft als soziale Gruppe wie Familie, Kirche, Partei, Gewerkschaft, Verein, Unternehmen und heutzutage die Einbindung in Social Media. Diese Menschen verbindet ein Wirgefühl, manchmal über mehrere Generationen hinweg. Fürsorgliches Engagement, in welcher Form auch immer, stärkt das Zugehörigkeitsgefühl und ist ein tief verwurzeltes Bedürfnis. Wenn wir im Laufe der Zeit eine Bindung an eine Gruppe entwickeln, kann diese Halt geben und zu einer neuen Ersatz-Familie werden. Sie ist eine Form der sozialen Selbstorganisation, die für die Mitglieder entscheidende Vorteile hat: Sie spart Kräfte, bietet Sicherheit und soziale Schutz- und Stützkräfte.
Menschen organisierten sich zunächst in Familien und Familienverbänden. Diese waren die Überlebensstrukturen alter Gesellschaften. Die Familie, die Sippe, der Landstrich mit festen Sitten und Traditionen, dort wird man hineingeboren, übernimmt Lebensmuster und Rollenbilder. Sie steht für die verbindende Kraft der Gesellschaft, die zur Familie wird. Früher erfüllte dieses essenzielle Bedürfnis eben die gewachsene Großfamilie als Urzelle der Gesellschaft.
Die Familie als Naturgesetz ist Ausdruck des Schöpfungswillens. Sie ist der erste Ort, wo Entwicklung stattfindet oder eben nicht. Was Eltern verbindet, ist ihre Liebe zur Familie, ihr Interesse an der Familie und am Zusammenhalt in ihr. Sofern die Bedeutung der Familie verstanden wird und wenn die Elemente des Zusammenhalts - die "Schalter" und "Stellschrauben" der Familie - richtig bedient werden, sorgt sie für ein positives Umfeld, Sicherheit, Schutz, Gesundheit, Stabilität, Ausbildung und lehrt die Lebensgesetze. Die Familie ist die Gemeinschaft, die das Urvertrauen vermittelt, in der man von Kind auf lernen kann, seine Freiheit richtig zu gebrauchen. Die Familie ist gleichermaßen eine Lernstube für den Frieden. Bedingungen, die für Familien segensreich sind, fördern Harmonie und stärken den Frieden zu Hause und in der Welt.
Erst die Gemeinschaft macht es möglich, sich als Individuum zu entfalten. Es gibt unzählige empirische Ergebnisse, die die essenzielle Bedeutung von gesellschaftlichen Bindungen für eine gesunde Entwicklung beweisen – vom Mutterleib bis ins hohe Alter. Soziale Beziehungen, die wir unterhalten, nehmen Einfluss auf unsere Biologie bis hinein in unsere Körperzellen. Man kann sehen, dass weniger sozial integrierte Menschen seelisch als auch körperlich öfter und schwerer erkranken und eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, früher zu versterben. Dagegen fördert das soziale Eingebundensein die Gesundheit. Ob Partnerschaft, die Familie, auch der Arbeitsplatz oder der Sportverein, soziale Beziehungen sind das Gesundheitselixier schlechthin.
Schon immer spielte die Familie eine zentrale Rolle im gutbürgerlichen Leben: Als Gegenpol zu Wirtschaft und Politik sollte die Familie eine Gegen- und Komplementärwelt bilden, einen Ruhehafen im rastlosen Getriebe der bürgerlichen Leistungsgesellschaft. Die Familie ist die Urzelle des gesellschaftlichen Lebens. Sie soll uns den Weg zu einer Gesellschaftsform weisen, die meiner biologischen Herkunft entspricht und mich das leben lässt, was ich wirklich will, was mich erfüllt und glücklich macht. Deshalb gehen wir Beziehungen und Bindungen ein. Wir suchen neue soziale Kontakte und es liegt in unserer Natur, sich einzufügen in Organisationen, Vereinen, Kirchen, Firmen, Kommunen, Fakultäten und vielem mehr, um mit unseren Fähigkeiten die Welt aktiv mitzugestalten. Durch behutsame Annäherung und offene Begegnung, ohne Zwang und Machtmotive entsteht Übereinstimmung und altruistisches Verhalten. Ich bin jemand, weil du bist, meint die tiefe Gemeinschaft zwischen den Menschen.
Wir sind nur innerhalb einer Gemeinschaft, der wir uns zugehörig fühlen, in der wir uns geborgen und sicher fühlen, in der Lage, die in uns angelegten kreativen Potenziale zu entfalten. So erklärt sich auch die Überlebensfähigkeit von Brauchtum und Volksglauben, immer wiederkehrenden Bierfesten, Sommer-Events, Faschingsveranstaltungen und TV-Shows. Die Qualität der Gemeinschaft wird im Miteinander gelebt, Lebensfreude wird geteilt und das Engagement des Menschen wird respektiert. Echte Gemeinschaft lässt individuellen Gestaltungsspielraum für Vielfalt zu, will Kooperation fördern und ist konstruktiv. Einheit in der Verschiedenheit ist authentisch und ehrlich. Das Individuum und die Gruppe sind kein Gegensatz. Der Kontakt in der Gemeinschaft und unsere gegenseitige Abhängigkeit macht uns reifer. Es braucht zwar die kollektive Identität der Gemeinschaft, doch erst die Gemeinschaft bereitet den Boden, auf dem sich das Individuum entfalten kann! Auf sich allein gestellt, entwickelt der Mensch kaum eine Identität. Wir brauchen die Gesellschaft, um unser Selbst zu entwickeln.
Erst dadurch, dass wir uns im Austausch mit anderen ständig positionieren müssen, können wir ein ICH herausarbeiten. „Wir brauchen einander, um überhaupt jemand zu sein“, sagt der Philosoph Bernard Williams. Gerade die demokratische, freie Gesellschaft ist es, die uns die Suche nach dem authentischen Ich, das nicht von blindem Herdentrieb bestimmt ist, erst möglich macht. Sie ist darauf angewiesen, dass Menschen versuchen, ihre eigenen Werte zu erkennen und zu vertreten – gerade auch dann, wenn sie von der vorherrschenden Meinung abweichen.
Unser Streben wird heute jedoch weniger von schichtspezifischen Kriterien geprägt als von Lebensstil-Gemeinsamkeiten. Das bedeutet nicht die Loslösung des Einzelnen aus der Gesellschaft und ihren sozialen Bindungen, sondern eine Stärkung der Gesellschaft in all ihren Unterschiedlichkeiten. Den Menschen in den westlichen Gesellschaften geht es immer weniger darum, nur sozialen Status zu erreichen, sondern sie wollen sich auch als Individuum entfalten. In dem Bewusstsein, einzigartig und individuell zu sein, sind sie auf der Suche nach sich selbst.
Solange mir der Stellenwert einer Gemeinschaft etwas wert ist, bestimmt dieses individuelle Verhalten wesentlich die Strukturierung einer Gesellschaft mit. Will ich allerdings in eine Gruppe aufgenommen werden, dann muss ich mich ihrem Verhalten anpassen. Ich werde es schwer haben, meine Individualität zu leben, was immer wieder Reibung erzeugen kann im Gefüge sozialer Normen von Moral und Konvention.
Nur wenn Individuen von ihren Maximalforderungen abweichen und andere als gleichberechtigt anerkennen, kann die Zugehörigkeit zur Gesellschaft als Ganzes gelingen. Es ist nötig, dass wir ähnlich sind, um miteinander leben zu können und dennoch brauchen wir unsere Unterschiedlichkeit, um uns selbst zu finden.
Es geht hier nicht um ein gleichförmiges Kollektiv, sondern um das Kollektiv als Korrektiv im positiven Sinne, um gemeinsame Ziele und Interessen, die das Gefühl der Verbundenheit stärken, um echte Gemeinschaft, der wir uns alle zugehörig fühlen, weil wir teilhaben. Sie ist kein Gegensatz zur individuellen Freiheit. Nur durch seine Teilhabe am Ganzen, das mehr ist als die Summe seiner Teile, kann der einzelne Mensch über sich hinauswachsen.
Fühlen wir uns als Einzelner eher schwach, so können wir in einer Gesellschaft einen stärkeren Selbstwert entwickeln und uns als Gruppe mächtig und stark erleben, ohne das Risiko eines Verlustes einzugehen. Nehmen wir als Beispiel die Sozialpartnerschaft zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern: Zu hohe Tarifabschlüsse schädigen die Wirtschaft, während zu geringe Lohnerhöhungen den sozialen Frieden gefährden können. Einseitiges Vorgehen wäre unnütz, weil das, was geschehen soll, nur durch beide zustande kommen kann. Die eine Seite muss genauso viel von der anderen Seite bekommen, wie sie der anderen gibt. So ermöglicht kommunale Intelligenz im perfekten Zusammenspiel der Kräfte Erfolge, die dem Einzelnen nicht möglich wären und am Ende allen nützt - was nur mit Empathie und einem Vertrauensvorschuss möglich ist. Eine Gesellschaft, die das individuelle Bedürfnis als zweitrangig betrachtet, kann im anarchistischen Chaos unter Machtstrukturen enden, die wir alle nicht wollen.
Wie widerstands- und regenerationsfähig sind Lebensgemeinschaften und ganze Gesellschaften, um in komplexen und zunehmend turbulenten Zeiten mit ihren Belastungen umzugehen?
Diejenigen, die sich selbst vertrauen und genau wissen, wie gut sie ihre Aufgabe erfüllen, haben es nicht nötig, dass man ihnen auf ihrem Gebiet viel Bestätigung gibt. Wir brauchen soziale Kompetenz, um entsprechend den Bedürfnissen der Beteiligten im positiven Sinne zu agieren. Denken und Handeln dürfen nicht nur von nüchternen Überlegungen bestimmt sein, sondern vielmehr von gefühlsmäßigen Empfindungen. Soziale Intelligenz und Vielfalt können besonders in Krisenzeiten hilfreich sein, sie fördern Stabilität (Resilienz), d. h. eine gewisse Belastbarkeit und bestimmte Fähigkeiten, um unvorhersehbare Krisen zu meistern.
Eine Vielzahl von Menschen mit einer Vielzahl an Potenzial, mit Durchsetzungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit kann Fakten schaffen und die Gesellschaft in eine neue sinnvolle Richtung führen. Wir können uns mit unseren unterschiedlichen Möglichkeiten in Gemeinschaften mit vielen Individuen organisieren, die einerseits einander sehr ähnlich und andererseits Einzelpersönlichkeiten mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften sind. Wenn Gemeinschaften Stressoren ausgesetzt sind, zeigen Gemeinschaften, die aus einer Vielfalt mit sehr unterschiedlichen Individuen zusammengesetzt sind, dass sie mit Herausforderungen wesentlich besser umgehen können. Unterschiede können zwar Reibung und Konflikte erzeugen, können aber als Katalysator für gemeinsame Entwicklung dienen.
Eine lebendige Gesellschaft ist auf das Eigene, das Unverwechselbare ihrer Mitglieder angewiesen. Diese Vielfalt ist anstrengend, aber sie kann auch eine große Bereicherung sein. Je unterschiedlicher die Eigenschaften der Mitglieder einer Gruppe sind, desto wertvoller werden sie für die Gemeinschaft in ihrer Komplementarität. Kollektive Identität baut auf den Wunsch nach Individualität und Unabhängigkeit. Ist ihre Einzigartigkeit – und das Gefühl der bedingungslosen Zugehörigkeit zur Gemeinschaft gewährleistet, können wir erwarten, dass der kooperative Umgang an Bedeutung gewinnt und sich damit auch die Bereitschaft zum Miteinander steigert. Es ist ein dynamischer Anpassungsprozess, in dem in einer Art Selbstorganisation neue Stärken und Kompetenzen entwickelt werden, um damit einer veränderten Zukunft flexibel begegnen zu können. Ob prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Existenzangst oder Armut - dem Gefühl des Ausgeliefertseins setzen diese Menschen ihre Fähigkeit entgegen, Gegenwart und Zukunft zu gestalten.
Diese Gemeinschaft konzentriert sich nicht auf Probleme, sondern vielmehr auf realistische Lösungen. Jeder hat eine gewisse Verantwortung, die der eigenen Fähigkeit entspricht. Unter schwierigen Bedingungen beeinflussen und fördern sich somit Individuen jeder Art gegenseitig und sichern ihr Überleben. Werden gewisse Schwellenwerte der Dynamik und der Tragfähigkeit überschritten, schöpfen sie die Kraft für ihre Neuorientierung aus ihrer Diversität. Das Unverwechselbare ihrer Mitglieder macht die Gesellschaft reifer, mit Herausforderungen umzugehen und neue Einsichten zu gewinnen. Es ist erstaunlich, besonders in Notsituationen, in denen Menschen ehrlich aufeinander angewiesen sind, werden konstruktive Gemeinschaftserfahrungen gemacht. Dahinter steht die optimistische Grund-Annahme, in den anderen nicht nur Gefahr oder Konkurrenz zu sehen, sondern im Bemühen um Abstimmung miteinander zusammenzuwirken. Wie in einem Orchester spielt jeder sein eigenes Instrument mit seinem individuellen Klang, erst im perfekten Zusammenspiel ergibt sich ein Klangbild von großartiger Wirkung.
Unterschiedliche Mitglieder einer Gemeinschaft mit unterschiedlichen Eigenschaften sind in ihrer Buntheit sehr wertvoll. Das besondere Potenzial des Einzelnen ist immer wichtig für das Kollektiv, weil das Kollektiv von der Vielfalt profitieren und an Bedeutung gewinnen kann. Aus welcher Perspektive wir die Schöpfung auch betrachten, alles entstand aus einer Quelle, aus der sich Vielfalt und Diversität des Universums entwickelte. So gesehen ist die Vielfalt ein natürliches Phänomen der Entfaltung der Einheit in die Vielfalt. Somit ist auch die Tendenz, innerhalb der Vielfalt die Einzigartigkeit zu suchen, ein natürliches Phänomen. Das Individuum ist ein Abbild des Kollektivs, die beide untrennbar miteinander verbunden sind.
Wir Menschen sind widersprüchliche Wesen. Wir leben in dem Spannungsfeld, Teil des Kollektivs zu sein und der Faszination immer wieder aus der Reihe ausscheren zu wollen. Dieses Wechselspiel ist ein Grundmerkmal des Lebendigen und des Sozialen.
Wir sind gleichermaßen Gruppenwesen und Individuen, die ihre Eigenständigkeit suchen. Wir spüren eine innere Lust, in unserem gesellschaftlichen Kontext nicht so angepasst zu sein und ebenso wenig wollen wir unsere Autonomie verlieren, untergehen in der Masse, wenn wir nicht zur Kenntnis genommen werden und keine Anerkennung finden. Man sollte nicht in Gemeinschaft mit anderen sein, weil man sie braucht, sondern weil man sie will. Jeder Mensch, der mir begegnet, kann für meine Entwicklung gewinnbringend sein.
Wie viele Herdentiere verträgt das Kollektiv?
Innerhalb eines jeden größeren Zivilisationskreises, also innerhalb eines Landes, einer Gesellschaft und Kultur, sind sämtliche zwischenmenschliche und verhaltenstechnische Orientierungspunkte durch ihre Beständigkeit geprägt. Soziale Umstände, Systeme, in denen wir leben, die Situationen, in denen wir uns befinden, haben Einfluss darauf, wie wir uns verhalten. Liegt der Selbstwert am Boden, bietet die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, unabhängig von der Lebensqualität, die sie mit sich bringt, ein gewisses Maß an Sicherheit und dient der Stabilisierung der eigenen Person, denn der Mensch ist evolutionsgeschichtlich darauf konditioniert, in kleinen Gemeinschaften zu leben und deren Interessen zu verteidigen: Je einflussreicher die Interessensgruppe, desto größer die Durchsetzungskraft! Dieses Sozialverhalten von Menschen findet dort statt, wo es ursprünglich in bestimmten Situationen Sinn gemacht hat, uns jetzt aber in Gefahr bringen kann, wenn wir unreflektiert der Masse folgen. Wir geben einen Teil unserer individuellen Freiheit auf. Wir werden abhängig von einer Gesellschaft und deren Sicherheitsmechanismen, die uns vorgibt, unser Überleben zu sichern. Es ist eine Sicherheit, die sich darin zeigt, dass sich nichts grundlegend für jeden verändert, solange man mitspielt. Je unsicherer und ängstlicher wir sind, desto leichter lassen wir uns überreden oder gar zu Marionetten machen. Wir laufen Gefahr zu Objekten, zur willenlosen Masse zu werden. Dieses auch Herdentrieb genannte Verhalten wohnt tief in uns. Staat, Gewerkschaften, Versicherungen und Institutionen gewinnen damit an Einfluss und üben Macht über uns aus.
Was den Drang in der Gruppe anbelangt, unterscheiden wir uns nur wenig von den Tieren. Wissenschaftler der Leeds University bringen dies klar auf den Punkt: Es braucht im Schnitt nur 5 % einer Menge, die den Weg vorgeben, um die Menge zu steuern. Es braucht die Kraft einer Idee und die daraus erwachsende kritische Masse. Die restlichen 95 % der Menschen folgen brav wie Herdentiere den Versprechungen einer kleinen Gruppe von charismatischen Alpha-Tieren (Leithammeln) und hoffen, dass schon alles irgendwie gut gehen wird, weil selbst denken viel zu anstrengend ist. Wir geben unsere Autonomie an andere ab und tun das, was andere von uns wollen. Wir reden und handeln, wie es andere von uns erwarten oder wie wir es zu glauben meinen, dass sie es von uns erwarten.
Unsere gesellschaftlichen Strukturen zielen auf Gehorsam ab. Damit die Gesellschaft funktioniert, will sie den Menschen „brauchbar“ machen. Über Jahrhunderte hat sie den Menschen immer mehr uninformiert und in Schablonen gepresst, die den Nährboden für eingeschränktes Denken bilden. Wir werden darauf gedrillt, gut zu funktionieren und für das System zuverlässig zu sein. Versucht man doch an den Säulen des Systems zu sägen, macht man sich automatisch zum Feind aller anderen Menschen, welche sich von der Sicherheit, die auf dessen Beständigkeit beruht, abhängig machen. Sich von solch einer fragwürdigen Sicherheit abhängig zu machen, egal welch schlechte oder gute Qualität sie auch bieten mag, ist das Ergebnis einer erfolgreichen Konditionierung zum blinden Gehorsam. Deshalb sollte man nicht die Gemeinschaft mit anderen suchen, weil man sie braucht, sondern weil man sie will. Es gibt also gute Gründe, uns mit diesen wichtigen Dingen auseinanderzusetzen, um aus angepasstem Verhalten angemessenes Verhalten zu entwickeln, denn ein zu viel löst das ICH auf! Je angepasster wir im Leben werden, umso weniger Mut haben wir für Neues. Was muten wir uns selbst zu?
Das Festhalten an Regeln und Prinzipien scheint als Angstschutz zu dienen. Mangelnde Selbstbehauptung scheint hier ein motivierendes Verhalten zu sein. Ein Stück weit ist die Angst vor Ausgrenzung und alternativ die Orientierung an den gesellschaftlichen Konventionen in unseren Genen verankert. Schließlich war das Überleben außerhalb einer sozialen Gruppe zu Zeiten der Jäger und Sammler äußerst schwierig bis unmöglich. Wer ausgestoßen wurde, war zum Tode verurteilt. Der Verlust der Individualität wurde dabei als befreiend gesehen, da der Einzelne nicht mehr allein der fremden, bedrohlichen Welt gegenüberstand.
Zwar sind diese Gepflogenheiten längst Vergangenheit, doch tragen wir den Wunsch nach Akzeptanz in unserem sozialen Umfeld immer noch tief in uns. An sich ist das eine gute Sache, sonst würden wir in einer traurigen, einsamen und emotional kalten Welt leben. Dennoch hat sie einen Haken: Je mehr sich eine Person als abhängig erlebt, umso stärker lastet auf ihr der Druck, sich Erwartungen und Wünschen der jeweiligen Autorität anzupassen und zu dem zu werden, was in ihr gesehen wird. Das Kollektiv wirkt so als Korrektiv im negativen Sinn: Das, was auf der einen Seite Geborgenheit schafft, droht auf der anderen Seite den Menschen zu schaden. Das Kollektiv will uns einerseits soziale Sicherheit vermitteln und andererseits unseren individuellen Entfaltungsspielraum einschränken.
Unsere sozialen Systeme neigen dazu, das Individuum argwöhnisch zu betrachten und halten es für notwendig, Einfalt, Anpassung und Konformismus als wichtige gesellschaftliche Eigenschaften zu werten. Verhaltensvorschriften und Erwartungen werden für alle Individuen mehr oder weniger verbindlich. Hier liegen die Ursachen für Machtausübung, Kontrollwahn, Unterwerfung, Hass und Gewalt begraben. Statt Individualisierung, Verantwortungsbewusstsein und Ausbildung individueller Fähigkeiten stehen der Zwang zur Zuordnung, Uniformierung, Gleichmacherei und mediale Abhängigkeit im Vordergrund. Als Eltern ignorieren wir die natürlichen spezifischen Ansprüche der Kinder und erwarten oder fordern von ihnen zu gehorchen, künstliche Werte zu beanspruchen und wie wir es selbst auch tun, Ideologien zu folgen und uns anzupassen. Als Kind hat man mit einem noch nicht so weit entwickelten Intellekt und einer geringeren Reife kaum eine Chance, das zu reflektieren. Jugendliche und Erwachsene befolgen Normen, die in ihrer Gruppe vorherrschen. Man handelt so, weil es alle so machen. Man will damit Gewissensbissen entgehen und sozial akzeptiert werden. Wir streben ersatzbefriedigende Verhaltensweisen oder Veränderungen an uns selbst oder unserem Umfeld an, was zu einer fatalen Entwicklung führen kann. Wir nehmen Drogen und trinken Alkohol, um Gefühle von Wut und Hoffnungslosigkeit abzutöten und uns lebendig zu fühlen.
1984 beschreibt in visionärer Weitsicht den Versuch der Gleichschaltung aller Menschen, um die Selbstbestimmung durch Manipulation auf ein existenzielles Mindestmaß zurückzudrängen. Damit verkommt der Mensch zum willenlosen Herdenvieh und ist beliebig steuerbar für die Interessen von einigen wenigen, die die Macht in Händen halten und die gewissenlose Ausbeutung aller Ressourcen im Sinne haben und damit eine Entwicklung zum Wohle aller Menschen unmöglich machen wollen, wie:
→ Herdenvieh durch Gleichschaltung:
Beschränkung der Redezeit im Bundestag für „Abweichler“. Das Recht, sich zu äußern und einen anderen Standpunkt darzulegen und die Redezeit sollen per Gesetz eingeschränkt werden.
→ Herdenvieh durch Gleichschaltung:
Im Gesundheitsministerium wird eine Gesetzesänderung erwogen, die alle als psychisch krank einstuft, die über längere Zeit gegen die autoritäre Staatsgewalt rebellieren und sich in unverbesserlicher Weise wiederholt den vorgegebenen „Normen“ widersetzen.
→ Herdenvieh durch Gleichschaltung:
Überwachung von Mitarbeitern ohne ihr Wissen bei großen Konzernketten. Werden die zum Teil übertriebenen und unausgesprochen entmündigenden Vorschriften der Konzernführung nicht erfüllt (übertrieben genaue Ordnung im privaten und betrieblichen Bereich der Mitarbeiterinnen und Überstunden, die als selbstverständlich angesehen und eingefordert werden), erfolgen permanent Abmahnungen, um im Falle des nicht „Konformgehens“ mit der Strategie der Konzernleitung eine sofortige Kündigung aussprechen zu können.
Die Herausforderung, der sich ein Individuum in einer Gesellschaft stellen muss, ist eine Antenne dafür zu haben: 'Wann ist das, was ich tue, nicht mehr mit meinen persönlichen moralischen Maßstäben vereinbar? Wie weit lasse ich mich ein? Der Energieaufwand, gegen das System zu handeln, ist hoch. Selbstbehauptung ist anstrengend, denn die Position eines Individuums will erkämpft und verteidigt werden. So schwer es ist, gegen den Strom zu schwimmen, so notwendig ist es für unser persönliches Wachstum.
Fragen Sie sich deshalb auch: Wo und wann folgen Sie selbst wie ein Schaf in der Herde irgendwelchen dubiosen kollektiven Führern? Ist es eine Rebellion gegen die Einsicht, uns selbst besser kennenzulernen? Bin ich nur dann normal, wenn mein Verhalten der Mehrheit entspricht? Wie gut habe ich als aufmerksamer, wacher und autonomer Bürger gelernt, mich abzugrenzen? Wann ist der Punkt, an dem ich nicht mehr folgen sollte? Nur weil alle nach der Pfeife tanzen, heißt das noch lange nicht, dass da auch die richtige Melodie für mich selbst gespielt wird.
Es kann mühsam werden, unsere Angst zu überwinden und gegen diese kollektive Haltung anzukämpfen und selbstbewusst unser Potenzial leben zu wollen. Wir leben in einer Zeit der Prüfung, in der wir uns zeigen müssen, ob wir offen und stark sind, um einander zu stützen und zu unterstützen. Jeder ist aufgerufen, das für die Gesellschaft zu tun, was er in seiner sozialen Umgebung tun kann. Dadurch können wir verhindern, dass jemand im mörderischen kapitalistischen Existenzkampf unter die Räder kommt. Armut und das Gefühl, abgehängt zu sein, sind in unserer Wohlstandsgesellschaft mehr denn je ein Thema, auch wenn es nicht gerne angesprochen wird! Es ist in unserer Berufswelt heutzutage viel schneller möglich geworden, unterzugehen und sozial abzustürzen. Der ökonomische Abstand zwischen Arm und Reich war noch nie so groß. Billiglohnsektor, Zeitarbeitsverträge oder 450 Euro Jobs sind lediglich Stichworte, die zeigen, dass die Probleme in unserer Gesellschaft nicht weniger geworden sind, sie sehen nur anders aus. Wer in solchen prekären Arbeitsverhältnissen steht, wird sich entscheiden müssen zwischen Konformität und (stiller) Rebellion.
Die Politik duckt sich seit Jahren weg vor den Sorgen und Nöten derjenigen, die nicht dergestalt organisiert sind, aber einen großen Teil der Lasten schultern. Klinikkonzerne wollen trotz überaus belastender Situationen Pflegern, Schwestern, Therapeuten sowie Reinigungs- und Kantinenpersonal keine angemessene Bezahlung und adäquate Arbeitsbedingungen bieten. Was in diesen turbulenten Zeiten wohl das Mindeste wäre, muss in Streiks und zähen Verhandlungen errungen werden. Applaus allein oder eine einmalige Bonuszahlung hilft den in medizinischen Berufen Beschäftigten kaum weiter. Das Geld, das wir für Pflegekräfte, Schulen und Kitas, für Renten, Kindergeld und umweltfreundliche Technologien so dringend benötigen, wird lieber für ein neues Wettrüsten verpulvert. Was uns hier in den nächsten Jahren in den Bereichen persönlicher Grundsicherung und öffentlicher Daseinsvorsorge erwartet, gibt Anlass zu großer Sorge. Es wird so kommen, weil es so kommen muss, um ein Erwachen und eine grundlegende Änderung unserer kaputten Systeme zu ermöglichen.
Wir dürfen niemanden zurücklassen und müssen füreinander einstehen! Wir benötigen das Schutzversprechen der Solidargemeinschaft, die den Lebensstandard im Alter oder bei Krankheit und Arbeitslosigkeit absichert. Dafür braucht es ein Fürsorgegehalt mit allen Sozialleistungen, damit Care-Arbeit endlich als Arbeit anerkannt und entlohnt wird. Die Konzepte liegen längst auf dem Tisch: Grundgehälter müssen deutlich erhöht werden, Personalschlüssel für alle Berufsgruppen im Gesundheitswesen müssen sich am tatsächlichen Bedarf orientieren, allgemein verbindliche Flächentarifverträge, Fallpauschalen abgeschafft werden, – um nur einige zu nennen. Der Niedriglohnsektor muss ausgetrocknet werden, Schluss mit Leihsklaverei, Hartz IV und Mini-Löhnen! Wir brauchen starke Tarifverträge, einen echten Mindestlohn, der vor Altersarmut schützt und eine Steuer auf Mega-Vermögen! Die Umverteilung von unten nach oben in den letzten Jahren muss beendet werden. Das ist Not-wendig!
Im Zusammenhalt, im Miteinander und Teilen sind wir als Menschheitsfamilie groß geworden. Ein Einstehen für Veränderung ist mehr denn je angesagt – zugunsten aller, egal welche Position sie im Gesellschaftswesen einnehmen. Wir müssen diese ständigen Gewinnund Verlust-Rechnungen über den Haufen werfen. Wohnungen, Krankenhäuser und Pflegeheime gehören nicht in die Hände von Renditejägern - Profite pflegen keine Menschen! Sind Investmentbanker wertvoller als eine Pflegekraft, die schwerkranke Menschen rund um die Uhr betreut? Wie blind droht Profitsucht ohne Wertschätzung zu werden!
Gleichzeitig predigen selbstherrliche gierige Politiker Verzicht und missbrauchen die anvertraute Macht zum eigenen Vorteil. Seit 2005 sind die Bundestagsdiäten inflationsbereinigt um zehn Prozent gestiegen, aber die Hartz-IV-Regelsätze dagegen sogar um 0,4 Prozent gesunken. Wer in einem noblen Viertel in einer top-renovierten Altbauwohnung wohnt, mag die Verteuerung von Diesel und Heizöl für eine klimapolitische Großtat halten. Den weniger begünstigten Facharbeiter oder Handwerker in einer ländlichen Region, der jeden Tag auf sein Auto angewiesen ist und sein mäßig isoliertes Haus mit Öl heizt, trifft das hart.
Die wachsende Ungleichheit lässt sich auch in der globalen Vermögensverteilung ablesen: Ende 2020 besaß das reichste 1 Prozent der Menschheit fast die Hälfte des weltweiten Vermögens. Die andere Hälfte teilt sich der Rest der Weltbevölkerung. Setzt sich die derzeitige Entwicklung der Ungleichheit fort, so wird im Jahr 2050 allein das reichste 0,1 Prozent der Menschheit ein größeres Vermögen besitzen als die gesamte globale Mittelschicht, denn die reichsten der Reichen zahlen weniger als 1 % Prozent Steuern. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass das kapitalistische Gesellschaftssystem in dieser Form skandalös ungerecht ist. Es verspricht eine bessere Zukunft, an der immer die Gleichen ihren Vorteil daraus ziehen. Gewinne werden privatisiert, Verluste sozialisiert. Die „soziale“ Marktwirtschaft ist längst eine Metapher. Es gibt keinen wirklichen Freien Markt. Unser Markt ist durch menschliches Eingreifen mit Gesetzen und Regeln höchst strukturiert, immer zum Vorteil mancher und zum Nachteil vieler anderer. So kann der kapitalistische Produktions- und Ausbeutungsprozess reibungslos weiterlaufen. Der Kapitalist versucht, den Mehrwert zu erhöhen, indem er die Kosten reduziert: Er drückt den Arbeitslohn unter den Wert der Arbeitskraft, steigert damit die Arbeitsproduktivität und reduziert die zu zahlenden Arbeitskräfte. Das alles geschieht zulasten des Arbeitnehmers. Insofern ist die Metapher des sozialen Marktes ein Mythos1.
Prof. Dr. Gerald Hüther2:„Was Unternehmen brauchen, um überlebensfähig zu sein, bekommen sie von ihren Mitarbeitern, und nicht für Geld.“ Ihnen gilt nicht nur Respekt in Sonntagsreden. Sie verdienen gute Löhne, sichere Arbeitsplätze und Wertschätzung, dafür gilt es gemeinsam zu kämpfen!
Gegen alle Vernunft haben die bisherigen Bemühungen nicht zu einer Besserung der Verhältnisse geführt, sondern eher dazu, mehr vom Gleichen zu machen: Wer hat, bekommt – wer wenig hat, verliert. Die gleichen schädlichen Praktiken werden mit nur noch größerer Effizienz ausgeführt. Ist Wohlstand für alle eine Illusion?
Ein Großteil der Politik und der Gesetze wird im Interesse einer bessergestellten Minderheit gemacht und nicht für die große Mehrheit der weniger Privilegierten. 85 Prozent der Welt sind privatisiert und nur 15 Prozent gehören der Allgemeinheit. Während Arbeitslosigkeit und Ungleichheit weiter zunehmen und viele kleine und mittelständische Unternehmen um ihre Existenz bangen, nehmen Konzerne rettende Staatsgelder entgegen, um Privatanlegern Dividenden auszuschütten. Das Geldverdienen ohne Arbeit ist der eigentliche Ursprung der massiven ökonomischen und damit auch ökologischen Schieflage in unserer heutigen Welt. Die Privatisierung in verschiedenen Bereichen unseres Gesellschaftssystems hat das deutlich gezeigt. Die New York Times schreibt zum Thema Gesundheitssystem: 84 Prozent der weltweit verabreichten Impfungen wurden in Ländern mit hohem und mittlerem Einkommen verabreicht. Nur 0,3 Prozent der Dosen wurden in Ländern mit niedrigem Einkommen verabreicht.
Auch Deutschland ist ein Ungleichland. Die deutsche Wirtschaftsleistung ist seit 1991 um 40 Prozent gewachsen, der durchschnittliche Bruttolohn aber nur um 16 Prozent. 40 Prozent der Bevölkerung verlieren immer mehr den Anschluss - egal wie sehr sie sich anstrengen. In Deutschland verfügt das reichste 1 Prozent über ein Drittel des Gesamtvermögens, das reichste Zehntel besitzt rund zwei Drittel. Auf die ärmere Hälfte der Bevölkerung entfallen lediglich 1,4 Prozent der Vermögen – sie besitzen fast nichts. Gerade in diesen Zeiten bringt das in zentralen Bereichen persönlicher Grundsicherung und öffentlicher Daseinsvorsorge ernsthafte Auswirkungen auf das soziale Gefüge unserer Gesellschaft mit sich. Eine Lebenseinstellung, die berechnend und kalkuliert ist und nur auf den eigenen Vorteil abzielt, spaltet die Gesellschaft.
Es galt einmal das Ziel, hart arbeitende Menschen vor Armut, Demütigung und Ausbeutung zu schützen, ihnen Bildungschancen und Aufstiegsmöglichkeiten zu eröffnen, ihr Leben einfacher, geordneter und planbarer zu gestalten. Leider vertieft sich die soziale Spaltung zunehmend und Bildungserfolg hängt immer stärker von sozialer Herkunft ab, denn die ständig wachsende Ungleichheit ist in sehr hohem Maße das Ergebnis fehlender Chancengleichheit. Chancengleichheit heißt nicht Gleichmacherei, sondern dass jeder gleichermaßen freien Zugang zu den klassischen Bildungsangeboten bekommt, vor allem jene, die in eine bildungsferne, sozialschwache Familie geboren werden und unterhalb der Armutsgrenze leben. Ist das nicht der Fall, zahlen wir alle den Preis dafür. Je nach Bildungsverlauf kann man schon vorhersagen, wer mit dem Problem der Altersarmut und einer mit ihr einhergehenden deutlich niedrigeren Lebenserwartung von gut 70 Jahren konfrontiert wird. Noch immer verzichten mehr Frauen als Männer für die Familie auf Karrierechancen. Und viele müssen für Niedriglöhne arbeiten. Das führt im Alter zu ungleichen niedrigeren Rentenansprüchen. Ist das sozial und gerecht?
Nach einer aktuellen Studie der Hans-Böckler-Stiftung arbeitet heute jeder fünfte Arbeitnehmer in Deutschland trotz Vollzeitarbeit zu einem Niedriglohn. Das ist ein Skandal, den vor allem die Politik zu verantworten hat: Sie duldet und fördert die Tarifflucht von Unternehmen sowie moderne Formen der Ausbeutung über sachgrundlose Befristungen, Leiharbeit, Werkverträge, Minijobs, die meist kein planbares und sozial abgesichertes Leben ermöglichen. Jedem dritten aktuell in Vollzeit Beschäftigten erwartet aktuell sogar nach 45 Arbeitsjahren nur eine magere Rente von unter 1300 Euro, wie das Bundesarbeitsministerium auf eine Anfrage zugeben musste. Wie soll man damit bei steigenden Preisen über die Runden kommen? Die Gesellschaft darf nicht zulassen, am Ende des Lebens in der Armutsfalle zu enden. Hartz-IV ist eine Demütigung und völlige Verkehrung der Solidarität. Wir erleben Armut und die Ungleichheit der Verteilung von Vermögen und Einkommen als Ausgrenzung aus einer sozialen Gemeinschaft. Sind wir als Hartz-IV-Bezieher in eine Abwärtsspirale geraten, so erfahren wir häufig Ablehnung und Geringschätzung. Solche Kränkungen machen mich wütend, auch wenn ich gar nicht selbst betroffen bin! Arbeitslosigkeit und Altersarmut wird heute in der Hauptsache als vom Individuum selbst verschuldet gesehen. Damit versucht man von den gesellschaftsbedingten strukturellen Verursachungsfaktoren abzulenken: In den letzten Jahrzehnten hat mancherorts die politische Führungskaste wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgaben aus den Augen verloren. Öffentliche Institutionen wie Schulen oder Verkehrsinfrastruktur oder Justizwesen usw. wurden sträflich vernachlässigt. Die Missstände werden verwaltet, statt zu handeln. Zögerliche Maßnahmen der Politik dienen nur zur Symptombekämpfung, statt die Arbeit zu machen, die gemacht werden muss. Parteien verzetteln sich in Halbwahrheiten und verlieren zunehmend ihre Handlungsfähigkeit. In dieser Ignoranz gegenüber den Anliegen der Gemeinschaft werden dringende Sachthemen nicht sachbezogen, sondern parteikonform diskutiert, ohne zu brauchbaren, unverzichtbaren Entscheidungen zum Wohle des Volkes zu gelangen. Die Folgen trägt die Allgemeinheit. So darf es nicht weitergehen!
Die Verantwortungsträger unserer Gesellschaft sind der Ausdruck einer Gesellschaft, die in sich zerrissen ist, – die da oben und die unten. Das „Volk“ ist eher zu einem diffusen Sammelbegriff für alle Menschen geworden, die „unten“ sind und sich ungerecht behandelt fühlen.
Will die Politik wieder mehrheitsfähig werden, dann muss sie sich an den Bedürfnissen und an den Werten der ganz normalen Leute orientieren. Wir brauchen eine Politik, die Geringverdiener und die Mittelschicht entlastet. Die Politik könnte einer extremen Polarisierung entgegenwirken, mit einer ausgewogenen Sozialgesetzgebung und einer Bildungspolitik, die allen gleiche Chancen und Sicherheit bietet und eine offene, diskursfreudige Öffentlichkeit fördert. Soziale Gerechtigkeit muss künftig heißen, eine Politik für jene zu machen, die etwas für die Zukunft unseres Landes tun, die lernen und sich qualifizieren, die arbeiten, die Kinder bekommen und erziehen, die etwas unternehmen und Arbeitsplätze schaffen - kurzum, die Leistung für sich und unsere Gesellschaft erbringen. Um diese Helden unserer Gesellschaft muss sich Politik kümmern. Denn diese sind die wirklichen Leistungsträger in dieser Gesellschaft - und nicht die Multimillionäre und Milliardäre, die sich mit ihrem ererbten Vermögen ein Leben in Saus und Braus gönnen. Dennoch dominieren planwirtschaftliche Gruppierungen, die ausschließlich um die eigenen Ressourcenversorgung kämpfen. Deren Luxuskonsum wie auch den Aufrüstungswahnsinn dürfen wir uns nicht mehr leisten, wenn wir unseren Planeten nicht ruinieren wollen. Politik in einer Demokratie ist Politik für Millionen Menschen, nicht für wenige Millionäre!
Und wir? Wir haben uns aktuell in einer Art Zuschauerdemokratie zurückgelehnt: Die da oben sollen mal tun … Wir suchen nach Rechtfertigungen wie: Das System können wir nicht ändern. Als einzelner bin ich nicht schuld an den ungerechten Zuständen in der Welt. Die da oben sind verantwortlich. Wir schieben den schwarzen Peter von uns. Der Ruf nach Führung und Autoritäten ist eher ein Zeichen von Bequemlichkeit. Wir versuchen Verantwortung zu delegieren. Wir müssen uns nicht wundern, wenn unsere „Leitfiguren“ diese Spaltung noch vertiefen. Wann wird uns klar, dass unser eigenes Verhalten zum Verhalten der Gesellschaft beiträgt?
Ja, eine Gesellschaft braucht Führung und lebt unter anderem davon, dass sie sich an Leitfiguren orientiert und ihnen folgt. Es wird ihnen eine Begabung zugeschrieben, die sie in emotional aufgeladenen Situationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein lässt und die richtigen Worte finden lässt, um die hochemotionalen Erwartungen zu bedienen. Nur allzu leichtfertig idealisieren wir wichtige Bezugspersonen mit Charisma und glauben an ihre Fähigkeiten, außergewöhnliche Ausnahmesituationen zu lösen. Die Sache, für die eine charismatische Persönlichkeit eintritt, muss jedoch nicht zwangsläufig moralisch „gut“ oder „richtig“ sein; sie kann sich genauso als „schlecht“ oder „böse“ erweisen. Gefährlich wird es dann, wenn wir uns charismatischen Autoritäten unterwerfen, die geltende Normen und Regeln brechen und ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Wie geleitet und regiert wird, steht oft in einem harten Kontrast zu der Art, was sie vorgeben zu tun. Das ist ein Angriff auf die Demokratie. Verantwortungsträger bereichern sich an Steuergeldern, andere verbreiten alternative Fakten und wieder andere versuchen sich mithilfe von Lobbyisten für ein hohes Amt zu empfehlen. Wenn Leitfiguren nur noch auf ihren eigenen Vorteil achten und schamlos die anderen sich selbst überlassen, so wird Vertrauen zerstört. Das Fundament einer Gesellschaft zerbricht. Ist unsere Gesellschaft als Gemeinschaft an sich nur eine Illusion?
Wo ist mein Platz in der Gesellschaft?
Selbstwert und Gefühlsambivalenzen
Der Mensch ist eine multiple Persönlichkeit und diese innere Vielfalt gilt es als Emanzipation des Individuums vom Kollektiv zu leben mit Selbstbewusstsein, Selbstachtung und Souveränität. Wir sind ausgestattet mit den Fähigkeiten und der Freiheit, unser Leben selbst zu gestalten, wobei selbst nicht allein bedeutet, sondern auch als Gemeinschaft. In der Rückverbindung mit unseren Gaben, unserem ureigenen Ausdruck und unserem Beitrag zu der Gemeinschaft, in der wir leben, erlangen wir Wohlstand. Wir haben eine natürliche Anlage, die uns zeigt, wo im Leben unser Platz ist. Ich bin mir meiner Stärken und Schwächen (selbst-)bewusst. Ich mache etwas, was mich ausmacht, was einfach in mir ist. Wir sind in unseren Herzen Schöpferinnen und Schöpfer. Auch wenn es mir belanglos vorkommt, ich gebe dem Raum in mir, wozu ich einen Bezug habe. Das Leben zu gestalten, etwas zu erschaffen, ist ein Grundbedürfnis. Es gehört zu einem erfüllten Leben dazu - egal, was es ist. Wir leiden, wenn wir in unserem Alltag mangelnde Gestaltungskraft haben und nur selten in Berührung mit unserer natürlichen Kreativität und Lebensfreude kommen.
In jeder Gesellschaftsform, ob sie kollektivistisch autoritär organisiert ist, wie zum Beispiel in China oder individualistisch wie in den USA, gibt es Menschen mit einem ausgeprägt guten Selbstbewusstsein und Menschen mit Selbstwertproblemen.
Der Ursprung für die meisten Probleme sind elterliche Erziehungseinflüsse und die Umwelt. Moderne Psychoanalytiker gehen heute davon aus, dass wir prägende Bindungserfahrungen gemacht haben, wie unsere Intentionen und Wünsche von unseren Ängsten als Baby und Kleinkind erkannt und aufgenommen worden sind. Eine zentrale Rolle spielt hier das Urvertrauen. Es kann lediglich ausgebildet werden, wenn die Interaktion zwischen den Bedürfnissen des Säuglings und der Fähigkeit der Mutter, diese wahrzunehmen, zustande kommt. All diejenigen, die fest davon überzeugt sind, dass sie liebenswert sind und sich selbst vertrauen, haben es nicht nötig, dass man ihnen viel Bestätigung gibt. Nur so können sich Kinder ohne Angst und Schuldgefühle entwickeln und sich später von der Mutter lösen, um ihre Autonomie zu erlangen. Wir orientieren uns an den gesellschaftlichen Konventionen von Eltern, Verwandten, Freunden, Lehrern, Ausbildern oder auch Medien. Solange wir noch klein sind, glauben wir alles, was uns erzählt wird. Doch nach und nach machen wir uns immer mehr eigene Gedanken. Wir zweifeln plötzlich an, was Eltern und einige Lehrer behaupten, und beginnen zu widersprechen. Bleiben wir weitgehend unabhängig von der oft einschränkenden Meinung anderer, haben wir die größte Chance, unsere wahre Identität zu finden oder unsere Berufung auszuleben. Die Rolle der Bindung zwischen Mutter und Kind ist zentraler Bestandteil der Identitätsentwicklung hin zur Autonomie oder zum Gehorsam.
In Familien, in denen Machtstrukturen bereits die frühkindliche Entwicklung prägen, wird oft blinder Gehorsam zur Basis der zwischenmenschlichen Beziehung mit allen persönlichen und politischen Konsequenzen. Wer die Verantwortung an andere abgibt und die Zügel für das eigene Leben anderen überlässt, wird süchtig nach Halt. Er unterwirft sich dem Herrschaftsgefüge und wird zum Mitläufer in Unfreiheit, Kastendenken und Glaubenssätzen. Wir fügen uns der Hierarchie von Über- und Unterordnung. Wir fühlen uns unverstanden, ziehen uns zurück und laufen Gefahr zu vereinsamen. Leider ist es des Öfteren so, dass diese Konflikte im Kindesalter schwelen und den Kindern oft keine Möglichkeit bleibt, als sich diesen Konflikten zu beugen. Sie zeigen fortwährend eine emotionale Instabilität, wenn ihr Konflikt durch äußere Einflüsse getriggert wird. Je mehr wir in unserer Erziehung kontrolliert und manipuliert wurden, desto weniger trauen wir uns die Oberhoheit über unser eigenes Verhalten zu. Wir sind verunsichert und unterliegen im Streben nach Anerkennung leicht dem Missbrauch von Macht, weil wir in unserer Kindheit oder als Erwachsener niemand gefunden haben, der uns das Gefühl vermittelt hat, dass wir um unser selbst willen bedeutsam sind.
Während für manche Kinder ihre Konflikte somit ihr Leben lang ungelöst bleiben, kommt es für andere Kinder, deren Wesen akzeptiert, geliebt und zärtlich versorgt wird, zu einer Lösung. Damit erfährt der Mensch, dass er etwas bedeutet und dass die Welt ein Stück weit reicher ist, weil ER da ist. Er glaubt an die Kräfte in sich selbst. Zuversicht und eine realistische Selbsteinschätzung verbessern unseren Selbstwert und erhöhen unsere Lebenszufriedenheit. Und weil er sich selbst wertschätzt, kann er obendrein den Wert seiner Mitmenschen wertschätzen und achten. Er strahlt Vertrauen und Hoffnung aus. Zur Anerkennung seiner Einzigartigkeit gehören nicht bloß seine Talente und Begabungen, sondern daneben die Schwierigkeiten und „Fehler“. Nur so wächst das Bewusstsein für die Würde des Menschen, die wir dann auch bei anderen anerkennen. Wir werden uns bewusst, dass wir alle „dazu“ gehören. Es bedeutet eine riesige Einzahlung auf das emotionale Beziehungskonto, wenn wir Anerkennung zollen und Selbstvertrauen fördern.
Anerkennung wirkt wie Treibstoff im gesellschaftlichen Leben. Ohne Anerkennung wird ein soziales Leben nur schwer möglich. Jeder Mensch strebt grundsätzlich nach Anerkennung für sein Tun. Wir alle brauchen soziale Akzeptanz in einer offenen demokratischen Gesellschaft. Manche brauchen eher wenig, andere dagegen eine Menge. Nach einer eher instabilen Pubertätszeit erreicht unser Selbstwert in den mittleren Lebensjahren seinen Höhepunkt und sinkt meist ab dem Alter von etwa 60 Jahren wieder ab: Träume sind zerplatzt, Pläne gescheitert, Chancen sind verpasst. Besteht im Alter zudem ein Defizit an Wertschätzung und dankbarer Resonanz, weil unsere geistigen Fähigkeiten, Konzentrationsfähigkeit und Merkfähigkeit abnehmen, kann älter werden auch eine höhere psychische Belastung werden und einsam machen. Somit wäre es von großem Vorteil, wenn wir unseren Selbstwert schon von früh an steigern lernen!
Dr. Nico Niedermeier (Facharzt für Psychotherapeutische Medizin) sieht den möglichen Grund für ein Absinken des Selbstwerts vor allem darin, dass wir uns als soziale Wesen ständig bewerten, mit anderen vergleichen und welche zwischenmenschlichen Beziehungen vorhanden sind. Ob eine erfüllende Beziehung, ein Sportverein oder eine Partei, jede Zugehörigkeit kann stabilisierend wirken, Orientierung vermitteln und unseren Selbstwert enorm beeinflussen. Landen wir allerdings in einer bestehenden Gruppenhierarchie auf einer entwertenden Position, weil die anderen Gruppenmitglieder zum Beispiel reicher, mutiger oder sportlicher sind und uns das spüren lassen, dann fühlen wir uns benachteiligt und ziehen unseren Selbstwert in Zweifel. Unsere daraus resultierende Verärgerung rührt oft aus enttäuschten Erwartungen. Überprüfen wir unsere überzogenen Erwartungen und Vorstellungen!
Virginia Satir, die Mutter der Familientherapie, meint dazu:
„Das Gefühl des Wertes und Unwertes ist nicht angeboren. Es ist in der Familie erlernt. Ein Kind hat keine Erfahrungen und keinen Maßstab, an dem es seinen eigenen Wert messen könnte. Es muss sich verlassen auf die Botschaften, die es von seiner Familie und der Umwelt bekommt. Gefühle von positiven Selbstwert können nur in einer Atmosphäre gedeihen, in welcher individuelle Verschiedenheitengeschätzt sind und Fehler toleriert werden, kurz in einer Atmosphäre, die eine wachstumsfördernde Familie ausmacht.“
Aktuell geht die psychologische Forschung davon aus, dass ungefähr die Hälfte der Kinder eine sichere Elternbindung und damit einen guten Schutzfaktor für ihr Selbstwertgefühl hat. Etwa 10 Prozent der Kinder gelten als fast unverletzbar. Sie sind selbstbewusst genug, um nur wenig abhängig von der Zustimmung ihrer Umgebung zu sein. Wenn sich jemand in einem stabilen Wertesystem bewegt und auch das Gefühl hat, dass er sich wertekonform erlebt und in diesem System seinen Sinn erleben kann, hat er den Raum, sein Selbstwertgefühl zu stabilisieren und seine wahre Natur zu leben. Aber wie sieht es im Leben der Übrigen aus?