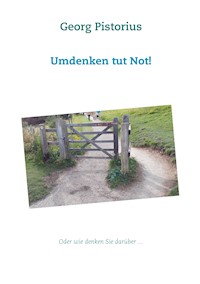
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Fragen Sie sich auch zuweilen "Was soll das?", wenn Sie die Nachrichten verfolgen? Fast unglaubwürdig, jedenfalls aber kaum zu fassen sind doch etliche der uns gebotenen Meldungen. Nicht nur in diesem Buch! Ist nicht ein Umdenken erforderlich, um die Herausforderungen zu bewältigen, unser Überleben zu gewährleisten? Denken Sie doch quer, ändern Sie Ihre Perspektive, gewinnen Sie eine andere Sicht auf die Dinge und entwickeln Sie ein neues Verständis. Das wird auch Sie verändern ... Der Kopf ist bekanntlich rund, damit die Gedanken ihre Richtung ändern können ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu meiner Wenigkeit sei vorab – für diejenigen von Ihnen, denen ich noch nicht aus einer früheren Veröffentlichung bekannt bin – auch hier kurz angemerkt, dass ich vor einer zunehmenden Anzahl von Jahren in Nordhessen geboren wurde und dort auch die Schule besuchte. Nach meinem Studium in Südniedersachsen führten mich Referendariat und zweites Staatsexamen wieder in meine Heimat zurück.
Hier lebe und arbeite ich als selbständiger Rechtsanwalt und Mediator, Hobby-Leserbriefschreiber und Autor, bin verheiratet und aktiver Vater – mit „aktiv“ meine ich, dass ich mich, wie erfreulich zunehmend viele Väter, nicht nur um meinen Beruf, sondern auch um meine Familie kümmere. Wie umgekehrt auch meine Frau nicht nur haushaltsorganisatorische Dinge erledigt und unseren Nachwuchs mit erzieht, sondern gleichermaßen an unserem Familieneinkommen arbeitet.
Am 1. Januar jährt sich alle Jahre wieder Neujahr. Eventuell werden auch Sie diesen Tag ab und an als Anstoß nehmen, um über Geschehnisse des zu Ende gegangenen und nunmehr alten Jahres nachzudenken …
Nun, wenn ich so eine Tageszeitung aufschlage oder Nachrichten im Fernsehen und in den diversen anderen Medien verfolge, dann möchte ich wie schon die letzten Jahre zuweilen doch noch das Abo kündigen oder die Flimmerkiste aus dem Fenster werfen. So fast unglaubwürdig und unfassbar sind manche der gebotenen, doch sicher durchaus nicht frei erfundenen Meldungen über Ereignisse auf unserem Planeten. Jeder selbst denkende Bürger muß sich da eigentlich fragen: Was soll das?
„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“
soll Albert Einstein gesagt haben. Ein Umdenken ist also notwendig, ein Wechsel der Perspektive erforderlich, um eine neue Sicht auf die Dinge zu erlangen und Veränderungen zu bewirken. Probleme – besser: Herausforderungen – gibt es schließlich genug, die zu bewältigen sind.
Lassen wir also die vergangenen Jahre und letzten Monate ein wenig Revue passieren. Vielleicht erinnern Sie sich ja an das eine oder andere Ereignis, oder haben selbst ähnliches erlebt … was ist passiert, warum und weshalb nicht anders?
Wie denken Sie darüber ...
Wenden wir uns doch gleich schon einmal den beiden Personengruppen zu, die den Medien alle Tage Nahrung geben und für unseren Gesprächsstoff sorgen – auch auf einigen der folgenden Seiten: die diversen Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft, männlichen wie natürlich auch weiblichen Geschlechts.
Also: ich habe noch immer nicht in Erfahrung bringen können, weshalb diese Damen und Herren augenscheinlich nahezu ausschließlich in dezent unauffälligen dunklen Kostümen oder Anzügen nebst weißen Blusen und Hemden zu beobachten sind. Und Sie? Derartige Kleidung mag seriös wirken, doch sind wirklich alle seriös, die solche Kleidung tragen?
Vielleicht haben Sie auch schon einmal kurz mit Ihrem Auto irgendwo gehalten, um schnell etwas zu erledigen, und dann bei Ihrer Rückkehr zum Wagen ein „Knöllchen“ vorgefunden? – Weil Sie „für die paar Minuten“ keinen Parkschein erworben haben. Oder haben Sie schon mal die Parkzeit überschritten und dafür ein Verwarnungsgeld zahlen müssen? Dann ist Ihnen bestimmt aufgefallen, wie unterschiedlich hoch die Verwarnungsgelder sind.
Ob durch Parkgebühren oder Verwarnungsgeld – die Städte melken des Autofahrers Geldbeutel. Den Bürgern werden keine (kaum) Kurzzeitparkplätze zur Verfügung gestellt, Parkplätze, auf denen man für weniger als eine halbe Stunde parken darf, ohne – wie sonst üblich – für mindestens eine halbe Stunde Parkgebühren zahlen zu müssen. Man muss also immer wenigstens für eine halbe Stunde Parkgebühren zahlen, auch wenn man eigentlich nur wenige Minuten stehen bleiben will – oder aber ein Verwarnungsgeld riskieren. Wobei es hier und da auch immer noch Parkscheinautomaten geben soll, die auf eingeworfene Beträge kein Wechselgeld ausgeben können, so daß man bei fehlendem Kleingeld dann sogar genötigt ist, für den nächst höheren Betrag eine noch längere Parkzeit zu bezahlen.
Da die Stadt sozusagen das Monopol für die Erhebung von Parkgebühren hat (und auch die Verwarnungsgelder kassiert), stellt sich diese Situation wettbewerbsrechtlich betrachtet im Grunde als missbräuchlich und daher rechtswidrig dar.
Die Erhebung von Verwarnungsgeldern für kurzzeitiges Parken ohne gültigen Parkausweis erscheint daher nicht verhältnismäßig und somit rechtswidrig – eine Verwarnung ohne Verwarnungsgeld ist hier das mildere (und somit angemessene) Mittel.
Die Unverhältnismäßigkeit der Verwarnungsgelder zeigt sich allerdings auch noch unter einem anderen Aspekt: Wer guten Willens ist und einen Parkschein löst, die zulässige Parkzeit jedoch (vielleicht wirklich unverschuldet) überzieht, wird mit einem wesentlich höheren Verwarnungsgeld zu Kasse gebeten, als derjenige, der (sozusagen böswillig) von vornherein gar keine Parkgebühren zahlt!
Und außerdem: nach § 138 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist ein Rechtsgeschäft nichtig, also unwirksam, wenn es gegen die guten Sitten verstößt. Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage (...) eines anderen sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zur Leistung stehen („Wucher“).
Nun: unter Berücksichtigung der heutigen technischen Möglichkeiten kann eigentlich ein jeder Park- oder Parkscheinautomat die Parkzeit minutengenau abrechnen, wenn er denn entsprechend programmiert wäre. Dieses genau tun die Betreiber öffentlicher Parkplätze jedoch, von ersten Ausnahmen abgesehen, nicht. Und da die Betreiber in der Regel keine Konkurrenz (vor Ort) haben, können sie die daraus resultierende Zwangslage der Autofahrer ausbeuten, indem sie diese auch dann im Halbstundentakt – oder gar für jede wenn auch nur noch zu kurz angebrochene volle Stunde – fürs Parken zahlen lassen, wenn sie nur wenige Minuten parken wollen.
Kaufen Sie eigentlich gelegentlich in anderen Ländern hergestellte Butter?
Also unser Nachbar hatte während eines Griechenland-Urlaubs im dortigen Supermarkt Butter der hiesigen Molkereizentrale gefunden. Dafür findet sich in deutschen Kühlregalen irische und in Irland wird vermutlich Butter aus Griechenland verkauft. Weshalb dann die ausländische Butter – trotz der steigenden Transportkosten – immer noch günstiger als die deutsche ist, lässt sich nicht wirklich nachvollziehen.
Bier ist überall von überall her zu haben und auch zahlreiche andere Produkte des täglichen (sowie des nicht alltäglichen) Bedarfes haben eine lange und weite Reise bis in die Verkaufsregale unseres Lebensmittelmarktes hinter sich – so zum Beispiel ganzjährig angebotenes Obst und Gemüse, um nur wenige zu nennen. Das ist weder ökonomisch noch ökologisch logisch zu erklären oder gar sinnvoll.
Und wen kann es da noch wundern, dass derart viel Lastwagen auf unseren Straßen unterwegs sind.
Wenig – zu wenig – Bürger werden sich vermutlich Gedanken darüber machen, welchen Einfluss ihre Einkäufe im Supermarkt auf die heimische Wirtschaft wie auch unsere Atemluft haben (könnten). Und mancher Arbeitslose wird wohl nicht wenig Gegenstände in seinem Eigentum haben, die im Ausland von dortigen Arbeitnehmern produziert wurden!
In Deutschland existieren immer noch 16 Landtage und weitere 16 Landesregierungen. Fragen Sie sich auch immer mal wieder, wozu eigentlich?
Erlässt die Bundesregierung ein Rahmengesetz, so wird dieses von den Landeregierungen übernommen und es werden infolge sechszehn Landesgesetze verabschiedet – mit überwiegend identischem Inhalt und Wortlaut. Und auch ohne Rahmengesetze gleichen sich viele Landesgesetze. Dieser Föderalismus stellt sich mittlerweile als ein Luxus dar, der im Grunde nicht mehr finanzierbar ist.
Und auch nicht erforderlich. Denn um den Einfluß der Regionen in Deutschland bei politischen Entscheidungen zu gewährleisten, fänden sich gewiß andere Wege. Zum Beispiel könnten die Regierungspräsidien als regionale Teile der Verwaltung ein Recht zur Stellungnahme erhalten, wenn die Bundesregierung ein neues Gesetz erlassen will. Oder die Sitzverteilung im Bundestag könnte derart erfolgen, dass aus jedem Bundesland seiner Einwohnerzahl entsprechend ein oder mehr Abgeordnete vertreten sind.
Die derzeitige Situation stellt sich – ungeachtet der historischen Entwicklung – eigentlich eher als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme dar, denn als sinnvoll und erforderlich. Und das althergebrachte deutsche Prinzip der vorrangigen Zuständigkeit der Länder steht zudem im Widerspruch zur internationalen Entwicklung, aufgrund der der Bund zunehmend Kompetenzen abgegeben hat und weitere abgibt ... um europaweite Regelungen zu ermöglichen, deren Sinn zuweilen höchst zweifelhaft ist.
Größe macht träge, finden Sie nicht auch?
Größe ist nicht nur keine Erfolgsgarantie, sondern kann sich zudem sogar negativ auswirken. Denn ein größeres Unternehmen verlangt nach einer umfassenderen Aufgabenverteilung. Die Anzahl der Entscheidungsträger vervielfacht sich zwangsläufig. Das bedeutet allerdings auch, dass sich Kommunikationswege verlängern und Entscheidungen verzögern.
Die eigentlichen Entscheidungsträger in den Führungsetagen verfügen nicht (mehr) über den nötigen Kundenkontakt. Und wer Kundenkontakt hat, wird in der „Chefetage“ oft nicht gehört – die Motivation der Mitarbeiter sinkt. In der heutigen schnelllebigen Zeit muss ein Unternehmen jedoch schnell auf Kundenwünsche reagieren und entscheiden, um sich im –Wettbewerb dauerhaft durchsetzen zu können.
Der Nachteil der Größe zeigt sich im Übrigen auch immer wieder bei Tarifverhandlungen: Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände haben zu viel Mitglieder. Sie sind kaum (noch) in der Lage, Tarifverträge abzuschließen, die den unterschiedlichen Interessen aller – unterschiedlich großen und kleinen – Unternehmen gerecht werden. Mit zunehmender Größe geht allerdings die Flexibilität verloren.
Dennoch wollen alle Wirtschaftsunternehmen endlos weiterwachsen ... um dann oftmals – infolge obiger Probleme – in wirtschaftliche Schwierigkeiten zu kommen und wieder in mehrere kleine Unternehmen zu zerfallen.
Die Dose. Befüllbar mit den unterschiedlichsten Getränken, überall leicht zu vertreiben, zu erwerben und zu entsorgen. Allerdings nicht gerade umweltfreundlich. Daher musste ein Pfand her, um die Dose ihrer Wiederverwertung zuzuführen und die angepeilte Mehrwegquote zu erreichen.
Eine Meldung über das Für und Wider des Dosenpfandes erstaunt dennoch sehr: „Drei Viertel der Bevölkerung befürworten die Einführung des Dosenpfandes“. Wenn diese Dreiviertel in der Vergangenheit jedoch bereits zu Pfandflaschen gegriffen hätten, läge die Mehrwegquote längst bei (über) 75 Prozent und das Dosenpfand wäre wohl überflüssig.
Kritik an der Pfandpflicht gäbe es dann auch keine. Denn die Nachfrage bestimmt immer das Angebot, weil die Anbieter ihre Produkte verkaufen wollen. Verkauft wird allerdings nur, was auch abgenommen wird. Und viele Arbeitsplätze, die vom Mehrweg abhängen, würden gesichert – von der Wegwerfdose profitieren vermutlich weitaus weniger Arbeitnehmer.
Anhänger der Wegwerfmentalität sollen also ruhig zur Kasse gebeten werden ...
Alle Politiker sind gleich. Wenn man ihre Äußerungen vernimmt, egal von welcher Partei, haben sie eigentlich alle das Wohl der Bürger, ihrer Wähler, im Blick. Alle Politiker wollen die Lebensbedingungen verbessern, sie verlangen mehr Rechte für Kinder und alte Menschen, wollen die Wirtschaft ankurbeln und die Zahl der Arbeitslosen verringern ...
Nur, wenn eigentlich alle Politiker das gleiche wollen, warum sind sie dann doch immer gegen die Meinung des anderen? Die Regierung macht einen Vorschlag, den die Opposition sofort kritisiert und ablehnt, weil es ja nicht ihr eigener Vorschlag ist. Kommt ein Vorschlag von der Opposition, ist selbstverständlich die Regierung dagegen – es ist ja nicht ihr eigener. Und eine Regierung kann natürlich keine Vorschläge des politischen Gegners aufgreifen – wer fragt sich da schon, wie gut die eigentlich Vorschläge jeweils sind.
Vorschläge von Nicht-Politikern, von Vereinen oder Verbänden, werden selbstverständlich auch abgelehnt – von den Politikern. Schließlich kann die Politik in unserem Lande ja nicht von Parteilosen gemacht werden, die vielleicht nicht einmal eine Ahnung von der Sache haben. Oder?
Wundert es Sie da, dass sich die Verhältnisse kaum ändern?
Und es ist schon erstaunlich, dass zwar gegen Kriege und andere Ereignisse in jedem noch so entfernten Winkel der Erde demonstriert wird, andererseits jedoch kaum jemand gegen unsere eigenen Politiker auf die Straße zu Felde zieht, um seinen Unmut über diese zu äußern.
Die Fusion zweier Geldinstitute scheint davon abzuhängen, ob die Mitarbeiter der einen Bank – wie die der anderen – gewillt sind, künftig auch samstags zu arbeiten.
Der Vorsitzende der Bank, deren Mitarbeiter die Samstagsarbeit ablehnen, tut jedenfalls gut daran, die Fusionspläne jedenfalls zunächst zu verschieben. Denn eine Fusion, die offenbar nur von der Arbeitgeberseite, den Vorständen und Aufsichtsräten, gewollt ist, die von den Arbeitnehmern jedoch abgelehnt wird, wäre wohl ohnehin früher oder später zum Scheitern verurteilt. Unmotivierte Mitarbeiter wären die Folge, der Betriebsfrieden dahin.
Außerdem: brauchen Banken eigentlich Samstagsarbeit?
Bei der Beantwortung dieser Frage sind nicht nur die Tarifvertragsparteien gefragt. Fraglich ist doch auch und in erster Linie, ob die Fusion (einschließlich der Samstagsarbeit) überhaupt dem Kunden Vorteile bringt. Denn er bringt den Umsatz. Und die beiden Banken haben allein aufgrund der Fusion zusammen ja nicht plötzlich mehr Kunden.
Wobei auch zu bedenken ist, dass in der jüngsten Vergangenheit gerade auch die Banken dazu beigetragen haben, dass Deutschland im Bereich der Dienstleistungen als „Servicewüste“ bezeichnet werden kann. Denn es wurden immer mehr Filialen geschlossen oder zu automatisierten Geschäftsstellen umfunktioniert. Die Geldautomaten allerdings arbeiten bereits rund um die Uhr, auch am Wochenende, mit und ohne Fusion. Allerdings festigen sie – im Gegensatz zu guten und motivierten Mitarbeitern – keine Kundenbindungen.
Flexibilität und Toleranz ist also gefragt. Bringt die Samstagsarbeit Vorteile für den Kunden, so bringt sie auch Vorteile für die Bank und ihre Mitarbeiter. So gesehen spricht nichts dagegen, dass diejenigen Mitarbeiter (Bankangestellte, Filialleiter und Vorstandsmitglieder) abwechselnd auch samstags arbeiten, die sich dazu bereit erklären – wer nicht will, muß nicht. Sofern dies gegenseitig akzeptiert und toleriert wird, wird keine „Zwei-Klassen-Belegschaft“ entstehen. Fraglich bleibt allerdings wohl, ob der Manteltarifvertrag die erforderliche Flexibilität und Toleranz ermöglicht.
Bereits im Jahre 1982 hatte sich Richard von Weizsäcker in „Das Parlament“ (Beilage B 42/1982, S. 3 ff.) über die Zukunft der politischen Parteien geäußert: „Parteipolitik muss sich an den Sachproblemen, an verantwortungsvoller Zukunftsvorsorge, nicht am Kampf um die Macht orientieren. Solange Politiker ihre Aufgabe nur so verstehen, die Wünsche der Wähler zu ermitteln, zusätzliche Wünsche zu suggerieren und ihre Erfüllung zu versprechen, so lange wird die Parteiendemokratie auf Dauer keine Überlebenschance haben. Die wichtigste Chance zur Überwindung der Krise liegt darin, den durch die Wahl erteilten Führungsauftrag tatsächlich wahrzunehmen: Nicht den Strömungen hinterher zu laufen, sondern auf ihre Richtung Einfluß zu nehmen und Zukunftspolitik zu betreiben.“
Die „Politik muss sich an den Sachproblemen“ orientieren ... täte sie das, hätte die Politik zum Beispiel schon vor Jahren erkennen können, dass das deutsche Rentensystem grundlegend fehlerhaft ist: ein System, in dem immer die arbeitenden Bürger für die Renten der nicht mehr arbeitenden Bürger aufkommen, funktioniert nur so lange einwandfrei, wie die Anzahl der arbeitenden und der nicht mehr arbeitenden Bürger im erforderlichen Gleichgewicht bleibt. In einer Zeit jedoch, in der die Geburtenrate über Jahre rückläufig ist und die Anzahl der Rentner stetig zunimmt, ist der Kollaps des Systems vorprogrammiert – immer weniger arbeitende Bürger müssen die Renten der nicht mehr arbeitenden zahlen, immer höhere Rentenbeiträge sind unvermeidlich.
Eine problemorientierte Politik hätte die Fehlerhaftigkeit des Rentensystems erkannt, auch öffentlich zugegeben und Lösungen erarbeitet:
das System müsste geändert werden: jeder arbeitende Bürger muss für seine eigene, spätere Rente vorsorgen, der Staat muß für seine Beamten entsprechende Beträge zurück legen (anlegen),
die Geburtenrate müsste angehoben werden: Kinder zu haben und zu erziehen muss mindestens so anerkannt sein, wie einen Arbeitsplatz zu haben, Wohnungen müssen auch für Familien mit zwei oder mehr Kindern groß genug und bezahlbar sein, zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie muß das „Teilen eines Arbeitsplatzes“ selbstverständlich werden und das „Abschieben“ der Kinder in Betreuungseinrichtungen gleich welcher Art verdrängen,
Die wichtigste Chance zur Überwindung der Krise liegt darin, den durch die Wahl erteilten und nach Wahlen immer betonten Führungsauftrag tatsächlich wahrzunehmen ... Einen Führungsauftrag, eine übertragene Aufgabe, wahrzunehmen bedeutet natürlich auch, zu den Folgen und Konsequenzen zu stehen. Verantwortung zu tragen heißt nicht, bei einem Scheitern „den Hut zu nehmen“.
Nur allzu oft allerdings treten Politiker von ihren Ämtern zurück und stellen ihren jeweiligen Sitz zur Verfügung, unter anderem, um Schaden von ihrer Partei abzuwenden. Dadurch tragen sie allerdings nicht wirklich die Verantwortung für ihr vorangegangenes Handeln (und das ihrer Partei), sie flüchten vielmehr vor den Konsequenzen. Und davor, ihre Qualifikation unter Beweis zu stellen und wenigstens zu versuchen, den Schaden wieder gut zu machen.
Andererseits ist oft das Verlangen nach einem „Bauernopfer“ groß und scheint befriedigt werden zu müssen. Dies nicht nur in der Politik, wo Wahlniederlagen eigentlich immer nur von den jeweiligen Parteivorständen, nicht jedoch von den Mitgliedern verantwortet werden. Ebenso werden (wiederholte) Niederlagen auch kaum den Sportlern, Spielern und Mannschaften selbst angelastet, sondern führen meist (nur) zur Entlassung der Trainer.
Ein Amtsvorgänger von Richard von Weizsäcker hatte Jahre zuvor bereits festgestellt: „Es kann nicht die Aufgabe eines Politikers sein, die öffentliche Meinung abzuklopfen und dann das Populäre zu tun. Aufgabe des Politikers ist es, das Richtige zu tun und es populär zu machen“.
Wieder einmal standen sich die Befürworter und die Gegner des geplanten Ausbaus eines Regionalflughafens gegenüber. Diesmal beim Erörterungstermin im Regierungspräsidium. Muß, soll und kann der Flughafen nun ausgebaut werden und wenn wie? Die Befürworter wollen den Ausbau, weil ..., die Gegner lehnen den Ausbau ab, weil ...
Keine Annäherung möglich?
Vielleicht doch. Ein Umschwenken der bisherigen Denkstrukturen könnte einen Lösungsansatz hervorbringen und zudem aufzeigen, ob ein Ausbau im Interesse aller überhaupt möglich ist: Die Ausbaugegner mögen doch einmal darlegen, unter welchen Umständen und Voraussetzungen sie den Ausbau akzeptieren würden. Und die Befürworter des Ausbaus sollten sich einmal dazu äußern, unter welchen Umständen sie zu dem Ausbau nicht (mehr) bereit wären.
Selbstverständlich sollten bei den weiteren Überlegungen die bislang angedachten öffentlichen Fördergelder in nicht unerheblicher Höhe grundsätzlich unberücksichtigt bleiben. Zum einen, weil die Leere der öffentlichen Kassen keine Zuschüsse aus Steuermitteln zulassen. Zum anderen, weil ein von der Privatwirtschaft gewollter Flughafen auch von dieser Wirtschaft finanziert werden sollte. Sie ist es schließlich, die sich dadurch Gewinne erhofft.
Langfristige Vorteile kann ein (ausgebauter) Flughafen nur bringen, wenn er wirtschaftlich tragbar ist, wenn er also rentabel betrieben werden kann. Ein solches „gesundes“ Unternehmen allerdings muss sich selbst finanzieren (können) – der Ruf nach öffentlicher Förderung begründet sonst nur die Vermutung, dass die Betreiber des Flughafens ihr finanzielles Risiko auf die Steuerzahler abwälzen wollen.
Wenn die Wirtschaft diesen Flughafen (-ausbau) will, dann sollte sie (und würde sie) ihn auch (wenigstens mit) finanzieren – nicht jedoch der Steuerzahler.
Da begehen ein Oberbürgermeister, ein Bürgermeister und ein Stadtbaurat eine Straftat zum Nachteil der Stadt, ihres gemeinsamen Arbeitgebers – des Steuerzahlers. Mit ihren Verteidigern vereinbarten sie Honorare, die über den Regelsätzen der Rechtsanwaltsgebührenordnung liegen. Die Strafverfahren werden wegen geringer Schuld gegen Zahlung eines Geldbetrages eingestellt. Und nun soll die Stadtkasse die Anwaltskosten übernehmen!
Eine Frage an alle Arbeitgeber: wer von Ihnen würde einem Arbeitnehmer die Kosten für dessen Strafverteidigung zahlen, wenn dieser Arbeitnehmer die Straftat gegen Sie begangen hat?
Eine Straftat zum Nachteil des Arbeitgebers zieht üblicherweise außer einem Strafverfahren die sofortige, fristlose Kündigung des Arbeitnehmers nach sich. Die Kosten für seine Strafverteidigung sowie die sonstigen Kosten des Verfahrens muss ein Angeklagter in aller Regel selbst tragen (sofern er nicht freigesprochen wird).
Die große (größte) Ausstellung moderner Kunst in Deutschland gibt sich weltoffen: Beschreibungen der Darstellungen und Angaben zu den Künstlern sind in Englisch gehalten. Sehr zum Ärger der – wohl überwiegend – deutschen Ausstellungsbesucher.
Da fragt es sich doch, ob Erklärungen zu Kunstobjekten überhaupt erforderlich sind.
Der Begriff „Kunst“ ist im Grunde nicht definierbar. Eigentlich in jeder Epoche bemühten sich Künstler und Theoretiker darum, eine allgemeine Umschreibung zu finden. Das Bundesverfassungsgericht umschreibt die im Grundgesetz gewährleistete Freiheit der Kunst als „freie schöpferische Gestaltung, in der Eindrücke, Erfahrungen, Erlebnisse des Künstlers durch das Medium einer bestimmten Formensprache zu unmittelbarer Anschauung gebracht werden“. Es gibt keine allgemein gültige Definition der Kunst. Kunst spricht alle Sinne an: sie spiegelt wieder und wider, sie spielt mit Materialien, Farben, Formen und Tönen, mit Realität und Phantasie, wohl überlegt oder ganz spontan – so schwer unterscheidbar im Kunstwerk enthalten, dass dies nicht „etwas aussagen“ kann, außer vielleicht, dass alles an ihm gesehen und/oder gehört werden will.
Sind Erklärungen da erforderlich?
Oder zulässig?
Darf – gerade auch im Hinblick auf das Grundrecht der Kunstfreiheit – irgend jemand irgend jemandem seine Vorstellungen von richtiger, wahrer und/oder guter Kunst aufzwingen?
Kunst verlangt doch gerade vom Betrachter, sich selbst mit ihr auseinander zu setzen. So kann jeder aus seiner Sicht „Zugang“ zum Werk erlangen, es unvoreingenommen auf sich wirken lassen und für sich selbst interpretieren. Gerade das ist doch (auch) das faszinierende an Kunst: seine (scheinbare) Bestimmungslosigkeit. Erklärungen des Künstlers erscheinen da schlicht überflüssig und nur dann erforderlich, wenn es dem Künstler nicht gelungen ist, sein Kunstwerk für sich selbst „sprechen“ zu lassen.
Im übrigen ist die Wahl der englischen Sprache für die Beschriftungen allerdings durchaus konsequent: Der Name der Ausstellung „documenta“ kommt aus dem Lateinischen, die englische Sprache wiederum ist eine germanische und als solche mit dem Lateinischen verwandt. – Außerdem: Kann für eine „Weltausstellung der Kunst“ eine andere Sprache in Frage kommen, als die „Weltsprache Englisch“?
Dennoch scheint bei nicht wenigen der ausgestellten Kunstobjekten die künstlerische Leistung wohl am ehesten in der literarischen zu finden sein, das Werk zu beschreiben und dem Betrachter zu erklären. Anderen Künstler wiederum ist nicht einmal selbst ein Name zu dem selbst erschaffenen eingefallen.
Der Ruf nach höheren Strafen für Sexualstraftäter ist immer wieder zu hören. Zu Recht stehen gerade Wiederholungstäter im Brennpunkt der Diskussionen. Wegen der Fehlbarkeit der Gutachter wird hier wohl nie ein befriedigendes Ergebnis zu erzielen sein.
Wobei sich der eine oder andere Gutachter vielleicht selbst in die Obhut eines vertrauensvollen Kollegen begeben sollte: Oder können Sie nachvollziehen, dass ein Gutachter einem Vergewaltiger keine Gefahr für die Allgemeinheit attestierte, weil dieser nicht den Hang zu Taten habe, bei denen seine Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden könnten? – Dieser Vergewaltiger soll seine minderjährigen Opfer mit einer Pistole bedroht, gefesselt und geknebelt, stundenlang auf abscheuliche Weise vergewaltigt und sie anschließend am Unterleib verstümmelt haben!
Auf der anderen Seite sollte daher nicht übersehen werden, dass Strafe neben der Vergeltung des Unrechts auch den Schutz der Bevölkerung auch den Zweck hat, also der Begehung von (weiteren) Straftaten entgegen zu wirken, potenzielle Täter von ihren geplanten Taten abzuschrecken. Hier kommt nicht nur der verhängten, sondern gerade auch der vom Gesetz angedrohten Strafe nebst anschließender Sicherungsverwahrung besondere Bedeutung zu.
Im Bereich der Sexualstraftaten (§§ 174 ff. des Strafgesetzbuches), insbesondere bei Kindesmissbrauch, liegen die Rahmen für Freiheitsstrafen zwischen wenigen Monaten und zehn Jahren (in besonders schweren Fällen und solchen mit Todesfolgen auch höher). Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren kann das Gericht zu Bewährung aussetzen, wenn dies dem Verurteilten zur Warnung genügt und keine besonderen Umstände dagegen sprechen. Eine zur Bewährung ausgesetzte Strafe wird dann erst tatsächlich vollstreckt, wenn der Verurteilte gegen Bewährungsauflagen verstößt, insbesondere während der Bewährungszeit erneut eine Straftat begeht. Bei der Strafbemessung sind unter anderem die Auswirkungen der Tat zu berücksichtigen.
Mit Abschreckung ist zwar nicht alles, allerdings doch einiges zu erreichen – wie Beispiele aus dem Ausland zeigen. Ein jeder mag daher selbst die Wertung des Gesetzgebers bewerten, Bewährungsstrafen für Täter zuzulassen, deren Opfer an den Folgen der Tat lebenslänglich leiden.
Wobei in der Vergangenheit der Opferschutz gegenüber dem Täterschutz geradezu vernachlässigt wurde: Täter erhalten (bei unzureichendem Einkommen auf Staatskosten) eine Verteidigung vor Gericht und später Resozialisierungsmaßnahmen. Opfer hingegen sitzen zu oft allein im Zeugenstand, um gegen ihren Peiniger auszusagen. Und sie müssen sich um – rechtliche wie auch psychologische – Hilfe grundsätzlich ebenso selbst kümmern, wie um deren Finanzierung, die als Schadensersatzleistung eigentlich selbstverständlich vom Täter zu tragen ist.
Die Pleitewelle hat nun auch die noch recht neuen Großkinos erreicht. Die Probleme sind hier wohl, wie meist auch sonst, hausgemacht: zu viele neue Kinohäuser und zu groß gebaut mit zu vielen Plätzen, zu viel erforderliche Mitarbeiter ... also zu hohe Kosten und infolge dessen zwangsläufig zu hohe Eintrittspreise – da kann es nicht wundern, dass die Einnahmen rückläufig sind, weil zu viele Kinobesucher angesichts der Kosten eines einzigen Kinobesuches (Parkgebühr, Eintrittspreis, Verpflegung) immer seltener oder gar nicht mehr ins Kino gehen. Die Videothek an der Ecke oder im Internet ist preiswerter.
Den Musicaltheatern erging es ebenso.
Der Preis bestimmt den Umsatz und Größe ist nun einmal nicht alles!
Außerdem ist das „Erlebnis Kinoabend“ auch nicht mehr dasselbe wie früher: Dolbysurround-Tontechnik klingt zwar toll, allerdings die übliche Mischung zwischen der Konversation der Darsteller einerseits und der Musik sowie den Hintergrundgeräuschen andererseits geht doch oft sehr zu Lasten der Dialoge, die Hintergrundmusik tritt allzu sehr in den Vordergrund. Dies umso mehr, da die in Kinos gebotene Lautstärke oft darauf schließen läßt, daß der für die Lautstärke zuständige Mitarbeiter schwerhörig sein muß. Außerdem hat sich zwar der (Sitz-) Komfort in den Kinos verbessert, der Service dafür verschlechtert – heutzutage muß man aufstehen und ins Foyer gehen, um vor Beginn der Vorstellung noch ein Eis oder Popcorn zu bekommen. Und sich zudem beeilen, um pünktlich zum Filmanfang wieder zurück zu sein
Die Panne bei der Stimmenauszählung nach der Wahl macht landesweit Schlagzeilen: der Kreiswahlleiter, der Oberbürgermeister höchst selbst, hatte zu wenig Wahlhelfer rekrutiert, die Auszählung der Stimmzettel dauert ... und der Wahlleiter selbst ist am Tage der Wahl im Urlaub!
Für die nächste Wahl will der Wahlleiter nun mehr Mitarbeiter als Wahlhelfer finden. Vielleicht sollte er besser auch einen neuen Wahlleiter finden?
In privaten Betrieben sind Urlaubssperren in Zeiten außergewöhnlich hoher Arbeitsbelastung durchaus üblich. Da ist es nicht nachvollziehbar, dass ein Kreiswahlleiter als oberster Verantwortlicher während der – auch nur alle vier Jahre stattfindenden – Bundestagswahl auswärts im Urlaub weilt und seinen Stellvertreter mit der Verantwortung für den reibungslosen Ablauf der Wahl allein lässt.
Anstatt jedoch wenigstens die unangebrachte Urlaubsplanung einzugestehen, attestiert der Kreiswahlleiter seinem Stellvertreter dann auch noch fehlende „praktische Erfahrung“ und versetzt ihn auf einen anderen Posten. Fehlende Erfahrung (sofern tatsächlich gegeben) vor der Wahl zu erkennen und für Abhilfe zu sorgen wäre doch wohl die Aufgabe und Pflicht des Kreiswahlleiters selbst gewesen.
Keiner hat offenbar jedoch bislang erfahren, ob die Pflichtverletzung auch Folgen für den Kreiswahlleiter selbst hatte.
„Nicht Rauchen“ oder „Rauchen erlaubt“? – Die Toleranz entscheidet: In kaum einem Restaurant, Café oder sonstigen öffentlichen Gebäude (Bahnhof) hing je ein Schild „Rauchen erlaubt“. Dennoch griffen Raucher ganz selbstverständlich zur Zigarette, ohne den Tischnachbarn zu fragen, ob ihn der Qualm stört. In Geschäften, wo Lebensmittel offen zum Kauf angeboten werden, wurde selbstverständlich nie geraucht – in Restaurants jedoch, wo Lebensmittel offen zum Verzehr serviert werden, wurde ebenso selbstverständlich regelmäßig geraucht. Nur dort, wo ein Schild „Nichtraucher“ darauf hinwies, dass der gesundheitsschädliche Rauch unerwünscht ist, blieb die Atemluft – in der Regel – rauchfrei.
Ganz selbstverständlich tolerieren Nichtraucher in der Öffentlichkeit seit Jahren, dass überall geraucht wird – obwohl es nirgendwo ausdrücklich erlaubt ist und ohne dass es dafür einen Grund gibt. Und ebenso selbstverständlich gehen Raucher seit jeher davon aus, immer und überall rauchen zu dürfen.
Nach Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes hat jeder das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Dieses Grundrecht schützt und gewährleistet die Handlungsfreiheit jeder einzelnen Person gleich welchen Alters im umfassenden Sinn. Es kommt dabei nicht darauf an, welches Gewicht der Betätigung für die Persönlichkeitsentfaltung zukommt. Aus diesem Grundrecht folgt daher, dass jeder für sich entscheiden kann, ob er seine Gesundheit durch Rauchen schädigen will – oder nicht.
Nach Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes hat jeder dieses Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit unter anderem aber nur, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. Zu den Rechten anderer gehört insbesondere das nach Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes jedermann gleich welchen Alters zustehende Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Dieses Recht schützt somit vor allen Einwirkungen, die die menschliche Gesundheit beeinträchtigen. Hieraus ist grundsätzlich zu schließen, dass jedermann in der Öffentlichkeit – außerhalb seiner privaten Räumlichkeiten – nur dann rauchen und andere mit seinem die Gesundheit schädigenden Rauch gefährden darf, wenn sich niemand daran stört. Denn andernfalls verletzt der Raucher ein Recht anderer.
Rauchen ist erwiesenermaßen und unbestritten gefährlich, höchst ungesund und schließlich tödlich. Bereits das sogenannte Passivrauchen schadet der Gesundheit erheblich. Bei Säuglingen und Kleinkindern verdoppelt sich allein durch passives Rauchen das Risiko, später an Lungenkrebs zu erkranken. Es gab und gibt keinen Grund, weshalb Nichtraucher in jedermann zugänglichen Räumen akzeptieren müssen, dass dort geraucht wird und sie sich dem gesundheitsschädlichen Rauch aussetzen. Es ist nur eine Frage der Toleranz.
Und es ist an der Zeit, dass Raucher tolerant werden. Dass sie akzeptieren, dass ihr Rauch nicht überall erwünscht ist, und dass sie in Anwesenheit anderer nur dann und nur dort rauchen, wo es ihnen ausdrücklich erlaubt wird. So selbstverständlich, wie sich Raucher bisher außerhalb ihrer eigenen Wohnung jederzeit einer Zigarette anzünden, so selbstverständlich sollten sie in Zukunft zunächst fragen, ob jemand Einwände dagegen hat. So selbstverständlich, wie Nichtraucher bisher den Rauch toleriert haben, so selbstverständlich sollten Raucher den Wunsch anderer nach rauchfreier Atemluft akzeptieren. Nicht die Nichtraucher sollten darum bitten, dass nicht geraucht wird, sondern die Raucher, ob sie rauchen dürfen. Rauchverbote – wie die mittlerweile von der Gesetzgebung beschlossenen – sind/wären dann überflüssig.
Wobei sich jeder Raucher auch bewusst sein sollte: sobald er in der Öffentlichkeit (nicht in seiner privaten Wohnung) in Anwesenheit nichtrauchender Dritter raucht, macht er sich mindestens wegen versuchter Nötigung sowie versuchter gefährlicher und/oder schwerer Körperverletzung strafbar.
Die Wirkungen der bislang von den Gesetzgebern beschlossenen Rauchverbote belegen im übrigen erneut die Tödlichkeit des Rauchens: Nach der gewiß ernstzunehmenden Studie einer Krankenkasse hat sich die Zahl er Herzinfarkte seit Einführung der Nichtraucherschutzgesetze deutlich verringert. Einigen tausend Menschen ist damit offenbar ihr Leben gerettet worden. Lungenkrebs und andere – tabakbedingte – Leiden werden vermutlich ebenfalls erheblich seltener auftreten, als vor der Einführung der Rauchverbote.
Kurze Hosen sind auch an heißen Tagen für den Mann tabu. Diese Ansicht äußerte kürzlich – angesichts einer Heißwetterperiode – Roman Wollin, Personalbetreuer der Deutschen Bank in Hamburg. Im Kundenverkehr, so der Berater, bleibe „eine seriöse Erscheinung aus Respekt vor dem Kunden unerlässlich“. Aber „auch bei internen Stellen ohne Außenkontakt“ solle auf kurze Hosen verzichtet werden, um keinen falschen Eindruck bei Kollegen oder Vorgesetzten hervor zu rufen. Eine kurze Hose werde „mit Freizeitkleidung, Strand und Urlaub verbunden“, sie passe nicht in ein ernsthaftes Geschäftsumfeld. Für den Personalbetreuer sei eine helle – lange – Hose das „Maximum an sommerlicher Lockerheit“. Er gesteht aber doch zu, dass es Frauen im Beruf in punkto Kleidung leichter hätten, als Männer.
Dieses Zugeständnis wundert wenig, stört sich doch kaum jemand daran, wenn Frauen bei hohen Temperaturen auch in Ausübung ihres Berufes leicht – und kurz – bekleidet sind. Zuweilen wird dies sicher auch seitens der Arbeitgeber (jedenfalls insgeheim) sogar befürwortet.
Um so diskriminierender sind daher antiquierte Ansichten, nur ein Mann in langer (dunkler) Hose sei als seriös anzusehen. Männer in südlichen Ländern haben es da deutlich leichter – und natürlich Personalbetreuer, deren Arbeitszimmer und Firmenwagen mit Klimaanlagen ausgestattet sind.
Und: bedenken Sie, weshalb die „Bermuda-Hose“ zu ihrem Namen gekommen ist! Auf den Bermudas trägt auch Mann kurze Beinkleider – und niemand stört sich daran.
Dabei verstößt es schlicht gegen das Grundrecht auf Gleichbehandlung, wenn die Gesellschaft Frauen mit kurzen Beinkleidern akzeptiert, während Männer in langen Hosen schwitzen sollen.
Und es ist zu bedenken, dass es die Arbeitsleistung fördert, wenn man(n) sich wohl fühlt. Anders ausgedrückt: wem einfach nur noch „zu warm“ ist, der kann kaum konzentriert arbeiten und gute Ergebnisse liefern.
Am Beispiel der Politiker ist im übrigen oft genug zu erkennen, dass eine seriöse Kleidung allein noch keine gute Arbeitsleistung bedingt.
Und, mal ehrlich: wenn Sie im Hochsommer angemessen leicht bekleidet in eine Bank oder Sparkasse kommen, tun Ihnen die Angestellten in langer Hose nicht auch leid? Fühlen Sie sich besser beraten, nur weil sie eine lange Hose an haben?
Es heißt zwar, Kleider machen Leute – aber: nicht immer sind diese Leute dann auch die, die sie zu sein scheinen! Denn zuweilen trügt der Schein – oder, wie es William Macneile Dixon formulierte: „Nicht die prachtvollen Segel sind es, die das Schiff treiben. Es ist der unsichtbare Wind.“
Was also spricht dagegen, wenn Mann es Frau gleich tut und bei hohen Temperaturen zu kurzen Bekleidungsstücken greift? Gönnen wir Männer den Frauen doch auch „tiefe Einblicke“ und die Ansicht unbekleideter Beine. Die Ergebnisse von entsprechenden Umfragen unter Frauen sprechen dafür (und gegen die Ansichten des Personalbetreuers der Deutschen Bank).
Anderer Ansicht sind natürlich zuweilen Modeschöpfer und der Handel: so war jetzt in der Tageszeitung ein Artikel zu lesen, wonach Männer keinesfalls mit kurzen Hosen durch die Stadt laufen können – so jedenfalls das Zitat eines Verkäufers.
Dieser Verkäufer arbeitet allerdings in einem Geschäft für Männerbekleidung, in dem meiner Kenntnis nach überhaupt keine kurzen Hosen verkauft werden. Außerdem fühlte ich mich in diesem Modeladen bei meinem letzten Besuch gemüßigt, den damals anwesenden Verkäufer zu fragen, ob er angesichts der langweiligen, dunklen und grauen Anzüge nicht unter Depressionen leidet. Ich sah überall nur Anzüge, von denen ich allenfalls einen für Beerdigungen gekauft hätte.
Taxifahrer protestieren: durch die von der Regierung im Rahmen der Gesundheitsreform geplante Streichung der Krankenfahrten fürchten die Taxi- und Mietwagenunternehmer um ihren Umsatz, teilweise sogar um ihre Existenz.
Gesundheitspolitisch macht dieser Reformpunkt bereits keinen Sinn, sondern zeugt von geringen Rechenkünsten der Politiker. Denn die Kranken sollen zukünftig alternativ in Rettungswagen zur Behandlung transportiert werden. Diese Fahrten sind jedoch erheblich teurer als die per Taxi.
Kostengünstiger wäre die Besinnung auf „die gute alte Zeit“ und die frühere Rolle der Familie. Damals sorgte die Familie für ihre Mitglieder, pflegte erkrankte und brachte sie zu Untersuchungs- und Behandlungsterminen.
Alljährlich und relativ regelmäßig messen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände ihre Kräfte bei Streiks, einem im Grunde recht sinnlosen Machtgehabe ohne nachhaltige Perspektiven.
Das Arbeitsrecht gehört natürlich zu den wesentlichen Elementen der modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft. Nur ein ausgewogenes und gerechtes Arbeitsrecht schafft soziale Gerechtigkeit und sozialen Frieden – nicht nur zwischen Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Kollegen. Daher muss das Arbeitsrecht der gesellschaftlichen Entwicklung, der Liberalisierung und Industrialisierung sowie der Globalisierung, insbesondere aber auch dem rasanten technischen Fortschritt, ständig durch Gesetzgebung und Rechtsprechung angepasst werden. Hierbei haben gerade die Gewerkschaften in den letzten Jahrzehnten eine durchaus wesentliche Rolle gespielt und nicht unerheblich dazu beigetragen, das lange zugunsten der (stärkeren) Arbeitgeber bestehende Ungleichgewicht zugunsten der Arbeitnehmer korrigieren. So weit, so gut.
Die gesellschaftlichen Entwicklungen verlangen jedoch eine zunehmend große Flexibilität der einzelnen Betriebe, weshalb die über die Jahre gewachsenen Tarifstrukturen nicht immer noch zeitgemäß erscheinen. Auf Betriebsebene können die Belange der jeweiligen Betriebe, ihrer Inhaber und ihrer Arbeitnehmer, weitaus angemessener berücksichtigt werden, als branchenumfassend zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften. Denn diese Verbände müssen grundsätzlich immer bundesweit die Interessen des ganzen Wirtschaftszweiges wahren – ohne dabei nach den einzelnen Betriebsgrößen und ihren entsprechend unterschiedlichen wirtschaftlichen Verhältnissen zu differenzieren. Folglich lassen sich zuweilen auf betrieblicher Ebene besser Lösungen entwickeln und umsetzen, die den Interessen aller Beteiligten gerecht werden – den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern.
Durch Arbeitskämpfe, Streiks und Aussperrungen, werden jedoch alljährlich Machtpositionen demonstriert, deren Kosten dadurch selbstprovoziert sind:
die Gewerkschaften fordern immer wieder Lohnerhöhungen in einer Höhe, von der sie wissen, daß sie von den Arbeitgebern als zu hoch abgelehnt werden – woraufhin dann der Streik ausgerufen wird.
Die Arbeitgeber ihrerseits bieten Lohnerhöhungen in einer Höhe an, von der sie wiederum wissen, daß sie von den Gewerkschaften als zu niedrig abgelehnt werden – woraufhin dann der Streik ausgerufen wird.
Durch derart starrköpfiges Verhalten sind vernünftige Lohnverhandlungen – also die gemeinschaftliche Erarbeitung allseits tragfähiger Lösungen – weder zu erwarten noch möglich.
Und die Folge überzogener Lohnanhebungen führt früher oder später zwangsläufig zu Entlassungen, weil die Arbeitgeber höhere (Lohn-) Kosten am effektivsten eben mittels Senkung der Lohnkosten – also durch Entlassungen – auffangen können. Oder aber durch steigende Preise, die dann aber gerade die eigenen Kunden treffen – die im übrigen auch immer wieder unter Streiks zu leiden haben.
Bei Tarifverhandlungen wären möglicherweise schneller bessere und auch kostengünstigere Ergebnisse zu erzielen, wenn die Verhandlungen von einem erfahrenen Mediator moderiert würden.
Mir ist leider keine Untersuchung bekannt, wie viel Arbeitsplätze durch Forderungen der Gewerkschaften während der vergangenen Jahre vernichtet wurden ... erst jüngst war der Presse die Ankündigung eines Handelsunternehmens zu entnehmen, eventuell ein Insolvenzverfahrens beantragen zu müssen – gleichwohl forderte die Gewerkschaft für die Mitarbeiter eben dieses Unternehmens eine Lohnerhöhung!
Und außerdem: fragen Sie doch mal Ihren Steuerberater, Ihren Arzt oder Rechtsanwalt, wann der Gesetzgeber dessen Honorarsätze in der jeweiligen Gebührenordnung zum letzten Mal angehoben hat, und wie oft überhaupt in den letzten Jahren!
Das Arbeitsrecht wird in der Regel als Sonderrecht der Arbeitnehmer definiert. Das mag daher kommen, dass es augenscheinlich die Rechte der Arbeitnehmer beinhaltet. Diesen Rechten stehen jedoch entsprechende Pflichten des jeweiligen Arbeitgebers gegenüber. Darüber hinaus bestehen selbstverständlich auch Rechte des Arbeitgebers – und entsprechende Pflichten des Arbeitnehmers. Daher lässt sich das Arbeitsrecht vielleicht treffender als das Recht der Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen fassen.
Kernstück des Arbeitsrechts ist der privatrechtliche Arbeitsvertrag. Durch ihn wird das einzelne Arbeitsverhältnis begründet, das eine Vielzahl von Rechten und Pflichten für beide Vertragsparteien mit sich bringt. Das Arbeitsverhältnis verpflichtet aber auch zu wechselseitiger Rücksichtnahme und sollte daher – entgegen der offenbar weit verbreiteten Ansicht – von keinem Vertragspartner als Über- und Unterordnungsverhältnis verstanden und gesehen werden.
Denn Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind gegenseitig voneinander abhängig und auf Zusammenarbeit angewiesen. Beide können – wirtschaftlich – dauerhaft nur existieren, wenn sie die Leistungen des anderen anerkennen und angemessen honorieren (in welcher konkreten Form auf immer). Nur ein verständiger Arbeitgeber, der auf seine Mitarbeiter, ihre Wünsche und Anregungen, eingeht, vermag diese langfristig zu motivieren. Und nur ein mit sich und seiner Arbeit zufriedener Arbeitnehmer ist produktiv und leistet auf Dauer gute Arbeit. Und nur gute Arbeit sichert die Wettbewerbsfähigkeit, den Fortbestand des Betriebes ... und somit die Arbeitsplätze von Arbeitnehmern und Arbeitgebern! – Ein Zusammenhang, der leicht und gern übersehen wird.
In diesem Zusammenhang stellt sich zwangsläufig die Frage der Gerechtigkeit, wenn die Gewerkschaften grundsätzlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit fordern. Denn wohl noch keine Gewerkschaft scheint darüber nachgedacht zu haben, daß es eine Frage der sozialen Gerechtigkeit ist, auch zu berücksichtigen, wie viel Personen von einem Einkommen leben (müssen) ... von einer Firma war einmal zu lesen, dass sie Mitarbeitern 500,- € monatlich zusätzlich zahlt, wenn sie drei oder mehr Kinder haben.
Der sprichwörtliche „Blick über den Tellerrand“ könnte vielleicht helfen: Immer wieder wird darüber diskutiert, das „Beamtentum“ gerade aus Kostengründen abzuschaffen. Bei aller – teilweise durchaus berechtigten – Kritik sollte das sogenannte „Alimentationsprinzip“ aber doch auch zum Nachdenken anregen: Danach hat der Staat seine Angestellten (eben die Beamten) finanziell so zu stellen, dass sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Die Beamten sollen eine Vergütung erhalten, von der sie – und ihre Familienangehörigen! – leben können.
Dementsprechend ist das Bundesbesoldungsgesetz ausgestaltet. Grundsätzlich setzt sich die Arbeitsvergütung des Beamten nämlich folgendermaßen zusammen:
Das Grundgehalt richtet sich nach der Besoldungsgruppe des dem Beamten verliehenen Amtes. Diese Besoldungsgruppen sind nach dem Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung geordnet, wonach die Funktionen der Beamten nach den mit ihnen verbundenen Anforderungen sachgerecht zu bewerten sind. Der Grundsatz „gleiches Gehalt für gleiche Arbeit“ wird hier berücksichtigt. Das Grundgehalt wird zudem nach Dienstaltersstufen bemessen – also sozusagen nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit.
Der Ortszuschlag gleicht die unterschiedliche Kaufkraft in den verschiedenen Städten und Regionen aus – die Lebenshaltungskosten sind eben nicht überall im Lande gleich hoch.
Ist ein Beamter verheiratet und/oder hat er unterhaltsberechtigte Kinder, erhält er entsprechende Zulagen. Hier bemisst sich das Einkommen des Beamten also auch danach, wie viel Personen von diesem Einkommen zu ernähren sind.
Im Falle seiner Erkrankung erhält der Beamte eine Beihilfe zu den Behandlungskosten.
Von seiner Pensionierung an erhält der Beamte eine Pension.
Verteilte man – gesamtvolkswirtschaftlich gesehen – das insgesamt vorhandene Geld nach den Grundsätzen des Besoldungsgesetzes unter allen Arbeitnehmern, wäre wohl „genug Geld für alle“ vorhanden. Warum aber werden zum Teil unverhältnismäßig hohe Gehälter für im Grund durchaus auswechselbare Mitarbeiter (in Führungspositionen) gezahlt?
Natürlich erfordert der Grundsatz der Gleichbehandlung gleichen Lohn für gleiche Arbeitsleistung. Aber familien- und sozialpolitisch sollte doch wohl ebenso berücksichtigt werden, dass es Arbeitnehmer gibt, die mit ihrem Einkommen nur ihren eigenen Lebensunterhalt bestreiten, während ein Kollege oder eine Kollegin mit dem gleichen Einkommen vielleicht eine vier- oder fünfköpfige Familie ernährt. Insoweit ist auch der Staat berufen – zum Beispiel über Steuern und Kindergeldzahlungen – hier einen unter dem so oft zitierten Stichwort der „sozialen Gerechtigkeit“ gebotenen Ausgleich zu schaffen: zum Beispiel im Rahmen der Einkommensteuer durch angemessen hohe Freibeträge nicht nur für jeden Arbeitnehmer selbst, sondern auch für seine ihm gegenüber unterhaltsberechtigten Angehörigen.
Unter Gerechtigkeit verstehen wir im allgemeinen, Gleiches gleich zu behandeln und Ungleiches ungleich, wobei die betreffenden (sachlichen) Unterschiede gleichermaßen Berücksichtigung finden sollen, um einerseits eine Willkür auszuschließen und andererseits insoweit trotzdem doch wieder eine Gleichbehandlung zu erreichen. Gerechtigkeit erfordert damit allerdings, die Wertmaßstäbe zu definieren. Und Bewertungen stellen – wie wir ja bereits erkannt haben – grundsätzlich subjektive Ansichten (Urteile) dar.
Doch Gerechtigkeit führt durchaus nicht immer auch zu einer Zufriedenheit. Eine „gerechte“, weil gleiche Behandlung erfüllt eben nicht zwangsläufig die Bedürfnisse der Beteiligten. Betrachten wir als Beispiel zwei Arbeitnehmer, die die gleiche Arbeit verrichten. Nach dem von den Gewerkschaften geforderten Grundsatz (der Leistungsgerechtigkeit) erhalten sie für ihre gleiche Arbeit auch beide den gleichen Lohn, von dem beide zunächst einmal auch die gleichen Steuern zahlen müssen. Das mag soweit „gerecht“ sein. Doch nun bedenken wir weiter (zur sozialen Gerechtigkeit):
Der eine Arbeitnehmer lebt allein. Er muß von seinem Verdienst nur seine kleinere Wohnung und den Lebensunterhalt (Lebensmittel, Bekleidung, …) für sich selbst bezahlen. Er geht am Wochenende aus (ins Kino, Theater, Restaurant …) und hat am Ende jedes Monats doch immer noch einen Betrag übrig, den er sparen kann (z. B. für seinen nächsten Urlaub, ein neues Auto oder eine zusätzliche Altersvorsorge).
Der andere Arbeitnehmer dagegen hat eine Familie, eine Frau und Kinder (spätere Rentenbeitragszahler). Er muß für seine Familie eine viel größere und damit teurere Wohnung finanzieren und sein doch gleich hohes Einkommen muß zudem für den Lebensunterhalt von mehreren Personen reichen. Am Ende jedes Monats hat er sein Einkommen ausgegeben.
Meinen Sie, daß sich diese Arbeitnehmer beide gerecht behandelt fühlen? Werden sie beide gleichermaßen glücklich und zufrieden sein? Und wie sieht es mit ihrer Wertschätzung aus?
Werden sich die beiden Arbeitnehmer unseres Beispiels gerecht(er) behandelt fühlen, wenn ihre jeweiligen Bedürfnisse gleichermaßen erfüllt werden? Davon ausgehend, daß alle Bedürfnisse gleichwertig sind … kann (muß) hier nicht das Steuerrecht für einen sozial betrachtet „gerechten“ Ausgleich sorgen (einen denkbaren Lösungsansatz hatte ich in meinem Buch „Und Sie? Wie denken Sie darüber ...“ bereits vorgeschlagen)?
Und wie gerecht und gleichbehandelt werden sich die Kinder des zweiten Arbeitnehmers fühlen, wenn sie nach ihrem Schulabschluß studieren wollen und sich das Geld für das Studium nebenbei selbst verdienen müssen …
gegenüber anderen Studenten, deren Eltern ein höheres Einkommen haben und ihren Kindern das Studium bezahlen können, die sich dafür ganz ihrem Studium widmen können?
gegenüber Auszubildenden, die keine den Studiengebühren vergleichbaren Schulgebühren für ihre Berufsschule zahlen müssen, dafür aber sogar noch eine Ausbildungsvergütung erhalten?
Gerecht ist eben nicht immer gleich gerecht, die Chancengleichheit nicht immer gleich und das alte Sprichwort bestätigt sich immer mal wieder, wonach manche eben gleicher sind.
Außerdem könnten die Gewerkschaften vor Lohntarifverhandlungen ihre Forderungen bedenken. Wenn sie eine zum Beispiel 5-prozentige Lohnerhöhung verlangen, bedeutet dies:
Ein Arbeitnehmer mit einem Lohn in Höhe von 1.000,- € bekäme dann monatlich 50,- € mehr (1.050,- €), ein Kollege mit 1.500,- € erhielte einen um 75,- € höheren Lohn (1.575,- €).
Nach der nächsten Lohnrunde mit wiederum 5 % Lohnerhöhung hätten die Arbeitnehmer monatlich 52,50 € beziehungsweise 78,75 € mehr Lohn (1.102,50 € bzw. 1.653,75 €). Der Kollege mit dem 1,5-fachen Lohn hat somit nicht den gleichen, sondern einen rund 1,5-fachen Lohnzuwachs (153,75 € gegenüber 102,50 € des Kollegen).
Natürlich ist diese prozentuale Lohnerhöhung nicht grundsätzlich ungerecht. Aber vielleicht wäre eine Lohnerhöhung um einen gleichen, festen Betrag für jeden Arbeitnehmer auch nicht ungerecht? Die „Lohnschere“ zwischen den sogenannten weniger und den sogenannten besser Verdienenden klaffte dann nicht immer zunehmend weiter auseinander.
Andererseits sollte freilich ebenso manch ein Arbeitgeber über die von ihm angebotenen Gehaltszahlungen nachdenken. Vor allem, soweit im öffentlichen Dienst Zahlungen erfolgen, die den Arbeitnehmer berechtigen (richtiger: nötigen), noch Leistungen zur Sicherung seines Lebensunterhaltes zu beziehen, dürfte das Alimentationsprinzp wohl keine Beachtung finden.
Gerechtigkeit ist also wohl immer relativ. Vielleicht ist es aber gerade deshalb viel wichtiger, daß die Bedürfnisse des Einzelnen gestillt werden. Denn wer mit sich und seinem Leben zufrieden ist, kaum Bedürfnisse hat oder sich diese jedenfalls erfüllen kann, ist auch friedfertig.
Und das nicht nur im Kleinen. Auch auf den Frieden weltweit hat es sicherlich Einfluß, wie zufrieden die Menschen sind. Denn persönliche Unzufriedenheit, die natürlich auch aus empfundenen Ungerechtigkeiten oder Ungleichbehandlungen resultieren kann, führt zu Vergleichen mit anderen, denen es – vermeintlich – besser geht. Und das schafft Konfliktpotenzial.
Das Bedürfnis nach Frieden dürfte wohl ohnehin allen Menschen gemeinsam sein. Vielleicht ist es neben den lebensnotwendigen Grundbedürfnissen nach Wasser und Nahrung sogar eines der allen Menschen „gemeinsamsten“ Bedürfnisse. Denn wer nicht in Frieden leben kann, kann wohl auch kaum wirklich glücklich sein und sich wohl fühlen.
Selbst von Kriegsopfern und Hinterbliebenen ist immer wieder zu vernehmen, daß auch sie keine Rache oder Vergeltung wollen, sondern Versöhnung und Frieden. Und traumatisierte Kriegsveteranen sind noch lebende Zeitzeugen dafür, daß Menschen nicht für den Krieg „gemacht“ sind.
Krieg dagegen scheint doch eher von den Machthabern gewollt, die sich aus ihren – politischen, wirtschaftlichen und/oder religiösen – Gründen ihr Bedürfnis (ihre Sucht) nach Macht und/oder Geld erfüllen wollen und dabei weniger auf die Bedürfnisse ihrer Bürger achten. Dabei wären diese Machthaber eher machtlos, wenn sich die Bürger auf ihre eigenen Bedürfnisse konzentrieren würden, statt „ihren“ Machthabern deren Bedürfnisse erfüllen zu wollen ... Erinnern Sie sich noch an den Spruch
„Stell Dir vor, es ist Krieg, und keiner geht hin.“?
Vielleicht sollten wir heutzutage umdenken. Treffender wäre vielleicht die Aussage:
„Stell Dir vor, es ist Frieden! Und alle machen mit.“
Und daß sich Völker mit ihrem Bedürfnis nach Freiheit nicht dauerhaft unterdrücken oder gar unendlich lange einsperren lassen, zeigt auch und gerade die (ost-) deutsche Vergangenheit.
Machthaber täten vermutlich gut daran, die Leserbriefe in den Tageszeitungen zu ihrer Pflichtlektüre zu wählen. Denn Leserbriefe spiegeln im allgemeinen recht gut die Bedürfnisse der Bürger wieder, ihre Sorgen, Ängste und Nöte.
Auch sind hier Verallgemeinerungen wohl zu oft fehl am Platz. Immer wieder berichten die Medien von „angespannten Verhältnissen“ oder „politischen Spannungen“ zwischen verschiedenen Ländern. Ich frage mich dann immer, welches Verhältnis denn eigentlich angespannt sei: das der Bürger oder das der Staatsführungen? Oder sind derartige Behauptungen sogar Erfindungen der Rüstungsindustrie zur Rechtfertigung ihrer Produktionen?
Mir fällt dazu ein Interview mit Altkanzler Gerhard Schröder ein, der über recht persönliche Begegnungen mit freundlichen und den Deutschen gegenüber aufgeschlossenen Russen erzählte …





























