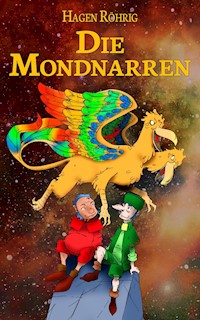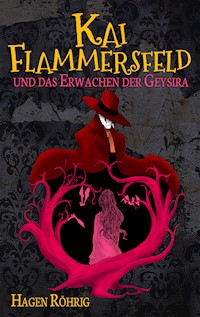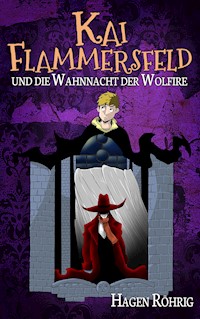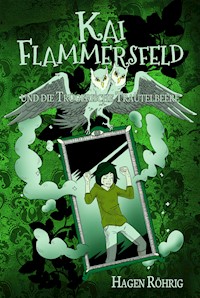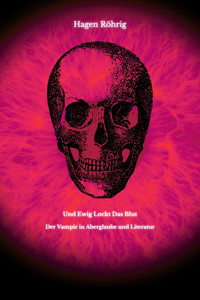
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vampire! Seit Jahrhunderten faszinieren sie die Menschen und jagen ihnen zugleich Angst und Schrecken ein. Doch was steckt eigentlich hinter dem Glauben an die Wiedergänger? Wie lassen sich Erscheinung und Verhalten des Vampirs erklären? Hagen Röhrig fühlt den Untoten auf den Zahn. Er lüftet die Geheimnisse des folkloristischen Vampirs und vergleicht ihn mit seinen Brüdern und Schwestern aus der Literatur. Denn von den Gräbern Osteuropas bis in die Schauergeschichten Stokers oder Polidoris hat der untote Wiedergänger vielschichtige Bedeutungsebenen hinzugewonnen. Den Schwerpunkt bildet hierbei Bram Stokers Klassiker Dracula.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Und Ewig Lockt Das Blut
DER VAMPIR IN ABERGLAUBE UND LITERATUR
HAGEN RÖHRIG
Impressum
© 2022 Hagen Röhrig
c/o Altina GmbH
Schlettstadter Straße 16
68229 Mannheim
http://www.hagenroehrig.de
Alle Rechte vorbehalten
Diese Abhandlung basiert auf der Magisterarbeit „Jahrhundertwende der Vampire. Die Aktualisierung eines Aberglaubens in Bram Stokers Dracula“, Hagen Röhrig, 1996
Für meine Eltern
Inhalt
Einleitung
1. Der Vampir im Aberglauben
Der Vampir als Figur des Aberglaubens in Osteuropa
Wer wird Vampir?
Die Erscheinung des Vampirs
Abwehr- und Tötungsmethoden
2. Deutungsversuche der Vampirfigur des Aberglaubens
Der Vampirismus und die Religionen
Der Vampir und die Chemie des Todes
Psychologischer Erklärungsversuch
Die Sexualität des Vampirs
3. Der Vampir in der Literatur: Bram Stokers Dracula
Die literarischen Vorgänger Draculas und ihr Einfluß auf Stokers Roman
Außerliterarische Einflüsse auf Dracula
4. Die Untoten in Stokers Roman: Die Konzeption Des Vampirs Dracula und seiner Gefährtinnen
5. Bedeutungsebenen in Bram Stokers Dracula
Die Vampire und ihre Funktion als Schauergröße
Die religiöse Bedeutungsebene
Die psychologische Dimension Draculas
Kiss me with those red lips
Life is all I want
Gesellschaftliche Kritik in Stokers Dracula
Die 'New Woman'
Die Bewertung der sozialen Klassen
Leaving the West and Entering the East: Die politische Dimension in Dracula
Triumph von Technik und Fortschritt?
6. Draculas Nachfahren: Der Vampir im 20. Jahrhundert
7. Zusammenfassung
Literatur
Anmerkungen
Autor
Einleitung
Im Jahr 1997 feierte der wohl berühmteste aller Vampire - Graf Dracula - einen runden Geburtstag: Er wurde 100 Jahre alt. Bram Stokers Roman Dracula erschien 1897 und war seither zumindest in Großbritannien nie 'out of print'. Manche Wissenschaftler sagen sogar, es sei "[...] nach der BIBEL das meist verkaufte Buch der Welt [...]"1. Dies mag vielleicht übertrieben sein, doch trifft es sicherlich zu, dass der untote Graf zum Prototyp des Vampirs geworden ist.
Eine Abhandlung über Vampire. Sicherlich ist dies immer noch kein alltägliches Thema, auch wenn seit den 1970er Jahren vermehrt über die Blutsauger geschrieben wird. Nicht zuletzt die auf Horror und Sadismus reduzierten Verarbeitungen des Vampirmotives, die vor allem auf Bram Stokers Roman Dracula basieren, haben dazu beigetragen, dass den Vampirgeschichten und -filmen der Hauch der Zweitklassigkeit anhaftet. Oft zurecht, wenn man sich beispielsweise an die Vampirfilme der britischen Hammer-Production erinnert, in denen Christopher Lee die Rolle Graf Draculas verkörperte. Bis auf den ersten Teil dieser Vampirfilmreihe, der sich eng an Bram Stokers Buch hielt und auch dessen Name trägt, lassen die Fortsetzungen, wie etwa Dracula jagt Mini-Mädchen oder Frisches Blut für Dracula, die verschiedenen Sinnebenen der ursprünglichen Dracula-Geschichte Stokers vermissen. Für die meisten von uns ist der Vampir durch diese und andere Verarbeitungen des Sujets zu einem reinen Horrorwesen verkommen, das kaum eine tiefere Bedeutung hat und einzig und allein seine Existenzberechtigung in Literatur und Film daraus bezieht, uns zu erschrecken und das Gruseln zu lehren. Aber der Vampir ist mehr. Viel mehr.
Die Absicht dieses Buches ist es, die Figur des Vampirs tiefer zu beleuchten und seine ihm inhärenten Bedeutungsebenen aufzuzeigen. Dazu bedarf es einer groben Zweiteilung der zu untersuchenden Bereiche. Zum einen muss der Vampir als Figur des Aberglaubens genauer betrachtet werden, denn hier liegen seine Ursprünge und von hier aus eroberte er sich seinen Platz in der Literatur und in den anderen Kunstformen. Zum anderen soll dann gezeigt werden, wie das Vampirmotiv in der Literatur Verwendung fand. Hierfür wird, wie weiter oben bereits angesprochen, der wohl bekannteste Vampirroman herangezogen: Bram Stokers Dracula. Dementsprechend widmet sich das folgende zweite Kapitel dieser Arbeit zunächst dem Vampir des Volksglaubens. Es wird darauf eingegangen, wer potentiell als Vampir enden kann und wie sich die Menschen des Balkans den Vampir vorstellten. Daran schließt sich ein Abschnitt über Abwehr- und Tötungsmechanismen an. In diesen Kapiteln wird bereits deutlich werden, dass der Vampirismus des Volksglaubens einen wesentlich differenzierteren Charakter aufweist, als es die Klischeevorstellungen erwarten lassen. Mit den Abschnitten über die Deutungsversuche der Vampirfigur taucht das Buch dann ein in die medizinisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen, die zu einem solchen Aberglauben geführt haben könnten, sowie in die psychogenen und sexualpsychologischen Erklärungsversuche. In diesem Zusammenhang wird auch auf den großen Einfluß der Kirchen einzugehen sein, der deutliche Spuren im Glauben an die Vampire und sogar in der Figur der Untoten selbst hinterlassen hat.
Das dritte Kapitel wendet sich dann dem literarischen Vampir zu. Auf den zu besprechenden Roman Dracula hinarbeitend, werden zunächst dessen literarische Vorgänger sowie deren Einflüsse auf diesen Roman vorgestellt. Schließlich soll versucht werden, die Bedeutungsebenen des Vampirmotives im Roman aufzuzeigen. Trotz einiger Überschneidungen mit den Sinnebenen des Vampirs aus dem Aberglauben stößt man hier auf Modifizierungen des Sujets, die Stoker bewusst in seinen Roman einbaute um so, mit Hilfe der Vampirfigur, beispielsweise Sozial- und Gesellschaftskritik zu üben.
Obwohl Dracula sicherlich ein Höhepunkt des Sujets sein dürfte, hört die Verarbeitung des Vampirmotives nach 1897 nicht auf. Das junge Medium Film nimmt sich der Untoten an, und ebenfalls in der Literatur spielt der Vampir weiterhin eine Rolle, wenn das Sujet auch bis Anne Rices Interview With the Vampire (1976) und - im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur - Angela Sommer-Bodenburgs Der kleine Vampir (1979) warten muss, bis es einen neuen Höhepunkt erreicht. Diesem Themenkomplex ist das abschließende Kapitel gewidmet, das die Betrachtung des Vampirmotives abrunden soll.
ABGRENZUNG UND DEFINITION
Wie schon die Auswahl des Romans Dracula für diese Untersuchung zeigt, beschränkt sich die Betrachtung des Vampirmotives hier auf die tatsächliche, blutsaugende Figur des Vampirs. Geschichten, in denen Charaktere lediglich vampiristische Züge aufweisen, wie zum Beispiel Edgar Allan Poes Ligeia, werden im Rahmen dieser Arbeit nicht herangezogen. Auch im Bereich des Vampirs aus dem Volksglauben sind Eingrenzungen vorgenommen worden. Ist der Vampirismus auch ein weltweit auftretendes Phänomen, ist es nicht möglich, hier auf alle Ausprägungen dieses Aberglaubens einzugehen. In Anlehnung an den in weiten Teilen in Transsilvanien situierten Roman Dracula wird die Ausformung des Vampirismus besprochen, wie sie auf dem Balkan vorherrscht.
Eine genaue Definition der Vampirfigur ist ausgesprochen schwierig. Für die Großzahl der Vampire, die in der Literatur des 19. Jahrhunderts auftreten, trifft die Definition von Margaret L. Carter zu. Sie definierte den Vampir als
[...] a reanimated corpse that sustains its immortality by feeding on blood, and, in doing so, drains the victim`s life force and transforms the victim into a likeness of itself.2
Die literarischen Vampire des 20. Jahrhunderts werden dieser Definition nicht immer gerecht. Die Vampire der Autorin Anne Rice beispielsweise nehmen ihren Opfern nicht unbedingt das Leben und machen sie mit einem Angriff auch nicht zwangsläufig zu einem der Ihren. Vielmehr bedarf es einer willentlichen Entscheidung auf Seiten des Vampirs, um sein Opfer zu einem Untoten werden zu lassen. Auch weist Rice ihren Blutsaugern Attribute zu, die sie mehr scheinen lassen als 'reanimated corpses'. Mit eigener Geschichte, Hierarchie und zum Teil strengen Gesetzen, die das Zusammenleben bestimmter Vampirgruppen regeln, erscheinen sie eher als eine eigene Spezies. Dennoch trifft Carters Definition sicherlich auf die meisten Vampire der Literatur zu.
Die Etymologie des Wortes 'Vampir' ist nicht eindeutig geklärt. Es ist wahrscheinlich russischen (upyr - Hexe) oder türkischen (uber - Hexe) Ursprungs und über das Französische oder das Deutsche in die englische Sprache eingeführt worden.3 Dort erscheint es zum ersten Mal im London Gentleman`s Magazine vom Mai 1732 in Anspielung auf eine allegorische Bedeutung:
This Account, of Vampyres, you`ll observe, comes from the Eastern Part of the World, always remarkable for its Allegorical Style. The States of Hungary are in subjection to the Turks and Germans, and govern`d by a pretty hard Hand; which obliges them to couch all Complains under Figures. This Relation seems to be of the same kind.4
Mit den aufkommenden Berichten über angebliche Vampirvorfälle aus den serbischen Gebieten Österreich-Ungarns und den östlichen Teilen Deutschlands wächst das Interesse an den Vampiren im 18. Jahrhundert stark an und schlägt sich schließlich in ersten literarischen Zeugnissen nieder.
Der Vampir im Aberglauben
DER VAMPIR ALS FIGUR DES ABERGLAUBENS IN OSTEUROPA
Am 26. Januar des Jahres 1732 verfasste Johannes Fluchinger1 in Nürnberg seinen Bericht Visum et Repertum - Über die so genannten Vampirs, oder Blut-Aussauger, so zu Medvegia in Servien, an der Türckischen Granitz, den 7. Jaunuarii 1732 geschehen. In diesem Bericht protokollierte Fluchinger eine Untersuchung, die er auf Grund angeblicher Vampirangriffe in dem Dorf Medvegia im Auftrag des österreich-ungarischen Oberkommandos durchführte. Seine Aufzeichnungen geben in medizinischer Genauigkeit ein Bild angeblicher Vampirleichen wieder, beginnen jedoch mit einer Erzählung, die Fluchinger von den örtlichen Heyducken2 vernommen hatte.
Der Heyduck Arnold Paole hatte sich fünf Jahre zuvor den Hals gebrochen und galt der Bevölkerung des Dorfes als erster Vampir, der für eine Vampirepidemie verantwortlich war. Schon zu Lebzeiten hatte Paole verlauten lassen, dass er
[...] bei Gossowa in dem Türckischen Servien von einem Vampir geplagt worden sey, dahero er von der Erde des Vampirs Grab gegessen, und sich mit dessen Blut geschmieret habe, um von der erlittenen Plage entledigt zu werden.3
Über die Exhumierung und Vernichtung des Vampirs Paole wird Fluchinger von den Heyducken berichtet, dass
[...] er gantz vollkommen und unverwesen sey, auch ihm das frische Blut zu den Augen, Nasen, Mund und Ohren herausgeflossen, das Hemd, Übertuch und Truhe gantz blutig gewesen, die alte Nägel an Händen und Füssen samt der Haut abgefallen, und dargegen neue andere gewachsen sind, weilen sie nun daraus ersehen, dass er ein würcklicher Vampir sey, so haben sie demselben nach ihrer Gewohnheit einen Pfahl durchs Hertz geschlagen, wobey er einen wohlvernehmlichen Gächzer gethan, und ein häuffiges Geblüt von sich gelassen; Wobey sie den Cörper gleich selbigen Tag gleich zu Asche verbrennet, und solche in das Grab geworffen. Ferner sagen gedachte Leute aus, dass alle diejenige, welche von denen Vampirn geplaget und umgebracht würden, ebenfalls zu Vampirn werden müssen.4
Der weitere Bericht widmet sich den Obduktionen, die Fluchinger an den vermeintlichen Opfern Paoles vornahm. Von besonderem Interesse sind hierbei Fluchingers Aussagen zu drei der von ihm untersuchten Vampirleichen. So schreibt er über die nach einer dreitägigen Krankheit verstorbene Stana:
Der Uterus aber befande sich gantz groß, und externe sehr inflammiret [...] Die Haut an Händen und an Füssen, samt den alten Nägeln fielen von sich selbst herunter, hergegen zeigten sich nebst einer frischen und lebhafften Haut, gantz neue Nägel.5
Über die nach einer Krankheit von drei Monaten Dauer gestorbene Miliza heißt es:
In der Brust befande sich viel liquides Geblüt [...] Es haben sich bey der Secirung die umstehende sämtliche Heyducken über ihre Fette und vollkommenen Leib sehr verwundert, einhellig aussagend, dass sie das Weib von ihrer Jugend auf wohl gekannt, und Zeit ihres Lebens gantz mager und ausgedörrter ausgesehen und gewesen, mit nachdrücklicher Vermeldung, dass sie in dem Grab zu eben dieser Verwunderungs-würdigen Fettigkeit gelanget sey [...].6
Schließlich die Beschreibung der Stanoicka, die drei Tage lang an einer Krankheit gelitten hatte und letztlich an ihr starb:
Bey der Secirung habe ich gefunden, dass sie in dem Angesicht gantz roth und lebhaffter Farb ware [...] bey Herausnehmung ihres Grabes flosse eine Quantität frisches Geblüts aus der Nasen; Nach der Secirung fande ich, wie schon offt gedacht, ein rechtes balsamlich frisches Geblüt, nicht allein in der Höhle der Brust [...] die Unter-Haut des ganzen Cörpers samt denen frischen Nägeln an Händen und Füssen, waren gleichsam gantz frisch. Nach geschehener Visitation seynd denen Vampiren die Köpffe durch die dasige Zigeuner herunter geschlagen worden, und samt denen Cörpern verbrennet, die Aschen davon in den Fluß Morava geworffen [...].7
Die hier vorgestellten Auszüge aus Fluchingers Bericht bergen für den modernen Leser des einundzwanzigsten Jahrhunderts bekannte wie auch seltsam anmutende Fakten. Aus Literatur und Film ist das Bild des armseligen Vampiropfers, das letztlich selbst zum Vampir werden muss, ebenso bekannt wie das frische Blut, das dem Vampir aus seinem Mund rinnt oder das Pflöcken der Untoten.
Anderes, von dem uns Fluchinger berichtet, erscheint skurril, wenn nicht gar unheimlich: Das Vampiropfer Paole schmiert sich mit dem Blut des Wiedergängers ein und isst Erde von dessen Grab, den Vampirleichen wachsen Haare und neue Nägel, die Haut erneuert sich und ihre Körper werden fetter.
Der heutige Leser von Vampirliteratur hat bestimmte Vorstellungen über die Untoten, die hauptsächlich durch Bram Stokers Dracula sowie seine literarischen Vorgänger geprägt sind.8 Eine vornehme Herkunft und hochgewachsene Statur gehören dabei ebenso zum Repertoire wie der schwarze, manchmal fledermausflügelartige Umhang, der Blutdurst und die scharfen, spitzen Eckzähne. Doch wenn der literarische Vampir auch einiges mit seinen Brüdern im Aberglauben gemein hat, so gibt es gleichwohl große Unterschiede zwischen ihnen. Allgemein läßt sich festhalten, dass die Vampirfigur der Literatur eine Reduzierung ihrer ehemaligen abergläubischen Inhalte erfahren hat. Da sie jedoch ihre Wurzeln in dem Untoten des Volksglaubens hat und viele ihrer Charakteristika und typischen Attribute auf die Verwandten aus dem Aberglauben zurückgehen, soll im folgenden Abschnitt der Vampir des Aberglaubens deutlicher vorgestellt werden.
WER WIRD VAMPIR?
Grundsätzlich lassen sich vier Kategorien unterscheiden, nach denen eine Person zum Vampir werden kann. In die erste Kategorie fallen Menschen, die durch ihren Lebensstil oder ihre Todesart gefährdet sind.9 Hierzu gehören Räuber, gottlose Leute (worunter auch Andersgläubige, das heißt Nichtchristen, fallen), Prostituierte, allgemein unehrenhafte Menschen und solche, die anders waren, als es die sozialen Normen gestatteten. Selbstmörder sowie Epedemie- und Mordopfer gehören wegen ihrer Todesarten ebenfalls in diese Gruppe.10
In der zweiten Kategorie finden sich Personen, die auf Grund bestimmter Zeichen und einer Vorherbestimmung ohne eigenes Verschulden nach ihrem Tode zu Vampiren werden müssen. Besonders Kinder, die mit irgendwelchen Abnormalitäten geboren wurden, waren hiervon betroffen. Haarwuchs am Rücken, eine schwanzartige Erweiterung des Steißbeins, bereits bei der Geburt vorhandener Zahnwuchs und andere als 'tierisch' angesehene Erscheinungen machten sie ebenso verdächtig wie die Geburt mit einem roten Glückshäubchen11. Gefährlich war es auch, das uneheliche Kind unehelicher Eltern zu sein12, und Kinder, die an heiligen Tagen gezeugt oder tot geboren wurden, galten ebenfalls als Vampirkandidaten.13
Vampiranzeichen zeigten sich auch im Verhalten eines Menschen. Wenn eine Schwangere kein Salz aß, wurde ihr Kind ein Vampir. Ein Mann, der keinen Knoblauch mochte, machte sich ebenfalls des Vampirismus` verdächtig.14
Nach rumänischem Glauben waren es Menschen dieser ersten beiden Kategorien, die auch schon zu Lebzeiten als Vampire umgehen konnten. Ihre Seele verließ sie des Nachts, manifestierte sich in schrecklich aussehenden (Tier)Gestalten und trieb ihr vampirisches Unwesen. Morgens kehrte sie wieder zu ihrem Körper zurück.15 Hiergegen konnte die betroffene Person nichts ausrichten. Andererseits waren potentielle Vampire ihrem Schicksal auch nicht hilflos ausgeliefert: Wie das Beispiel Paoles zeigt, galt das Blut eines Vampirs als Abwehrmittel gegen den drohenden Vampirismus. Es wurde auf die Haut aufgetragen oder zusammen mit einem Stück des Leichentuchs in Alkohol getrunken.16 Eine Zauberformel konnte Kinder, die mit einem roten Glückshäubchen geboren worden waren, vor ihrem Schicksal bewahren. Sie galten dann fortan als Glücksbringer. 17
In der dritten Kategorie versammeln sich Ereignisse, die den Menschen zustoßen konnten. Hierunter fällt der Biss eines Vampirs. Ist dieses Bild aus der Welt der Literatur auch berühmt und in einer Vampirgeschichte unerlässlich, so fehlt eben gerade dieses für uns wohl vampirtypischste Attribut im Aberglauben recht häufig. Bei vielen Völkern plagt und würgt der Vampir seine Opfer im Schlaf und wenn er ihr Blut saugt, beißt er vornehmlich im Brustbereich, nah des Herzens, am Kehlkopf oder zwischen den Augen.18 Gefährlich war es auch, vom bösen Blick eines Vampirs getroffen zu werden. Deshalb wurden nach dem Tod eines potentiellen Wiedergängers schnell dessen Augen geschlossen19. Speziell in der Moldau konnte es auch geschehen, dass der böse Geist Drakul Leichen am Leben erhielt und sie so zu einer Existenz als Vampir verdammte.20
Vornehmlich an Verstorbenen unterlassene Pflichten bilden schließlich die letzte der Kategorien, nach denen ein Mensch zum Vampir werden konnte. Blieben Verstorbene bis zu ihrer Beerdigung unbewacht, konnte dies verheerende Folgen haben. Kein Tier durfte eine Leiche überspringen oder überfliegen. Geschah dies doch, konnte der Vampirismus nur von dem Toten genommen werden, indem das Tier gezwungen wurde, den gleichen Weg zurückzugehen oder zurückzufliegen.21 Wurde es einem Mann ermöglicht, sexuellen Kontakt zu einer Leiche zu haben, wurde diese ebenso zum Vampir22, und gleichwohl wenn ihr der Mund oder das linke Auge offenstanden.23 Gefährlich war es auch, wenn jemand mit schlechtem Gewissen oder ohne die Sterbesakramente verschied. Gleiches galt für diejenigen, die ihren Tod auf den Schlachtfeldern oder in Epedemiezeiten fanden: Hier war es oft nicht möglich, alle Toten- und Beerdigungsriten ordnungsgemäß durchzuführen.24
DIE ERSCHEINUNG DES VAMPIRS
In diesem Abschnitt soll der Frage nachgegangen werden, wie man sich den Vampir des Volksglaubens vorzustellen hat. Zwar herrschen diesbezüglich in den einzelnen europäischen Regionen unterschiedliche Auffassungen, doch kann hier auf Verallgemeinerungen zurückgegriffen werden, die auf die meisten Vampire zutreffen.
Relativ einheitlich wird die äußere Erscheinung des Vampirs beschrieben: er ist meistens männlich25, hat eine mollige bis plumpe Statur und eine neu gewachsene Haut, die eine rötlich bis schwarze Färbung aufweist. Seine Haare sind seit seiner Beerdigung gewachsen, ebenso seine Fingernägel. Der Körper des Vampirs ist unverwest, schwer zu tragen, weist keine Leichenstarre auf und ist, sofern er Blut saugt, angefüllt mit dem Lebenssaft seiner Opfer, der ihm teilweise aus den Körperöffnungen herausrinnt.26
Ebenfalls einheitlich - wenn man vom rumänischen Glauben an den lebenden Vampir einmal absieht - ist die Vorstellung vom Vampir als nachtaktivem Wesen, das tagsüber in seinem Grab bleiben muss. Als umherziehende Irrlichter oder Flammen sind die Vampire des Nachts zu erkennen, und ihre größte Macht erreichen sie in der Nacht vor St. Georg, St. Andreas sowie vor Himmelfahrt.27 Zum ersten Hahnenschrei müssen sie wieder in ihre Gräber zurück.28
Auf ihren nächtlichen Streifzügen durch die Dörfer suchen die Untoten vornehmlich Verwandte heim, in erster Linie ihre Ehepartner.29 Bei solchen Besuchen kommt es nicht unbedingt dazu, dass der Vampir den Lebenden das Blut aussaugt, vielmehr plagt er, isst Vorräte auf, erschreckt, tötet Mensch und Vieh oder lärmt herum. Saugt er Blut, so geschieht dies nicht zwangsläufig im Halsbereich, und er benutzt auch nicht nur die in unserer Vorstellung nötigen spitzen Eckzähne dazu.30 Mancherorts sticht der Vampir mit seiner spitzen Zunge, um an den begehrten Lebenssaft zu gelangen.31 Die aus vielen Geschichten bekannte Fähigkeit des Vampirs, sich fliegend fortzubewegen, ist im Aberglauben so gut wie unbekannt. Mannhardt berichtet über diese Eigenschaft, ansonsten bleibt sie unerwähnt.32 Er führt auch an, dass die Vampire für viele Epidemien verantwortlich gemacht wurden, so zum Beispiel für die Pest in Preußen (1343) und in Polen (1572).33 Um sich dieser Epidemien zu entledigen, musste der Vampir gefunden und vernichtet werden.