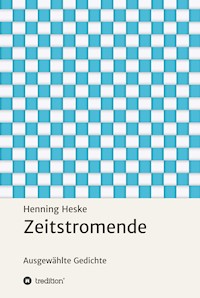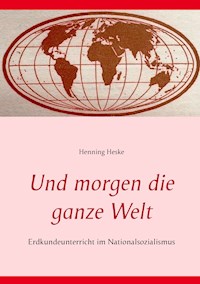
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch fördert eine Fülle von Material ans Licht, das auf eindrucksvolle Weise belegt, dass die übereifrig betriebene "Anpassung" des Erdkundeunterrichts an den Nationalsozialismus weit mehr war, als "nur" eine Anpassung. Auf der Grundlage der NS-Ideologie entwickelten Erdkundelehrer und Fachdidaktiker einen vornehmlich auf Indoktrination ausgerichteten Geografieunterricht, in dessen Zentrum eine neuartige "völkische Lebensraumkunde" stand, die sich auf eine "Blut und Boden"-Heimatkunde gründete und Rassenkunde, Geopolitik, Kolonialgeographie sowie Wehrgeographie phasenweise miteinander verknüpfte. "Heske hat eine Fülle unterschiedlichsten Materials intensiv durchgearbeitet und eine klug gegliederte, zitatenreiche und dennoch zugleich straff ausformulierte Studie vorgelegt. Er darf in der Tat für sich in Anspruch nehmen, eine überfällige Lücke in der Geschichte der Pädagogik und in der Geschichte der Geographie geschlossen zu haben." (Hans-Dietrich Schultz, Westfälische Forschungen)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1 Einleitung
1.1 Einordnung des Themas
1.2 Fragestellung der Untersuchung
1.3 Quellen und Methoden
2 Theoretische Vorüberlegungen
2.1 Wissenschaftstheoretische Vorüberlegung
2.2 Faschismustheoretische Vorüberlegung
2.3 Schultheoretische Vorüberlegung
3 Stellung und inhaltliche Konzeption des Erdkundeunterrichts nach der Preußischen Schulreform von 1925 und die Entwicklung bis 1933
3.1 Die Aufwertung des Erdkundeunterrichts durch die Preußische Schulreform von 1924/25
3.2 Die fachdidaktische Diskussion in der Weimarer Republik von 1925 bis 1933
4 Organisation und Aktivitäten der Reichssachgebiete Erdkunde und Geopolitik im Nationalsozialistischen Lehrerbund (NSLB)
4.1 Aufbau und Geschichte des NSLB
4.2 Organisation des Reichssachgebietes Erdkunde im NSLB
4.2.1 Entstehung und Entwicklung des Reichssachgebietes Erdkunde
4.2.2 Das Verbandsorgan „Geographischer Anzeiger“
4.2.3 Die Reichssachbearbeiter für Erdkunde
4.2.3.1 Albrecht Burchard (1934-1939)
4.2.3.2 Friedrich Knieriem (1940-1944)
4.3 Organisation des Reichssachgebietes Geopolitik im NSLB
4.3.1 Entstehung und Entwicklung des Reichssachgebietes Geopolitik
4.3.2 Der Reichssachbearbeiter für Geopolitik: Johann Ulrich Folkers (1938-1943)
4.4 Aktivitäten der Reichssachgebiete Erdkunde und Geopolitik 142
4.4.1 Schulung
4.4.2 Schulgeographentage
4.4.3 Lehrplanentwürfe
4.4.4 Begutachtung pädagogischen Schrifttums
5 Inhaltsanalyse der beiden fachdidaktischen Zeitschriften „Geographischer Anzeiger“(1925-1944) und „Zeitschrift für Erdkunde“(1933-1944)
5.1 Stellung und Geschichte beider Zeitschriften
5.2 Bedingungen für die Zeitschriftenherausgabe
5.3 Quantitative Inhaltsanalyse
5.3.1 Methodisches Vorgehen
5.3.2 Ergebnisse der Raumanalyse
5.4 Die theoretische Konzeption des Erdkundeunterrichts in den Fachdidaktikzeitschriften
5.4.1 Stellung und Aufgabe der Erdkunde
5.4.1.1 Erziehungsauftrag und Bildungswert des Erdkundeunterrichts
5.4.1.2 Der Erdkundeunterricht in der Volksschule
5.4.1.3 Der Erdkundeunterricht in der Höheren Schule
5.4.1.4 Nationale und völkische Erdkunde
5.4.2 Komponenten des nationalsozialistischen Erdkundeunterrichts
5.4.2.1 Heimatkunde
5.4.2.2 Geopolitik und Politische Geographie
5.4.2.3 Rassenkunde
5.4.2.4 Kolonialgeographie und kolonialer Gedanke
5.4.2.5 Wehrgeographie und wehrgeistige Erziehung
5.4.2.6 Erdkunde in der Lagererziehung
5.4.3 Ein Modell der Konzeption des nationalsozialistischen Erdkundeunterrichts
6 Die theoretische Konzeption des nationalsozialistischen Erdkundeunterrichts im weiteren fachdidaktischen Schrifttum
6.1 Buchpublikationen zur Neukonzeption der Erdkunde
6.2 Beiträge zur Geopolitik
6.3 Erdkunde in der Mädchenbildung
7 Der Erdkundeunterricht in den nationalsozialistischen Lehrplänen und Richtlinien für allgemeinbildende Schulen
7.1 Volksschule (1937, 1939)
7.2 Höhere Schule (1938)
7.3 Mittelschule (1939)
7.4 Hauptschule (1942)
8 Die inhaltliche Neugestaltung der Erdkundeschulbücher im Nationalsozialismus
8.1 Nachdrucke und Ergänzungshefte bis 1939
8.2 Die Einführung neuer Schulbücher ab 1939
8.3 Die Entwicklung des Deutschen Schulatlas
8.4 Ideologiekritische Inhaltsanalyse ausgewählter Erdkundeschulbücher
8.4.1 Methodische Überlegungen zur Schulbuchanalyse
8.4.2 Erdkundebücher für Höhere Schulen
8.4.2.1 Heimatkunde
8.4.2.2 Geopolitik und Politische Geographie
8.4.2.3 Rassenkunde
8.4.2.4 Wehrgeographie und wehrgeistige Erziehung
8.4.2.5 Kolonialgeographie und kolonialer Gedanke
8.4.2.6 Sonstige ideologische Elemente
8.4.3 „Großdeutschland und die Welt“ – ein Erdkundebuch für Mittelschulen
9 Zusammenfassende Schlussbetrachtung
Anhang
Anmerkungen
Quellen- und Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Wir müssen uns erinnern.
Sonst wird sich alles wiederholen.
Marguerite Duras
1 Einleitung
1.1 Einordnung des Themas
Die vehement geführte Diskussion über die Interpretation einzelner Phänomene des Nationalsozialismus, insbesondere über die Singularität der Judenvernichtung, im Rahmen des sogenannten „Historikerstreits“ der Jahre 1986/87 hat offenbart, welcher Zündstoff noch heute in der deutschen Vergangenheit der Jahre 1933-1945 liegt1. Die Polemik, mit der diese Auseinandersetzung streckenweise geführt wurde, hat deutlich gemacht, wie wenig die Bewältigung dieser Vergangenheit fortgeschritten ist und wie sehr sie ideologischen Deutungen unterliegt. Das liegt zu einem großen Teil daran, dass die Erfahrungen aus dem Nationalsozialismus und seine Folgen noch heute in vielen Bereichen unserer Gegenwart wirksam sind: Es ist, als wenn sich jene zwölf Jahre unter dem Druck immer erneuter Aktualisierungen ausdehnten, statt aus immer entfernteren Retrospektiven zu schrumpfen. Die vergangenen Gegenwarten bleiben auf unheimliche Weise aktuell“ (HABERMAS 1987, S.11).
Die vorliegende Arbeit will deshalb ausdrücklich ihre Position benennen und Stellung beziehen. Sie wendet sich - mit Habermas - gegen eine „Entsorgung der Vergangenheit“2 und gegen jede Art „Schadensabwicklung“3zu betreiben. Die Dissertation versucht somit, sich den Versuchen, Geschichtsbewusstsein zu manipulieren, zu widersetzen, und setzt Aufklärung dagegen4. Aufklärung als „kritisches Denken, das auch vor dem Fortschritt nicht innehält“ und „Parteinahme für die Residuen von Freiheit, für Tendenzen zur realen Humanität“ verlangt5, erscheint gerade in einer Untersuchung über den Nationalsozialismus notwendig, wenn man mit HORKHEIMER und ADORNO (1971) davon ausgeht, dass in der „Dialektik der Aufklärung“ der Nährboden für faschistische Bewegungen bereitet wird. In diesem Sinne will die vorliegende Dissertation über die Situation, Konzeption und Entwicklung des Erdkundeunterrichts im Nationalsozialismus aufklären.
Erdkundeunterricht im Nationalsozialismus war ein Thema, das über fünfunddreißig Jahre in der Literatur nicht behandelt wurde. Erst 1981 erschien ein Aufsatz von LEINEN/THOMÉ und 1985 schließlich ein Kapitel über den Heimatkundeunterricht in der voluminösen Dissertation über die Entwicklung des Sachkundeunterrichts von MITZLAFF. Diese Nichtaufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit über Jahrzehnte ist durchaus kein Spezifikum der Geographie und des Erdkundeunterrichts, sondern findet sich bis Anfang der siebziger Jahre ebenso bei vielen anderen Wissenschafts- und Schuldisziplinen. Doch funktionierte das „kommunikative Beschweigen brauner Biographieanteile“6 wohl in keiner Disziplin so perfekt wie in der Geographie.
Zwei Jahre nach Kriegsende eröffnete der international renommierte Geograph Carl Troll die neugegründete Zeitschrift „Erdkunde“ mit einer „Kritik und Rechtfertigung“ der geographischen Wissenschaft in Deutschland in den Jahren 1933-1945 (TROLL 1947), in der politische Verstrickungen und Mitverantwortung in erster Linie auf den „ungeographischen“ „Sprößling ... der Geographie“7, die Geopolitik, abgewälzt wurden. Zudem wurde der Geopolitiker Karl Haushofer, der sich 1946 das Leben genommen hatte, aus den Reihen der Professoren derart herausgehoben, dass mit ihm in der Folgezeit die politischen Verstrickungen der Geographie mit dem Nationalsozialismus personifiziert wurden. Mit dieser „Kritik und Rechtfertigung“ glaubte die deutsche Geographie offensichtlich, sich mit einem Schlag ihrer Verantwortung für das Verhalten zwischen 1933 und 1945 entledigt zu haben. Mit der Publikation desselben Aufsatzes in einer der führenden amerikanischen Fachzeitschriften (TROLL 1949) versuchte sie gleichzeitig, ihr internationales Ansehen wiederzuerlangen.
Selbst als Anfang der achtziger Jahre mehrere Sammelbände zum Themenkomplex „Wissenschaft und Hochschule im Nationalsozialismus“ erschienen (MEHRTENS/RICHTER 1980, BRÄMER 1983, TRÖGER 1984, LUNDGREEN 1985), fehlte die Geographie jedes Mal. Das gleiche gilt für den Erdkundeunterricht, den man im Sammelband von PÖGGELER (1985) vergeblich sucht. Offensichtlich wirkte in der Schul- und Wissenschaftsdisziplin Geographie „die diskrete Kumpanei der Mandarine“8, der Kompromiss zwischen alten Nationalsozialisten und ihren Gegnern zwecks gemeinsamen Beschweigens der braunen Vergangenheit (BRUNKHORST 1987), das die Unbeflecktheit ihrer Disziplin und ihrer eigenen Stellen garantieren sollte, besonders erfolgreich.
Erst als Ende der siebziger Jahre von geschichtswissenschaftlicher Seite eine neue Diskussion über die Rolle des Geographieprofessors Karl Haushofer (1869-1946) und seiner Geopolitik in der Weimarer Republik und der NS-Zeit begonnen wurde (MATERN 1978,JACOBSEN 1979 a, b, 1981, DINER 1984), äußerten sich erstmals wieder Geographen zu dieser bis dahin totgeschwiegenen Epoche ihrer Wissenschaftsgeschichte (SCHÖLLER 1982, HESKE 1987 a,HESKE/WESCHE 1988). Gleichzeitig erweiterte sich der Blickwinkel von der Geopolitik auf die gesamte Geographie, so dass erste Ansätze einer kritischen Aufarbeitung der Geographiegeschichte des Zeitraumes 1933-1945 erschienen (SANDNER 1983, KOST 1986 b, HESKE 1986, 1987 b, RÖSSLER 1987, FISCHER/SANDNER 1991), die sich ausdrücklich gegen die traditionelle Geographiegeschichtsschreibung der „großen“ Geographen wandten, wie sie vornehmlich von BECK (1982) betrieben wurde9. Dabei setzte die umfangreiche Dissertation von KOST (1986 b) methodisch und inhaltlich neue Maßstäbe für diese kritische wissenschaftshistorische Forschung. Die vorliegende Untersuchung über den Erdkundeunterricht im Nationalsozialismus versteht sich als ein weiterer kritischer Beitrag zur Geschichte der Geographie. Darüber hinaus will sie aber auch eine Forschungslücke in der Geschichte der Pädagogik schließen, deren Literatur über die Zeit des Nationalsozialismus in den achtziger Jahren zwar enorm angewachsen ist (vgl. den Forschungsbericht von TENORTH 1985 und zuletzt die Arbeiten von SCHOLTZ 1985, ROSSMEISSL 1985, TENORTH 1986, FLESSAU et al. 1987), die aber Fragen nach der Konzeption des Erdkundeunterrichts im Zeitraum 1933-1945 und den Aktivitäten der Reichssachgebiete Erdkunde und Geopolitik im Nationalsozialistischen Lehrerbund (NSLB) bisher nicht beantworten konnte.
Die Ausblendung der Zeit zwischen 1933 und 1945 in der deutschen Geographiegeschichtsschreibung scheint mit dem zusammenzuhängen, was HARD (1973) eine „Ironie der geographischen Ideengeschichte“ genannt hat, nämlich „daß sich die 'Verleugnung der Geschichte', dieser durch und durch ahistorische methodologische Essentialismus gerade bei solchen Geographen findet, die an anderer Stelle so viel über Idiographie, historischen Sinn, genetische Deutung, historische Tiefe, geschichtliche Individualität und Einzigartigkeit zu sagen wissen“ (ebd., S. 12). Hard führt dieses Verhalten auf eine ideologische Funktion zurück: das Erhalten des historisch bedingten Forschungsinteresses der eigenen Gruppe, indem es gegen Kritik von außen immunisiert wird.
In einem späteren Aufsatz geht HARD (1983) sogar noch weiter und bezeichnet die (deutsche) Geographie allgemein als „Disziplin der Weißwäscher“; insbesondere „die Geschichtsschreibung der Geographie ist ein exemplarisches Feld geographischer Wirklichkeitsverleugnung“ (ebd., S.14). Auch in diesem Sinne will die vorliegende Arbeit mit überkommenen Traditionen der Geographie brechen.
Gerade die Zeit des Nationalsozialismus ist eine Zeit des politischen Opportunismus, gerade auch unter Lehrern und Wissenschaftlern. Wenn im Folgenden dieser Opportunismus im Detail untersucht wird, so geht es nicht um den Opportunismus von Personen, sondern um den einer Schul- und Wissenschaftsdisziplin10. Dennoch ist das Hauptziel dieser Arbeit nicht, den Opportunismus der Erdkundelehrer und -didaktiker aufzudecken, sondern vielmehr, auf welche Art und Weise, mit welchem Engagement, mit welchen ideologischen Komponenten und mit welchen - vermeintlich neuen - Inhalten ein Umbau des Erdkundeunterrichts während des Nationalsozialismus betrieben wurde. Es gilt zu zeigen, mit welcher „zynischen Vernunft“11 diese „Anpassung“12 betrieben wurde, die mehr war als nur eine Anpassung. Ein weiteres Anliegen der Arbeit ist es, vor der eigentlichen Untersuchung einige notwendige theoretische Klärungen vorzunehmen, ohne die ein analytisches Vorgehen nicht möglich ist. Während bisher in der pädagogischen Literatur Begriffe wie „Nationalsozialismus“, „Drittes Reich“, „unterm Hakenkreuz“ und „Faschismus“ weitgehend unreflektiert und meist synonym verwendet wurden13, sollen im zweiten Kapitel faschismustheoretische Vorüberlegungen zu einer Klärung der verwendeten Terminologie führen und eine wissenschaftliche Grundlage für die Analyse des komplexen Themas liefern. Außerdem wird durch schultheoretische Vorüberlegungen, wie sie bisher lediglich von NYSSEN (1979) angestellt wurden, und wissenschaftstheoretische Vorüberlegungen eine weitfassende Einordnung des Themas ermöglicht. Auf diese Weise soll ein dreigliedriger theoretischer Ansatz erstellt werden, den bisher vorliegende Arbeiten zum Themenkomplex Schule und Wissenschaft im Nationalsozialismus nicht leisten.
Wie notwendig ein solcher theoretischer Ansatz ist, sollen zwei Beispiele aus der Geographiegeschichtsschreibung der achtziger Jahre belegen. So ist der Disziplinhistoriker Hanno Beck noch 1981 der Auffassung, dass der Geographie und dem Erdkundeunterricht in der Zeit des Nationalsozialismus keine eigene Epoche zuzubilligen ist, da „für die Geographie des Dritten Reiches von 1933 bis 1945 ein eigenständiges neues Konzept nicht nachgewiesen werden kann“ (BECK 1981, S. 69)14. Diese Argumentationslinie deckt sich auffallend mit der vieler Standardwerke zur Geschichte der Pädagogik bis Ende der siebziger Jahre15. Der politische Aspekt von Wissenschaft und Schule bleibt völlig unbeachtet, Fragen nach der politischen Verantwortung des Wissenschaftlers und des Lehrers werden gar nicht erst gestellt.
Ebenso wenig förderlich ist das Vorgehen des renommierten Geographen Julius Büdel, der in seinem Aufsatz über die Geographischen Gesellschaften in der Zeit von 1828 bis 1982 den Kriegszeitraum 1939-1944 ganz ausblendet und ansonsten die Katastrophenthese16 vertritt: „Als das 'Dritte Reich' ausbrach, wurden die Geographischen Gesellschaften, die sich ein wenig hinter Begriffen wie 'Lebensraumkunde' und 'Geopolitik' verbergen konnten, nicht in dem Maße 'gleichgeschaltet' wie andere Kulturverbände“ (BÜDEL 1982, S.12). Solch ein Verständnis vom Nationalsozialismus ist politisch gefährlich. Indem Büdel davon ausgeht, dass 1933 das 'Dritte Reich' quasi wie eine Vulkankatastrophe „ausbrach“, können Fragen nach Kontinuität und Mitverantwortung gar nicht erst aufkommen. Zudem spielt er die Verstrickung der Geographischen Gesellschaften mit der Geopolitik und der Lebensraumkunde kritiklos herunter.
Derartige Probleme der fehlenden bzw. mangelhaften Geschichtsschreibung über die Zeit des Nationalsozialismus sind dennoch keine disziplinspezifischen der Geographie sondern vielmehr allgemeine der deutschen Wissenschaftsgeschichte:
„Noch bis vor wenigen Jahren war die Zeit des Nationalsozialismus keine Periode, die das besondere Interesse der Wissenschaftshistoriker erregte. ...
Erkenntnisse über die Komplexität des nationalsozialistischen Herrschaftsapparates etwa, die nicht ohne Auswirkungen auf die innere wie äußere Wissenschaftspolitik des Reiches bleiben konnten, wurden nicht zur Kenntnis genommen. ...
Heute zeigt sich ein anderes Bild. Nicht zuletzt jüngere und in starkem Maße auch ausländische Forscher haben die herkömmliche Wissenschaftsgeschichtsschreibung der nationalsozialistischen Zeit entscheidend revidiert“ (LEPENIES 1986, S. 287).
Diese Feststellung von Lepenies lässt sich auch für die Geographie bestätigen, mit der Einschränkung, dass der Erdkundeunterricht bis heute weitgehend unbeachtet blieb. Von ausländischer Seite brachten beispielsweise jüngst die Arbeiten von BASSIN (1987) und PATERSON (1987) neue Einsichten in das komplexe Verhältnis von Geopolitik und Nationalsozialismus. Bassin schildert mit beeindruckenden Belegen die Entstehung und Entwicklung des Konfliktes zwischen der deutschen Geopolitik, die originär einen naturdeterministischen Ansatz verfolgte, und dem Nationalsozialismus, der angeborene Rassenmerkmale für prägender hielt. Mit diesem „dilemma of `nature or nurture`“17 wird sich der Abschnitt über Geopolitik im Erdkundeunterricht noch eingehend beschäftigen.
Paterson seinerseits schlägt eine Rehabilitierung der deutschen Geopolitiker vor. Seiner Meinung nach kann die Geopolitik nicht für ihre politische Ausrichtung als „Zweckwissenschaft“ kritisiert werden, da auch heute Forschung - beispielsweise mit marxistischem Ansatz -politische Ziele verfolgt. Diese eher wissenschaftstheoretische Entlastung der Geopolitik abstrahiert meines Erachtens in unzulässiger Weise von den Inhalten, die mit ihren stark nationalistischen und oft imperialistischen Tönen auch in großem Maße Eingang in den Erdkundeunterricht der NS-Zeit gefunden haben, wie im folgenden noch gezeigt werden wird.
Als jüngerer Forscher sei Klaus Kost erwähnt, der in seiner detailreichen Untersuchung über „Die Einflüsse der Geopolitik auf Forschung und Theorie der Politischen Geographie von ihren Anfängen bis 1945“ (KOST 1986 b) u.a. zu dem überraschenden Ergebnis kommt, dass zwischen den Weltkriegen beinahe alle bedeutenden deutschen Geographen zeitweise auf dem Gebiet der Politischen Geographie und Geopolitik tätig waren.
Die vorliegende Dissertation gewinnt auch dadurch an Aktualität, dass seit Anfang der siebziger Jahre in Nordamerika und Europa eine starke Wiederbelebung der Geopolitik, einer der Hauptkomponenten des nationalsozialistischen Erdkundeunterrichts, zu beobachten ist. HEPPLE (1986) gibt einen Überblick über dieses neu erwachte Interesse an der Geopolitik. Er sieht den Ursprung dieses Interesses in der wechselnden internationalen politischen und wirtschaftlichen Situation und der wachsenden Multipolarität und Komplexität der Weltpolitik (ebd., S. 33). Diese Renaissance der Geopolitik geht allerdings nicht mit einer einheitlichen Verwendung des Begriffes einher. Im Gegenteil, sehr verschiedene Auffassungen des Terminus existieren nebeneinander und ignorieren in den meisten Fällen die Historie dieses Begriffs.
Andere Kreise in der Bundesrepublik wiederum verwenden bewusst die „Ideologie der Mitte“ „mit ihrem geopolitischen Tamtam von 'der alten europäischen Mittellage der Deutschen'“ (HABERMAS 1987, S. 135). BRUNKHORST (1987) kritisiert Geopolitik in diesem Zusammenhang scharf als typischen Begriff des Antiintellektualismus (ebd., S. 23).
Da zudem die NATO 1985 einen „Advanced Research Workshop“ über „Geopolitik im nuklearen Zeitalter“ veranstaltete18, und neueste historische Forschungen „Geopolitik“ und „Lebensraum“ überzeugend als wesentliche Bestandteile imperialistischer und nationalsozialistischer Ideologie extrahiert haben (SMITH 1986), erscheint die Verwendung dieses diffusen, meist ideologisch besetzten Begriffs in der Tat sehr suspekt. KOST (1986 a) spricht sich deshalb vorerst gegen eine weitere Verwendung des Begriffs aus (ebd., S. 22). Auch HEPPLE (1986) hält eine detaillierte historische Forschung und Kritik für unbedingt notwendig (ebd., S. 33). Dieser Aufforderung soll in der vorliegenden Arbeit nachgekommen werden.
Auch eine andere dubiose Komponente des Erdkundeunterrichts der NS-Zeit, die Wehrgeographie, hat im vergangenen Jahrzehnt eine bedenkliche Renaissance erlebt. So konnte sich 1979 Rainer Mennel am Anthropogeographischen Institut der Freien Universität Berlin auf diesem Gebiet der militärischen Zweckforschung mit einer Arbeit habilitieren, die die überkommene Literatur von Karl Haushofer und Oskar Ritter von Niedermayer aus der Zeit des Nationalsozialismus19kritiklos übernimmt (MENNEL 1981). Ohne Widerspruch von der etablierten Geographie publiziert Mennel auch weiterhin Aufsätze und Bücher in wehrwissenschaftlichen Reihen (z.B. MENNEL 1983), deren Inhalte von einer geographischen Friedensforschung (O`TOUGHLPN/ VAN DER WUSTEN 1986, VAN DER WUSTEN/ O`TOUGHLIN 1986) weit entfernt sind. Insofern soll die detaillierte historische Untersuchung der Inhalte des Erdkundeunterrichts des Nationalsozialismus auch eine weitere Grundlage für die Kritik der traditionellen Wehr- und Militärgeographie20 liefern.
Ihre Renaissance hat der Geopolitik inzwischen auch wieder Eingang in den Erdkundeunterricht verschafft. 1985 legten HENNINGS/ RHODE-JÜCHTERN ihr Arbeitsbuch „Geopolitik 2000“ vor, das sich an „Schüler der gymnasialen Oberstufe und Studenten des Grundstudiums“ wendet. Motiviert wird diese Wiedereinführung der Geopolitik – ganz analog zu ihrem Aufstieg in den zwanziger und dreißiger Jahren – mit den kaum überschaubaren weltweiten Krisen in der Wirtschaft, Politik und Umwelt sowie dem „Fehlen einer globalen und langfristigen Perspektive“ (ebd., S. 2). Abhilfe schaffen soll ein „Arbeitsmodell“ mit dem Ziel, „die Komplexität eines Themas so zu sortieren, dass sie überschaubarer wird und dass die wichtigsten Einflußgrößen jede für sich zu erkennen und zu bearbeiten sind“ (ebd., S. 7). Diese „Reduktion der Komplexität“ (ebd.) unterscheidet sich kaum von dem fatalen Reduktionismus der klassischen deutschen Geopolitik, die glaubte politische Gesetzmäßigkeiten und – darauf aufbauend – verlässliche Prognosen erstellen zu können. Reduktionismus als Gegenreaktion auf die Sinnkrise einer schwer durchschaubaren Welt kann aber nicht der richtige Weg sein. Zumal die Autoren dieses Schulbuchs von der „Disqualifikation“ (ebd., S. 45) des Geopolitikbegriffs abstrahieren und versuchen ihn inhaltlich neu zu besetzen, was ihnen aber kaum gelingt: „Geopolitik läßt sich also bestimmen als die Beachtung der Beziehungen und Kräfte, die das politische Gesicht unserer Erde gestalten“ (ebd., S.46). Solch eine Suche „auf der Metaebene nach Erklärungen und Prognosen“ (ebd.) läuft eher Gefahr durch Generalisierung statt Differenzierung die wirklichen Ursachen zu verkennen21. Der Ansatz von Hennings und Rhode-Jüchtern unterliegt somit den gleichen problematischen Prämissen wie der der klassischen Geopolitik und muss deshalb abgelehnt werden. Dieser Rückschritt in die Zeit vor 1945 lässt sich nur durch eine fehlende historische Analyse der Geopolitik im Erdkundeunterricht erklären und dokumentiert nicht zuletzt die Notwendigkeit einer solchen Untersuchung.
1.2 Fragestellung der Untersuchung
Die Problemstellung der Dissertation liegt in der Untersuchung der Konzeption des Erdkundeunterrichts in der Zeit des Nationalsozialismus. Eine derartige Darstellung muss zwangsläufig auf die theoretische Konzeption eingeschränkt bleiben, da sich die praktische Verwirklichung des Erdkundeunterrichts während des Nationalsozialismus, wie etwa die tatsächliche Umsetzung eines Schulbuchkapitels im Unterricht, einer wissenschaftlichen Untersuchung weitgehend entzieht und eher Raum für Vermutungen bietet. Dennoch versucht die Arbeit durch die Heranziehung verschiedenartiger Quellen und einer zeitlichen Differenzierung dem wirklichen Bild des Erdkundeunterrichts zwischen 1933 und 1945 sehr nahe zu kommen. Mit der Auffassung, dass die zwölf Jahre des „tausendjährigen Reiches“ politisch – und damit auch schul- und wissenschaftspolitisch – sehr unterschiedliche Jahre waren, will die Arbeit eine genetische Darstellung des Erdkundeunterrichts geben. Dadurch eröffnet sie sich die Möglichkeit, Schattierungen und Nuancen der Disziplingeschichte sowie das Aufkommen und Verblühen einzelner Fachkomponenten zu erkennen und zu erklären. Aus diesem Grund wird bei der Untersuchung auch zwischen den einzelnen Schulformen differenziert – auch wenn der Schwerpunkt der Darstellung aufgrund der Materiallage auf der Höheren Schule liegt –, insbesondere dort, wo sich diese Unterscheidung eindeutig durchführen ließ, wie bei den Lehrplänen, Richtlinien und Schulbüchern.
Damit wendet sich die Arbeit ausdrücklich gegen die Auffassung von ROSSMEISSL (1985), der eine grundsätzliche Aufteilung nach Schularten nicht für sinnvoll hält, „da die Zielsetzungen und oft auch die Mittel sich zwischen den Schularten nicht prinzipiell unterschieden, sondern höchstens im Grad der Subtilität voneinander abwichen“ (ebd., S. 38), wie die Untersuchung von FLESSAU (1979) gezeigt habe. Dem ist entgegenzuhalten, dass die unsystematische Untersuchung von Flessau, die von einer Analyse der komplexen Zusammenhänge, der Hintergründe oder auch der verschiedenen Phasen der NS-Schulpolitik weit entfernt ist22, von ihrem Ansatz her prinzipielle Unterschiede zwischen den Schularten gar nicht aufdecken konnte.
Nicht zuletzt die Arbeiten von NYSSEN (1979) und SCHOLTZ (1985) haben gezeigt, dass eine deutliche Differenzierung und eine Periodisierung der nationalsozialistischen Schulpolitik für eine tiefergehende Einsicht in die komplexen Zusammenhänge unabdingbar sind. Es wird deshalb eine weitere Aufgabe der Untersuchung sein, Unterschiede im Erdkundeunterricht der verschiedenen Schulformen, vor allem inhaltlicher Art, herauszustellen.
Die vorliegende Untersuchung des Erdkundeunterrichts im National sozialismus stützt sich im Wesentlichen auf vier verschiedene Quellen:
die Fachdidaktikzeitschriften für Erdkundelehrer,
die Lehrpläne und Richtlinien,
die Erdkundeschulbücher,
Archivalien (Schriftverkehr, Personalakten, Nachlässe).
Die genetische Darstellung beginnt dabei mit einer Bestandsaufnahme der Stellung und der inhaltlichen Konzeption des Erdkundeunterrichts nach der Preußischen Schulreform von 1925 und der Entwicklung bis 1933, wobei die drei Schulformen Volksschule, Mittelschule und Höhere Schule zusammen behandelt werden (Kap. 3). Erst durch diese Darstellung der Situation vor 1933 können im Weiteren Veränderungen, Kontinuitäten und Brüche in der Konzeption während des Nationalsozialismus deutlich gemacht werden.
Mit der Auflösung des Verbandes Deutscher Schulgeographen und der Gründung des Reichssachgebietes Erdkunde im Nationalsozialistischen Lehrerbund (NSLB) erfolgte 1934 die „Gleichschaltung“ der Erdkundelehrer. Deshalb beginnt die Untersuchung des Zeitraumes 1933-1945 mit einer Aufarbeitung der Geschichte der Reichssachgebiete Erdkunde und Geopolitik im NSLB (Kap. 4). Nur vor dem Hintergrund der Aktivitäten dieser Organisation kann der Erdkundeunterricht der NS-Zeit eingehend analysiert werden.
Die besondere Bedeutung, die die nationalsozialistische Führung offensichtlich dem Erdkundeunterricht beimaß, wird daran sichtbar, dass Erdkunde eines der wenigen Schulfächer war, für das von der ersten Untergliederung des NSLB im Jahre 1934 an ein eigenes Sachgebiet in der Abteilung „Erziehung und Unterricht“ eingerichtet worden war. Verbandsorgan des Reichssachgebietes Erdkunde im NSLB wurde 1934 der „Geographische Anzeiger“, der bis zu diesem Zeitpunkt das Verbandsorgan des Verbandes Deutscher Schulgeographen gewesen war. Die ideologiekritische Inhaltsanalyse der beiden fachdidaktischen Zeitschriften „Geographischer Anzeiger“ (1925-1944) und „Zeitschrift für Erdkunde“ (1933-1944)23 bildet einen Schwerpunkt der Untersuchung, wobei ergänzend Aufsätze zum Erdkundeunterricht aus der übrigen Literatur mit berücksichtigt werden. Auch hierbei beginnt der Untersuchungszeitraum bereits im Jahre 1925, wiederum um Fragen nach Entwicklungskontinuitäten klären zu können. Bezeichnenderweise wurden beide Zeitschriften nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr fortgeführt.
Nach einer quantitativen Inhaltsanalyse, die es erlaubt, Verschiebungen in den regionalen und theoretischen Forschungsgebieten zu ermitteln, wird versucht, die elementaren Komponenten einer „nationalsozialistischen Erziehung“ im Erdkundeunterricht zu extrahieren und in einem vorläufigen Modell darzustellen. Diese Komponenten werden im Rahmen der ideologiekritischen Inhaltsanalyse ausführlich betrachtet.
Im sechsten Kapitel werden die wichtigsten fachdidaktischen Buchpublikationen zur Neukonzeption des Erdkundeunterrichts und zur Einbeziehung der Geopolitik besprochen. Nachdem auf diese Weise die Diskussion über die Gestalt eines nationalsozialistischen Erdkundeunterrichts in ihrer Entwicklung dargestellt worden ist, wird die Konzeption des Erdkundeunterrichts in den neuen Lehrplänen und Richtlinien der Volksschule (1937, 1939), der Höheren Schule (1938), der Mittelschule (1939) und der Hauptschule (1942) analysiert. Es wird erörtert, in welchen Punkten die Lehrpläne und Richtlinien von der Neukonzeption des Erdkundeunterrichts, wie sie sich aus den fachdidaktischen Schriften herauskristallisiert hatte, abwichen und wo sie den Erwartungen entsprachen. Anhand dieser Untersuchung wird das aufgestellte Modell des Erdkundeunterrichts überprüft.
Als letzte Etappe der Konzeption des nationalsozialistischen Erdkundeunterrichts erschienen ab 1939 die Schulbücher. Anhand einer ideologiekritischen, qualitativen Inhaltsanalyse von vier Erdkundeschulbuchreihen (eine für Mittelschulen, drei für Höhere Schulen) werden die zuvor extrahierten Grundkomponenten des Erdkundeunterrichts in ihre einzelnen ideologischen Motive aufgeschlüsselt. Diese Darstellung beschreibt die Konzeption des Erdkundeunterrichts, wie sie letztendlich mit Hilfe der Schulbücher in die Unterrichtspraxis umgesetzt werden sollte.
Das abschließende Schlusskapitel geht auch auf die Beziehung des Erdkundeunterrichts zu den erziehungstheoretischen Entwürfen des Nationalsozialismus ein. Es gilt u.a. zu klären, welchen Einfluss die Theorien von Ernst Krieck und Alfred Baeumler auf den Erdkundeunterricht hatten. Außerdem wird der Frage nachgegangen, welche Stellung und Funktion die nationalsozialistische Führung der Geographie im Gesamtumfeld von Schule und Wissenschaft zudachte, und welche Rolle der Erdkundeunterricht tatsächlich spielte.
Die traditionelle Geographiegeschichtsschreibung muss sich – wie oben gezeigt – ein fehlendes politisches Selbstverständnis und ein mangelhaftes historisch-politisches Verantwortungsbewusstsein vorhalten lassen. Dagegen geht die vorliegende Arbeit davon aus, dass sich Zusammenhänge zwischen Politik und politischen Tendenzen auf der einen Seite sowie geographischer Forschung und Erdkundeunterricht andererseits zu jeder Zeit in mehr oder weniger ausgeprägter Form finden. Da die politische Beeinflussung im Nationalsozialismus besonders stark war, werden hier besonders ausgeprägte Verbindungen und Wechselwirkungen vermutet, die in der Untersuchung soweit wie möglich offen gelegt werden sollen. Damit soll zugleich ein Beitrag zu einer kritischen „Selbstreflexion“24 der Geographie und ihres Schulunterrichts geleistet werden.
Nachdem noch bis Ende der siebziger Jahre große Defizite in der Aufarbeitung des Komplexes „Pädagogik im Nationalsozialismus“ vorhanden waren (vgl. SCHOLTZ 1978, WEBER 1980), ist dieses Gebiet in der Zwischenzeit durch eine Reihe nennenswerter Forschungsarbeiten in weiten Teilen untersucht worden. Zu erwähnen sind neben einer Vielzahl von Aufsätzen insbesondere die beiden Sammelbände der Historischen Kommission der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (HEINEMANN 1980), die Dissertation von FEITEN (1981) über den NSLB25, die beiden Materialsammlungen von GAMM (1984) und KANZ (1984), die Untersuchung von ROSSMEISSL (1985) und schließlich die lehrbuchartige Zusammenfassung von SCHOLTZ (1985), mit der die Forschungen einen ersten Abschluss erreicht haben. Eine Reihe von Detailfragen ist immer noch ungeklärt, während andere Aspekte der nationalsozialistischen Schulpolitik, wie die Situation der Schule und des deutschsprachigen Notunterrichts in Südtirol (VILLGRATER 1984, SAILER 1985), zwar untersucht sind, aber von der bundesrepublikanischen Forschung bisher weder beachtet noch in die Gesamtbetrachtung miteingearbeitet worden sind.
Auch zu den einzelnen Schulfächern liegen inzwischen vielfach Monographien oder zumindest mehrere Aufsätze und Materialsammlungen vor26; lediglich der Erdkundeunterricht harrt weiterhin seiner Erforschung. Diese Lücke in der Geschichte der Pädagogik und in der Geschichte der Geographie soll mit der vorliegenden Untersuchung -zumindest ansatzweise - geschlossen werden.
1.3 Quellen und Methoden
Historische Arbeiten, wie die vorliegende zum Erdkundeunterricht in Deutschland während des Zeitraums 1933-1945, müssen auf der Grundlage von umfassenden Quellenstudien erstellt werden. Die wissenschaftliche Methode ist dabei notwendigerweise die hermeneutische Interpretation, die den eigenen (historischen) Standort kritisch mit einbezieht und eine intersubjektive Überprüfbarkeit ermöglicht27.
Die angewandte hermeneutische Ideologiekritik verfolgt dabei den Ansatz der kritischen Sozialforschung. „Eine ideologiekritische Textanalyse untersucht interessenbezogene oder herrschaftskonforme Texte, gleichgültig, ob sie nun Ausdruck von Strategien und bewußten Absichten sind oder nicht“ (RITSERT 1972, S. 44).
Die Quellengrundlage für die Untersuchung der theoretischen Konzeption des Erdkundeunterrichts im Nationalsozialismus bilden zunächst alle Publikationen aus der Zeit von 1933 bis 1945, die einen Zusammenhang zum Thema aufweisen. Ergänzend werden Veröffentlichungen, vornehmlich von Geographen, Erdkundelehrern und Pädagogen, aus der Zeit vor 1933 und nach 1945 hinzugezogen. Ein tiefergehender Einblick in die komplexen Zusammenhänge und Hintergründe kann aber nur dadurch gelingen, dass in die Untersuchung zusätzlich unveröffentlichte Archivmaterialien, wie Schriftwechselakten, Personalakten und Nachlässe, miteinbezogen werden.
Wie bereits erwähnt, wird auf eine Untersuchung der praktischen Umsetzung der Konzeption im Schulunterricht verzichtet. Eine Rekonstruktion des Schulgeschehens ist aus der Distanz von über vierzig Jahre äußerst schwierig, zumal es an geeigneten Quellen mangelt. ROSSMEISSL (1985) versucht dennoch durch die Heranziehung von Schul-, vornehmlich Aufsatzheften und Jahresberichten überwiegend bayerischer Gymnasien und Realschulen die Realität der politischen Erziehung in der NS-Zeit aufzuspüren. Seine Untersuchung birgt jedoch keine neuartigen Erkenntnisse über den Schulalltag im Nationalsozialismus. Es zeigt sich vielmehr, dass offensichtlich theoretische Unterrichtskonzeption und Unterrichtsrealität im Allgemeinen wenig voneinander abwichen. Demzufolge fällt die Vernachlässigung der Untersuchung der Praxis für die Darstellung des Erdkundeunterrichts im Nationalsozialismus wenig ins Gewicht.
Auch auf die Möglichkeit der Einbeziehung von Methoden der 'oral history' wird in dieser Arbeit verzichtet. Vereinzelte Gespräche mit Erdkundelehrern, die während der NS-Zeit tätig waren, erbrachten keine nennenswerten Erkenntnisse. Ihren Retrospektiven fehlte weitgehend die kritische Distanz, Zusammenhänge wurden nicht erkannt, ihre Angaben waren ungenau, oft fehlerhaft und apologetisch. Zudem waren die führenden Fachdidaktiker der NS-Zeit bei Beginn der Untersuchung bereits verstorben. Der einzige noch lebende Zeitzeuge, von dem sich wirklich Aufschluss über verschiedene Fragen erhofft wurde, Irmfried Siedentop, der von 1933-1935 Herausgeber der „Geographischen Wochenschrift“ und von 1936-1939 Mitherausgeber der „Zeitschrift für Erdkunde“ war, lehnte trotz wiederholter Anfragen jegliche Äußerung zu diesem „Problem“ ab28.
Es zeigte sich somit auch bei dieser Arbeit, dass man durch die Auslegung von Texten „oft genauer und folgenreicher über allgemeine (...) Kernlegenden, Legitimationsmuster, Rationalisierungen, 'Empfindungen, Anschauungen, Illusionen'“ informiert wird, „als wenn man Individuen befragt, die den geglaubten Legenden oder akzeptierten Standards nur unbestimmten Ausdruck verleihen können“ (RITSERT 1972, S. 96).
Nach den methodischen Vorüberlegungen sollen in diesem Abschnitt die verwendeten Quellen und die allgemeine Quellenlage beschrieben werden.
Es wurden folgende Quellen für die Untersuchung herangezogen:
a) gedruckte Literatur
1. Die beiden Fachzeitschriften für Erdkundelehrer: die Jahrgänge 1925-1944 des „Geographischen Anzeigers“ und 1933-1944 der „Zeitschrift für Erdkunde“ (1933-1935 unter dem Titel „Geographische Wochenschrift“).
2. Die Bücher zur Konzeption des Erdkundeunterrichts, die zwischen 1933 und 1945 publiziert worden sind.
3. Die Erdkundeschulbücher, die zwischen 1933 und 1945 im Deutschen Reich erschienen sind. Hierzu wurden insbesondere die Bibliotheksbestände des Georg-Eckert-Instituts für Internationale Schulbuchforschung in Braunschweig und des Instituts für Schulbuchforschung in Duisburg gesichtet. Für die Schulbuchanalyse wurden letztlich aber nur vier ausgewählte Schulbuchreihen berücksichtigt, die nach den neuen Lehrplänen und Richtlinien entstanden waren.
4. Wichtige Beiträge zum Erdkundeunterricht aus dem übrigen Schrifttum der NS-Zeit, insbesondere die Aufsätze im „Nationalsozialistischen Bildungswesen“ (1936-1943), der erziehungswissenschaftlichen Monatszeitschrift des NSLB.
5. Die offiziellen Lehrpläne und Richtlinien, die für die allgemeinbildenden Schulen im Deutschen Reich während des Nationalsozialismus erlassen wurden.
6. Ausgewählte Literatur aus der Zeit vor 1933 und nach 1945 zur Ergänzung und Einordnung des Themas in einen größeren Zusammenhang.
b) Archivalien
7. Der Aktenbestand NS 12 „NS-Lehrerbund bzw. Hauptamt für Erzieher“ des Bundesarchivs Koblenz. Diese 1499 Akten sind in einem Findbuch nur grob beschrieben und liegen meist nur als ungeordnete Bündel vor. Obwohl sich nur eine einzige Akte speziell mit dem Reichssachgebiet Erdkunde beschäftigt29, konnte in den übrigen Akten noch genügend verstreutes Material für eine Darstellung gefunden werden. Zusätzlich wurden einige Akten des Reichserziehungsministeriums (Bestand R 21) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (R 73) herangezogen.
8. Die Personalakten der führenden Schulgeographen der NS-Zeit im Berlin Document Center. Diese Akten enthalten oft nur die entsprechenden Karteikarten der NSDAP und des NSLB, in manchen Fällen zusätzlich auch einige Schriftstücke.
9. Der bisher unbekannte Nachlass von Emil Hinrichs im Staatsarchiv Hamburg. Hinrichs war einer der bedeutendsten Schulgeographen der NS-Zeit. Er war Professor an der Hochschule für Lehrerbildung in Hamburg, Gausachbearbeiter für Erdkunde im NSLB, Mitherausgeber der „Zeitschrift für Erdkunde“ und Autor einer neu konzipierten Schulbuchreihe. Sein Nachlass umfasst 106 Akten und enthält eine Fülle von interessantem Material - zu nennen sind vor allem die Schriftwechselakten seiner Herausgebertätigkeiten -, das mit dieser Untersuchung erstmals erschlossen wird.
10. Der Nachlass des Geographen und Geopolitikers Karl Haushofer im Bundesarchiv Koblenz, der vor allem aufschlussreiches Material zur Geschichte der Geopolitik enthält.
11. Zwei Akten über den „Deutschen Schulatlas“ im Werksarchiv des Georg Westermann Verlags in Braunschweig, die Einblick in die Hintergründe der Entstehung dieses Atlas geben, der noch 1943 als Einheitsatlas für die Volksschule eingeführt wurde.
Weitere Archivalien, die Aufschluss über die Geschichte des Erdkundeunterrichts im Nationalsozialismus geben, konnten nicht entdeckt werden. Eine Untersuchung der Schriftwechselakten der „Zeitschrift für Erdkunde“ und des „Geographischen Anzeigers“, die ähnlich der Studie von SANDNER (1983) über die „Geographische Zeitschrift“ Einblick in das Problemfeld Zensur, Selbstzensur und Anpassungsdruck gegeben hätte, war nicht möglich, da beide Bestände nicht mehr existieren. Die Akten der „Zeitschrift für Erdkunde“ verbrannten im März 1944 bei einem Fliegerangriff30, während die Akten des „Geographischen Anzeigers“ 1945 auf Veranlassung des damaligen Verlagbesitzers vernichtet wurden31.
Im Bundesarchiv Koblenz befindet sich zwar noch ein zweiter umfangreicher Bestand aus dem Nachlass von Karl Haushofer, jedoch war dieser bei Abfassung der Arbeit immer noch nicht archivarisch aufbereitet und daher nicht zugänglich.
Weitere nennenswerte Unterlagen des NSLB existieren außer auf regionaler Ebene (im Staatsarchiv Ludwigsburg) vermutlich nicht mehr32. Es muss davon ausgegangen werden, dass die übrigen Akten der Reichssachgebiete Erdkunde und Geopolitik beim Brand im Haus der Deutschen Erziehung in Bayreuth, der Zentrale des NSLB, nach einem Bombenangriff im April 1945 vernichtet wurden oder nach dem Krieg verloren gegangen sind33.
2 Theoretische Vorüberlegungen
2.1 Wissenschaftstheoretische Vorüberlegung
Ein Defizit fast aller disziplinhistorischer Arbeiten zur Geographie und Pädagogik liegt darin, dass sie über keinen wissenschaftstheoretischen Ansatz verfügen oder ihn zumindest nicht explizit benennen. Ohne eine solche theoretische Einordnung schwebt eine Disziplingeschichtsschreibung aber quasi im leeren Raum und läuft Gefahr ein subjektiv-willkürliches Geschichtsbild zu entwerfen. SCHULTZ (1980, S. 29) hält eine Disziplingeschichtsschreibung ohne "theoretisches Vor-Urteil" gar für "unmöglich".
Auf die Probleme einer fehlenden Selbstreflexion der Geographie wurde bereits hingewiesen. Eine Ursache für dieses Defizit liegt in der isolierten Behandlung von Geschichte, Theorie und Wissenschaft. Deshalb ist den Worten des Wissenschaftstheoretikers Paul Feyerabend zuzustimmen, der der Meinung ist, "dass die zunehmende Trennung von Wissenschaftsgeschichte, Wissenschaftstheorie und Wissenschaft selbst nachteilig ist und im Interesse der drei Disziplinen beendet werden sollte" (FEYERABEND 1983, S. 57).
In der Wissenschaftstheorie gilt heute die Darstellung von Thomas Kuhn über "Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen" (KUHN 1976) als allgemein anerkannt. Kuhns theoretische Beschreibung der Entwicklung der Wissenschaften hat sich trotz harscher Kritik von Popper, Feyerabend u.a. durchgesetzt und damit die lange Zeit akzeptierte Theorie des Kritischen Rationalismus, namentlich die Falsifikationsthese von Popper, verdrängt34.
Auch in der Geographie fand die Theorie von Kuhn seit Anfang der siebziger Jahre zunehmend Aufnahme. Als einer der ersten nahm HARD (1973) in seiner "wissenschaftstheoretischen Einführung" in die Geographie Bezug auf die Ideen von Kuhn. Als disziplinhistorische Arbeiten, die auf einem wissenschaftstheoretischen Ansatz nach Kuhn basieren, sind vor allem die Dissertationen von EISEL (1980) und SCHULTZ (1980) zu nennen. Eisel untersucht in seiner Arbeit mit der Terminologie von Kuhn ausführlich den "Paradigmawechsel" der Anthropogeographie nach 1945 von einer 'Raumwissenschaft' zur Gesellschaftswissenschaft im Zuge der sogenannten "quantitativen Revolution" (siehe auch EISEL 1983).
Doch wie MAIR (1986) jüngst gezeigt hat, erhielt Kuhn in der Geographie hauptsächlich Beifall von der falschen Seite. Vor allem die mit der "quantitativen Revolution" aufkommenden Neopositivisten legitimierten in den siebziger und achtziger Jahren ihre geographische Forschung mit der antipositivistischen Wissenschaftstheorie von Thomas Kuhn. Den (angloamerikanischen) Disziplinhistorikern wirft Mair vor, dass nicht einmal zwei von ihnen dieselben Paradigmen in der Geographiegeschichte isoliert haben, obwohl diese nach Kuhn einfach zu finden sind, wenn sie existieren (ebd., S. 359).
Die vorliegende Arbeit stützt sich auf die detailreiche methodologische Disziplingeschichte von SCHULTZ (1980). Danach wird die Epoche der Geographie im Nationalsozialismus wissenschaftstheoretisch als Epoche der "völkisch-nationalpolitischen Version"35 des neuen "Paradigmas"36 einer holistischen Landschaftskunde begriffen. Dieses neue Paradigma des Ganzheitskonzepts war Mitte der zwanziger Jahre aufgekommen und hatte sich Anfang der dreißiger Jahre durchgesetzt. Man kann die "völkisch-nationalpolitische Version" dieses neuen Paradigmas in seiner Gesamtheit als "völkische Geogra phie"37bezeichnen, muss dabei aber bedenken, "dass die 'völkische Geographie' keine Geographie aus einem Guß war. Ihre Bilder, Begriffe und Wertungen stehen in keinem geschlossenen Zusammenhang, sondern teilweise sogar in klarem Gegensatz zueinander" (SCHULTZ 1980, S. 209).
Meines Erachtens ist es aber auch möglich, die völkische Geographie nicht nur als eine bestimmte Version des Paradigmas einer holistischen Landschaftskunde zu betrachten, sondern als ein eigenständiges, von außen induziertes Paradigma. Schließlich schuf die völkische Geographie mit den "völkischen Lebensräumen" sogar völlig neue Raumeinheiten als Forschungsobjekte der Geographie38. Diese wissenschaftstheoretische Deutung drängt sich vor allem dann auf, wenn man die Geographie nicht zu den Naturwissenschaften, sondern die Kulturgeographie zu den Gesellschaftswissenschaften zählt; denn diese klassifiziert Kuhn als multiparadigmatische Disziplinen, in denen jedes Paradigma eine der miteinander konkurrierenden Schulen repräsentiert39.
Auch die in der vorliegenden Untersuchung gewählte genetische Darstellung liegt ganz im Sinne der Kuhn’schen Wissenschaftstheorie. Die Arbeit orientiert sich an den Wissenschaftshistorikern, die begonnen haben, "eine neue Art von Fragen zu stellen und andere, oft keineswegs kumulative Entwicklungslinien der Wissenschaften zu verfolgen. Anstatt die beständigen, heute noch wertvollen Beiträge einer älteren Wissenschaft zu suchen, bemühen sie sich, die Ausgewogenheit jener Wissenschaft in ihrem eigenen Zeitalter darzulegen" (KUHN 1976, S. 17).
Bei der folgenden Darstellung der Genese des Erdkundeunterrichts im Nationalsozialismus wird also keinesfalls davon ausgegangen, dass es sich bei dieser Entwicklung um einen linear-kumulativen Prozess handelt. Vielmehr geht die Arbeit davon aus, dass die Geschichte der Wissenschaft und des Unterrichts "so komplex, chaotisch, voll von Fehlern und so unterhaltend wie die in ihr enthaltenen Ideen" ist, "und diese wiederum sind so komplex, chaotisch, voll von Fehlern und so unterhaltend wie das Bewußtsein derer, die sie erfinden" (FEYERABEND 1983, S. 16).
2.2 Faschismustheoretische Vorüberlegung
Ein weiteres theoretisches Defizit weisen fast alle Arbeiten zur Geschichte der Geographie bzw. der Pädagogik im Nationalsozialismus durch einen fehlenden faschismustheoretischen Ansatz auf. Nur in wenigen Untersuchungen wird dieses Problem überhaupt thematisiert und auf die Schwierigkeiten eines solchen Ansatzes verwiesen (z.B. NYSSEN 1979, S. 7), die darin liegen, dass es bisher keine umfassende Theorie über den Faschismus gibt. Das Hauptproblem eines faschismustheoretischen Ansatzes liegt in der heftigen Kontroverse, die von geschichtswissenschaftlicher Seite um den Faschismusbegriff geführt wird. Jedoch entbindet diese Kontroverse die Autoren disziplinhistorischer Arbeiten zumindest nicht von einer Klärung ihrer Terminologie. Dennoch werden die Begriffe "Faschismus", "Nationalsozialismus", "NS-Staat" und "Drittes Reich" in der disziplinhistorischen Diskussion meist ohne Definition nebeneinander und weitgehend synonym gebraucht. Andere Autoren wiederum verstecken sich hinter Formulierungen wie "unterm Hakenkreuz" (z.B. SCHOLTZ 1985). Deshalb sollen die folgenden faschismustheoretischen Überlegungen vor allem auch eine terminologische Klärung leisten.
In der Kontroverse um eine allgemeine Faschismustheorie lassen sich drei Gruppen mit verschiedenen Ansichten unterscheiden (vgl. SCHMIDT 1985, S. 41). Die erste Gruppe lehnt eine allgemeine Faschismustheorie ab, weil ihrer Meinung nach dadurch fundamentale Unterschiede zwischen den verschiedenen faschistischen Bewegungen verwischt werden. Die zweite Gruppe hält eine generalisierende Faschismustheorie für die Erklärung eines europäischen Faschismus als Produkt des Kapitalismus für unbedingt notwendig. Die dritte Gruppe schließlich befürwortet einen allgemeinen Faschismusbegriff, wendet sich aber gegen seine ausschließlich ökonomische Begründung.
WIPPERMANN (1983, S.206) kommt aufgrund seiner vergleichenden Untersuchung des europäischen Faschismus der Zeit 1922-1982 zu dem Ergebnis, dass "man wenigstens im heuristischen Sinne an einem allgemeinen, aber in sich differenzierten Faschismusbegriff festhalten" kann. Dennoch hält er die Suche nach einer globalen Theorie zurzeit für wenig förderlich und plädiert eher für eine empirische und methodenpluralistisch arbeitende vergleichende Faschismusforschung. In diesem Sinne hält auch die vorliegende Arbeit an einem allgemeinen, aber differenzierten Faschismusbegriff fest. Unter den vorhandenen Faschismustheorien lassen sich acht Hauptvarianten unterscheiden (vgl. KÜHNL 1979):
Faschismus als Produkt des Führers
40
Faschismus als Produkt nationaler Besonderheiten
Faschismus als Mittelstandsbewegung
41
Faschismus als Totalitarismus
42
Faschismus - phänomenologisch
43
Faschismus als Modernisierung
Faschismus als Bündnis
Faschismus als Diktatur des Monopolkapitals
44
Ausführliche Erläuterungen und Kritik der verschiedenen Faschismustheorien finden sich in den zusammenfassenden Darstellungen von KÜHNL (1979), WIPPERMANN (1980) und SAAGE (1981).
Für die Untersuchung von Schule und Wissenschaft im Nationalsozialismus erscheint ein faschismustheoretischer Ansatz im Rahmen der Bündnistheorie am vielversprechendsten. Damit können die Verstrickungen der einzelnen Gruppen, wie die der Lehrer und Professoren in ihrer Funktion als Teile der Beamtenschaft, im Zusammenhang der Verbindungen der verschiedenen Bündnispartner erklärt werden. Dagegen erweisen sich rein ökonomische Ansätze vom Faschismus als "Diktatur des Monopolkapitals" und monokratische Ansätze vom Faschismus als Produkt des Führers in ihrer Monokausalität für diese Analyse auf mesopolitischer Ebene als völlig unzureichend.
Den faschismustheoretischen Hintergrund der vorliegenden Untersuchung soll deshalb die Arbeit von NEUMANN (1984) bilden, die eingehend die "Struktur und Praxis des Nationalsozialismus" beschreibt45. Neumann kommt zu dem Ergebnis, dass es sich beim nationalsozialistischen Herrschaftssystem um ein ad hoc geschlossenes Bündnis von vier miteinander konkurrierenden Machteliten handelt: eine "Polykratie"46 von Militär, Partei, Industrie und Bürokratie. Alle vier Machtblöcke sind souverän und autoritär, mit eigener legislativer, administrativer und judikativer Macht ausgestattet, und doch ist jeder auf den anderen angewiesen. "Die Armee braucht die Partei, weil der Krieg total ist. Die Armee ist außerstande, die Gesellschaft 'total' zu organisieren; das ist Sache der Partei. Andererseits ist die Partei auf die Armee angewiesen, um den Krieg zu gewinnen und damit ihre eigene Macht festigen und sogar vergrößern zu können. Beide brauchen die monopolistische Industrie, die ihnen für die kontinuierliche Expansion bürgt. Und alle drei brauchen die Bürokratie, um die technische Rationalität zu erlangen, ohne die das System nicht funktionsfähig wäre" (ebd., S. 460).
Das Wirtschaftssystem des Nationalsozialismus bezeichnet Neumann als "totalitärer Monopolkapitalismus" (ebd., S. 313). Ein Charakteristikum ist ferner, dass die vier miteinander konkurrierenden Machteliten ihre Konflikte keineswegs auf der Grundlage gesetzlich fixierter Spielregeln austragen. Hitler selbst verkörpert den Garanten jener zerbrechlichen Allianz, in der die NSDAP eine Vorrangstellung einnimmt.
Für unsere terminologische Klärung ist von Bedeutung, dass Neumann den Nationalsozialismus als "Behemoth", als "Unstaat" bezeichnet (ebd., S. 16). Neumann vertritt die Meinung, "dass wir es hier mit einer Gesellschaftsform zu tun haben, in der die herrschenden Gruppen die übrige Bevölkerung direkt kontrollieren - ohne die Vermittlung durch den wenigstens rationalen, bisher als Staat bekannten Zwangsapparat" (ebd., S. 543). Durch diese Charakterisierung des Nationalsozialismus als "Unstaat" erscheint die Verwendung des Begriffs "NS-Staat" zumindest fragwürdig. Dieser Ausdruck und ähnliche werden deshalb in der vorliegenden Arbeit vermieden. Auch der Terminus "Drittes Reich" erscheint aufgrund seiner ideologischen Vorbelastung ungeeignet, zumal die Nationalsozialisten 1939 selbst vom Gebrauch dieses Begriffes abrückten47.
Der Ausdruck "Faschismus" sollte ohne nähere Bezeichnung nur als generalisierender Oberbegriff verwendet werden. In der vorliegenden Arbeit werden spezielle Ausprägungen des Nationalsozialismus untersucht. Inwieweit es sich dabei auch um spezifische Merkmale des Faschismus - etwa eines faschistischen Erdkundeunterrichts - handelt, kann dabei nicht geklärt werden, sondern muss der vergleichenden Faschismusforschung überlassen bleiben. LINGELBACH (1979, S. 43) hat bereits angeführt, dass die strukturell bedingte Erziehungsfeindlichkeit des Faschismus den Terminus "faschistische Pädagogik" zu einem Unbegriff, zur contradictio in adiecto stempelt. Auch die Kontinuität von Erziehungsformen aus der Zeit vor 1933 führt zu Schwierigkeiten mit dem Begriff. Lingelbach schlägt deshalb vor, den Unbegriff "faschistische Pädagogik" fallen zu lassen und stattdessen nach den Problemen und Tendenzen pädagogischer Theorie und Praxis unter faschistischer Herrschaft zu fragen. In diesem Sinne meint auch der hier benutzte Begriff "nationalsozialistischer Erdkundeunterricht" den Erdkundeunterricht unter dem nationalsozialistischen Regime.
Aufgrund dieser Überlegungen wird in der vorliegenden Arbeit stets von "Nationalsozialismus" oder "NS-Zeit" gesprochen. Dabei wird der Nationalsozialismus zwar als deutscher Faschismus begriffen, aber es wird nicht verkannt, dass er als solcher nicht hinreichend beschrieben ist. "Er ist mehr als das. Er trägt singuläre Züge. Darum sollte er im Sinne einer spezifischen Ambivalenz als eine Ausprägung des Faschismus und zugleich als etwas anderes, mehr als dies gesehen werden. Er trägt faschistische Züge, die er doch zerbricht. Sein 'Wesen' aber offenbarte er erst im Holocaust" (SCHMIDT 1985, S. 53).
2.3 Schultheoretische Vorüberlegung
Die bis Ende der siebziger Jahre vorliegenden Studien zur nationalsozialistischen Erziehung waren auf die prinzipielle Frage nach der Funktion von Schule während des Nationalsozialismus kaum eingegangen (NYSSEN 1979, S. 11). Dieses Defizit der disziplinhistori schen Studien war vor allem auf das Fehlen von schultheoretischen Reflexionen zurückzuführen. In der Zwischenzeit ist dieser grundlegende Aspekt der nationalsozialistischen Schule wesentlich besser untersucht worden. Neben der erwähnten Arbeit von NYSSEN (1979), die selbst versuchte diese Forschungslücke wenigstens ansatzweise zu schließen, hatte schon PREISING (1976) in ihrer Dissertation, die Nyssen offensichtlich nicht vorgelegen hatte, nach der Begründung einer Theorie der Schule im Nationalsozialismus, wie sie aus den zeitgenössischen Publikationen herauszulesen ist, geforscht. SCHOLTZ (1980) ist in seinem Aufsatz über "Die Schule als ein Faktor der nationalsozialistischen Machtsicherung" ausführlich auf einen Hauptaspekt der Funktion von Schule im Nationalsozialismus eingegangen. In seiner Gesamtdarstellung von Erziehung und Unterricht während der NS-Zeit arbeitet SCHOLTZ (1985) schließlich deutlich drei Phasen einer machtpragmatischen Instrumentalisierung der Schulpolitik und den damit einhergehenden Funktionswandel der Schule heraus. Jedoch gehen die drei zuletzt genannten Arbeiten nicht explizit von einem schultheoretischen Ansatz aus.
Trotz einiger Schwächen in der Untersuchung, insbesondere in der bildungsökonomischen Deutung der Lehrpläne und Richtlinien, erscheint mir der schultheoretische Ansatz von NYSSEN (1979) als analytisches Instrumentarium weiterhin geeignet. Deshalb wird dieser Ansatz in der vorliegenden Arbeit für die Analyse der Funktion des Erdkundeunterrichts im Nationalsozialismus verwendet.
Nyssen entwickelt ihre Untersuchungskategorien auf der Grundlage der bildungssoziologisch orientierten Ansätze einer Theorie der Schule. Nach ADL-AMINI (1976, S. 90f.) reflektiert die Theorie der Schule "über die gesellschaftlichen Bedingungen der Möglichkeiten von Schule", insbesondere über die außerschulischen Entscheidungs prozesse, namentlich die curricularen und organisatorischen Vorentscheidungen, die das innerschulische Geschehen grundlegend bestimmen. "Sie entlarvt ideologiekritisch die in diesen Entscheidungen versteckten Partialinteressen und macht sie dadurch bewußt und durchsichtig."48
Um diese "gesellschaftlichen Implikationszusammenhänge für das innerschulische Geschehen" differenzierter analysieren zu können, greift NYSSEN (1979, S. 12f.) auf die Kategorien der gesellschaftstheoretischen Analyse des Schulsystems zurück. Diese Kategorien arbeiten die unterschiedlichen Funktionen von Schule heraus. Dabei sind nach FEND (1974) drei Funktionen von Schule zu unterscheiden:
1. Die Funktion der Qualifikation. Diese Reproduktionsfunktion des Produktionssektors meint "die Vermittlung von Fertigkeiten und Kenntnissen..., die zur Ausübung 'konkreter' Arbeit und zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erforderlich sind" (ebd., S. 65).
2. Die Funktion der Integration. Diese Reproduktionsfunktion des politischen Systems meint die Vermittlung "von solchen Normen, Werten und Interpretationsmustern..., die zur Sicherung wünschenswerter Herrschaftsverhältnisse dienen" (ebd., S. 66). Hier gilt es zu untersuchen, "welche Formen der Manipulation und Indoktrination das Schulsystem anwendet, um der Gesellschaft eben solche Integrationsdienste zu leisten" (ebd., S. 183). Diese Funktion trägt gleichzeitig zur Legitimation der gesellschaftlichen Machtverhältnisse bei.
3. Die Funktion der Selektion. Diese Reproduktionsfunktion der Sozialstruktur beinhaltet gleichzeitig die Allokationsfunktion des Schulsystems und meint den Prozess, über den "in deutlicher Interaktion mit der sozialen Herkunft der Schüler definierte Prozentsätze von Schülern in höhere und niedrigere berufliche Positionen kanalisiert" werden (ebd., S. 66).
Während Fend alle drei Funktionen auf der gleichen systematischen Ebene ansiedelt, begreift Nyssen die Selektion als abgeleitete Funktion der beiden übergeordneten Funktionen der Qualifikation und der Integration. Diese Unterscheidung erscheint sinnvoll, da sowohl Integration als auch Qualifikation notwendigerweise eine Auslese bedingen. Die drei Funktionen, die untereinander durchaus Widersprüche hervorrufen können, werden deshalb nur zugunsten der analytischen Klarheit getrennt.
Ziel der Arbeit von NYSSEN (1979, S. 15) war es, "das Verhältnis der Funktionen von Schule untereinander für die Zeit des Nationalsozialismus zu konkretisieren" und "die Integrationsfunktion von Schule am Beispiel des Nationalsozialismus zu präzisieren". Sie kommt schließlich zu dem Ergebnis, dass in den Erlassen bis 1937 die Ideologievermittlungsfunktion von Schule deutlich im Vordergrund steht, während die Forderung nach einer Qualifizierung der Schüler kaum gestellt wird. In den Lehrplänen ab 1937 manifestieren sich dann aber doch gleichzeitig die Erfordernisse des Produktionssektors durch Forderungen nach bestimmten Qualifikationen. In diesem Widerstreit der Integrations- und der Qualifikationsfunktion, gleichzeitig eine irrationale Ideologie sowie rationales Wissen und Fertigkeiten zu vermitteln, sieht Nyssen die "spezifische Widersprüchlichkeit der Schule im Nationalsozialismus" (ebd., S. 143). Am Beispiel des Mathematikunterrichts versucht sie diese Thesen weiter zu belegen.
Gegen diese bildungsökonomische Deutung muss kritisch eingewandt werden, dass von offizieller Seite erst ab 1938 schulische Gesamtkonzeptionen in Form von vollständigen Lehrplänen vorgelegt wurden. Dass die vorhergehenden partiellen Erlasse vorrangig auf Ideologievermittlung abzielten, um auf diesem Gebiet die Schule möglichst schnell nationalsozialistisch auszurichten, ist nur allzu verständlich und darf nicht überinterpretiert werden49. Das Jahr 1937 erscheint deshalb als Scheidepunkt zwischen der Forderung nach Dequalifizierung und der nach Qualifizierung sehr fragwürdig.
Doch auch in der Arbeit von SCHOLTZ (1985) wird das Jahr 1937 als Wendepunkt der Schulpolitik betrachtet. Jedoch unterscheidet Scholtz nicht zwei sondern drei Phasen der nationalsozialistischen Erziehungspolitik:
Phase 1933-1936: Machtergreifung und Machtsicherung
Phase 1937-1940: Machtdarstellung und Kriegsvorbereitung
Phase 1941-1945: Machtausweitung und innerer Zerfall
In der vorliegenden Arbeit wird nun untersucht, welche unterschiedlichen Phasen sich bei der Konzeption des nationalsozialistischen Erdkundeunterrichts nachweisen lassen. Gleichzeitig gilt es zu klären, inwieweit sich die Thesen von Nyssen und die zeitliche Untergliederung von Scholtz bestätigen lassen. Es wird sich bei dieser Analyse zudem zeigen, ob die Forderungen der Fachdidaktiker nach Änderung des Fachunterrichts, wie beim Mathematikunterricht50, nur als Floskeln Eingang in die Lehrpläne gefunden haben oder ob es wirklich eine einschneidende Neukonzeption gab. Die Quellenlage erweist sich mit der Untersuchung der fachdidaktischen Beiträge, der Lehrpläne und Richtlinien, der Schulbücher und des Aktenmaterials sowie mit der kombinierten Längs- und Querschnittsanalyse für diese Fragestellung von höchster Dichte.
Mit Hilfe des schultheoretischen Ansatzes soll außerdem die Frage nach der Funktion des Erdkundeunterrichts im Nationalsozialismus geklärt werden. Interessant ist vor allem die Frage, welche Aufgaben dem Erdkundeunterricht über die Ideologievermittlungsfunktion hinaus zugesprochen wurden und welche er tatsächlich übernahm. Desgleichen werden die Widersprüche zwischen diesen Funktionen und die zwischen den Forderungen der Fachdidaktiker und der Lehrpläne herausgearbeitet. Dabei werden auch Vergleiche zu anderen Schulfächern, etwa zum "widersprüchlichen"51 Mathematikunterricht, gezogen.
Durch die Klärung dieser Fragenkomplexe soll eine abschließende Einordnung des Erdkundeunterrichts in den Gesamtzusammenhang von Schule im Nationalsozialismus ermöglicht werden.
3 Stellung und inhaltliche Konzeption des Erdkundeunterrichts nach der Preußischen Schulreform von 1924/25 und die Entwicklung bis 1933
3.1 Die Aufwertung des Erdkundeunterrichts durch die Preußische Schulreform von 1924/25
Das ambivalente Selbstverständnis der geographischen Wissenschaft als Natur- und Geisteswissenschaft prägte zu Beginn des 20.Jahrhunderts die Diskussion um die Stellung der Erdkunde im Schulunterricht. 1905 hatte der Naturforschertag in Meran die Erdkunde von den naturwissenschaftlichen Fächern ausgegrenzt und eine entsprechende Berücksichtigung der naturwissenschaftlichen und mathematischen Unterrichtsfächer in den Lehrplänen gefordert52. Die scharfe Kritik der Geographen fand ihren Niederschlag im Entwurf eines eigenen Lehrplanes auf dem Geographentag 1914, dem sogenannten "Straßburger Lehrplan"53, der den Dualismus von Natur- und Kulturlandschaft und die Vermittlung sowohl physischgeographischer als auch anthropogeographischer Kenntnisse ausdrücklich betonte. Dieser Lehrplan und die abgeleiteten Lernziele gingen dabei von einem zweistündigen Unterricht auf allen Klassenstufen aus. In den Lehrplänen von 1901 war der Erdkunde auf der Oberstufe allerdings nur teilweise ein einstündiger Unterricht, zudem noch in Verbindung mit Geschichte, zugebilligt worden. Dies hatte jedoch zu enttäuschenden Ergebnissen geführt. Während daraufhin das Preußische Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung54 im Dezember 1917 eine stärkere Betonung des Geologieunterrichts verfügte, um den Erdkundeunterricht. deutlicher vom Geschichtsunterricht zu trennen, forderten die Geographen immer eindringlicher einen eigenständigen, zweistündigen Oberstufenunterricht. Als verbandspolitische Forderung der deutschen Geographen blieb der Straßburger Lehrplan die Diskussionsgrundlage für den Lehrplan der Deutschen Oberschule von 1923 und die Richtlinien von 1925.
Die erste Initiative zur Reform des Erdkundeunterrichts ging Ende 1920 vom Preußischen Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung aus, das von dem Geographen Hermann Wagner55 und dem Deutschen Ausschuß für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht56 jeweils ein Gutachten anforderte57. Zu dieser Zeit galt für die Höheren Schulen immer noch der Lehrplan von 1901, wonach das "Allgemeine Lehrziel" des Erdkundeunterrichts lautete: "Verständnisvolles Anschauen der umgebenden Natur und der Kulturbilder. Kenntnis der physischen Beschaffenheit der Erdoberfläche und der räumlichen Verteilung der Menschen auf ihr, sowie Kenntnis der Grundlage der mathematischen Erdkunde."58
Nach den "methodischen Bemerkungen" sollte besonders "der praktische Nutzen des Faches für die Schüler" beachtet werden. Im Unterschied dazu bezog Wagner in seinem Gutachten vier weitere Bereiche in den Erdkundeunterricht mit ein: Wirtschaftsgeographie, Kulturgeographie, astronomische Geographie und Geologie. Damit versuchte er, eine eigenständige Begründung des Erdkundeunterrichts zu liefern.
In seinem Gegengutachten plädierte Albrecht Penck59 wiederum für eine stärkere Betonung der Kulturgeographie, wobei er besonders die nationale Bedeutung des Erdkundeunterrichts herausstellte60.
Auffallend nationalistisch klang die Begründung des Erdkundeunterrichts durch den Deutschen Ausschuß für den mathematischnaturwissenschaftlichen Unterricht. In seinem Gutachten findet sich als Lehrziel für die Oberprima: "Das Deutschtum auf der Erde, seine Bedeutung für das Mutterland und seine Kulturaufgabe, besonders die Lage der deutsch-völkischen Minderheiten in den neuen Staatsgebilden Mitteleuropas ..."61
Bei der Formulierung des Gesamtziels tritt deutlich die politische Situation des Deutschen Reiches nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg zutage. Der Erdkundeunterricht sollte mithelfen, die 'Schmach von Versailles' zu überwinden: "Unsere gesamte Volkserziehung hat jetzt kein höheres Ziel, als das deutsche Volk durch Stärkung seiner körperlichen, geistigen und sittlichen Kräfte und durch klare Einsicht in seine gegenwärtige Lage zum erneuten Aufstieg zu befähigen. Diese Einsicht vorbereiten zu helfen, ist der erdkundliche Unterricht in erster Linie mit berufen."62
Diese drei Fachgutachten lagen vor, als das Preußische Kultusministerium, namentlich der für das Höhere Schulwesen zuständige Ministerialrat Hans Richert, nach dem Scheitern der Reichsschulkonferenz von 192063 eine Reform des Höheren Schulwesens vorbereitete. Die kulturelle Lage und Entwicklungsgeschichte der Länder, die zudem eifersüchtig über ihre Kulturhoheit wachten, hatten sich als so verschieden erwiesen, dass eine reichseinheitliche Neuordnung des Schulwesens auf der Reichsschulkonferenz und im Reichsschulausschuß64 nicht hatte erreicht werden können65. In dieser Situation übernahm Preußen, das immerhin etwa 60% des Reichsgebietes und 65% der Gesamtbevölkerung umfasste, den Versuch, stellvertretend für das Reich eine annehmbare Schulreform zu schaffen, in der Überzeugung, dass die kleineren Länder ihm folgen würden. Diese Reform des Höheren Schulwesens, wesentlich geprägt von Hans Richert, erwies sich als weitgehend restaurativ, auch wenn sie darüber hinaus weiterführende Ansätze beinhaltete66. Sie begann mit der Einführung der Deutschen Oberschule im Februar 1922 als viertem Typ der Höheren Schule, neben dem Gymnasium, der Oberrealschule und dem Realgymnasium, und fand ihren vorläufigen Abschluss in der Veröffentlichung der "Richtlinien für die Lehrpläne der höheren Schulen Preußens" im April 1925.
Bereits die "Richtlinien für einen Lehrplan der Deutschen Oberschule und der Aufbauschule" von 1924 brachten dem Erdkundeunterricht eine große Aufwertung67. Er fand seine Begründung im "kulturkundlichen Gesamtunterricht", in dem die kulturkundlichen Kernfächer Religion, Deutsch, Geschichte und Erdkunde gemeinsam die für jede Klassenstufe gestellten Aufgaben lösen sollten. Zwar stand diese Begründung im Gegensatz zu den Bestrebungen nach Etablierung eines eigenständigen, abgegrenzten Erdkundeunterrichts, wie ihn Hermann Wagner in seinem Gutachten gefordert hatte, doch bedeutete die Einordnung als kulturkundliches Kernfach mit einem zweistündigen Unterricht auch auf der Oberstufe eine beachtliche Aufwertung und Anerkennung. Richert vermied es, in der Bestimmung des Bildungsauftrages der Erdkunde die wissenschaftstheoretische Problematik der Geographie mit aufzunehmen68. Auch wenn die Erdkunde methodologisch sowohl Natur- als auch Geisteswissenschaft vermitteln sollte, wurde sie letztlich doch als Geisteswissenschaft begriffen, die im Unterricht der praktischen Lebensgestaltung dienen sollte.
Das bildungspolitische Interesse dieser Richtlinien lag vor allem darin, die Schule in den Dienst des nationalen Wiederaufstiegs zu stellen. Richert griff dabei den deutsch-nationalen Bildungsgehalt des Erdkundeunterrichts, wie er durch die Wissenschaft, insbesondere im Gutachten des Deutschen Ausschusses für den mathematischnaturwissenschaftlichen Unterricht, begründet worden war, auf und stellte ihn unter das pädagogische Prinzip der nationalen Bildungseinheit, das er in seinem bedeutsamen Hauptwerk "Die deutsche Bildungseinheit und die höhere Schule" (RICHERT 1920) entwickelt hatte.
Die "Richtlinien für die Lehrpläne der höheren Schulen Preußens" vom April 1925 folgten weitgehend dem Weg, den die Richtlinien für die Deutsche Oberschule gewiesen hatten. Erdkunde wurde auch hier zu den "Kernfächern" gezählt, die "das deutsche Bildungsgut" überliefern sollten. Weiter hieß es dazu: "Diese Mittelpunktstellung der Kernfächer gewährleistet den inneren Zusammenhang der höheren Schule mit der Volkschule und der höheren Schule untereinander"69.
Die Verbindung der Höheren Schule zur Volksschule, die von den weitaus meisten Schülern eines Jahrgangs besucht wurde, lag in der neu gestellten Aufgabe, "die Volksschullehrer vorzubilden und damit die Verantwortung für die gesamte Volksbildung zu übernehmen"70. Das erklärte Ziel des Erdkundeunterrichts lautete: "Der Unterricht in der Erdkunde soll in Arbeitsgemeinschaft mit den anderen Kernfächern im Schüler die Liebe zu Scholle, Heimat und Vaterland wecken und pflegen, zum Verständnis der deutschen Kultur in Vergangenheit und Gegenwart beitragen und den Schüler zum deutschen Staatsbürger erziehen helfen."71
Der Erdkundeunterricht findet somit auch hier seine Begründung in einem nationalen Bildungsauftrag. Wie noch eingehender zu zeigen sein wird, sind in dem so formulierten Bildungsziel bereits beinahe alle Grundkomponenten des Erdkundeunterrichts der NS-Zeit in Motivform angelegt. Diese Motive wurden später von den Nationalsozialisten aufgegriffen, weiterentwickelt und ideologisiert. Das gilt vor allem für die Weckung einer irrationalen Liebe zur Heimat und zum Vaterland sowie für die nationalpolitische Erziehung zum deutschen Staatsbürger. In dem Motiv "Verständnis der deutschen Kultur in Vergangenheit und Gegenwart" sind sowohl die historisierende Betrachtung und die Berufung auf das Germanentum als auch die kritiklose Anerkennung der gegenwärtigen deutschen Politik implizit mitenthalten. Selbst der Mythos von "Blut und Boden" ist in der "Liebe zur Scholle" bereits angelegt.
In einem der aufgeführten Feinziele tauchen mit der Untergliederung nach Rassen, allerdings ohne erbbiologische Ausdeutung, und der Abhängigkeit der Menschen von der Lage ihres "Lebensraumes" noch zwei weitere wesentliche Bestandteile des späteren nationalsozialistischen Erdkundeunterrichts auf: "Er soll die räumliche Verbreitung der nach Rassen und Völkern, Wirtschaftsstufen und -formen sowie staatlichen Gebilden gegliederten Menschheit in ihrer Abhängigkeit von der Lage der natürlichen Ausstattung ihres Lebensraumes kennen lehren."72
Das gleiche gilt für die Behandlung der "Entdeckungs- und Kolonialgeschichte", "geopolitischer Probleme" und "im Hinblick auf das Deutschtum in der Welt"73. Auch das Grundkonzept einer Heimatkunde, die sich zur "Vaterlandskunde" erweitert, wird hier explizit benannt74. Es sollte sich in den nächsten zwanzig Jahren nicht verändern. Formal brachte die Preußische Neuordnung des Höheren Schulwesens eine Aufwertung des Erdkundeunterrichts vor allem durch die Etablierung der Erdkunde in allen Klassen der Oberstufe. Jedoch wurde die Einstündigkeit des Oberstufenunterrichts - mit Ausnahme der zwei Stunden auf der Deutschen Oberschule - zugleich zu einem Hauptkritikpunkt der Geographen. Positiv vermerkte der Verband Deutscher Schulgeographen zudem den, für den Erdkundeunterricht seiner Meinung nach gut umgesetzten, Arbeitsschulgedanken und die Stoffverteilung, die im Wesentlichen den Vorschlägen des Verbandes gefolgt war (vgl. SCHILLING 1981).
Kurze Zeit nach den Richtlinien für die Höheren Schulen erschienen im Juni 1925 auch neue "Bestimmungen über die Mittelschulen in Preußen"75, die an die Stelle der Bestimmungen vom Februar 1910 traten. Darin ging es nicht um eine Neuordnung des Mittelschulwesens, sondern lediglich um eine inhaltliche Erneuerung, eine Angleichung an die veränderten Gegebenheiten. Eine wesentliche Neuerung war, dass die lehrplanmäßige Ausgestaltung der Bestimmungen den verschiedenen Schulen überlassen wurde.
Der Erdkunde wurde auf allen sechs Stufen, sowohl bei den Jungenals auch bei den Mädchenschulen, ein zweistündiger Unterricht zugebilligt. Lediglich in der Abschlussklasse des hauswirtschaftlichen Zweiges der Mädchenschulen war nur eine Stunde Erdkunde vorgesehen.
Ziel des Erdkundeunterrichts war die Vermittlung von physischgeographischen und kulturgeographischen Inhalten. Unter letzteren wurde vor allem "politische Erdkunde" verstanden. Wörtlich formulierten die Bestimmungen das Ziel des Erdkundeunterrichts als:
"Vertrautheit mit dem deutschen Vaterlande nach seiner natürlichen Beschaffenheit, der Beziehung zwischen seiner Natur und seinen Bewohnern und seiner politischen Gestaltung. Nähere Bekanntschaft mit Europa und allgemeinere mit den übrigen Erdteilen. Einiges Wissen von dem Bau und der Gestaltung der Erde, von der sie umschließenden Lufthülle und der Stellung der Erde als Weltkörper."76
Grundlegendes Prinzip war auch hier die Heimatkunde, die den Blick in die Welt lenken sollte: "Überall wird durch die Beziehung zur Heimat die Einsicht in deren erdkundliche Eigenart gefördert, wie umgekehrt aus der Kenntnis der Heimat tieferes Verständnis für die Fremde erwächst."77Methodisch galt es "physikalische und politische Erdkunde aufs engste zu verbinden"78. Das bedeutete für die achte Klasse inhaltlich z.B.: "Die fremden Erdteile unter Hervorhebung der für Deutschland wichtigeren Gebiete, insbesondere der früheren deutschen Kolonien"79. Und in Klasse zehn: "Deutsche Kolonialarbeit. Die für Deutschland wichtigen Rohstoffgebiete und Absatzländer. Grenz-und Auslandsdeutschtum, insbesondere in seiner Bedeutung für Volkstum und Wirtschaft."80
Diese Beispiele belegen deutlich die nationale Ausrichtung des Erdkundeunterrichts auch in den Mittelschulen. Die auffällige Hervorhebung der abgetretenen Reichsgebiete und Kolonien bildete dabei zweifellos einen Nährboden für revisionistische Gedanken. Die Grundlage für den Erdkundeunterricht der Weimarer Republik lieferte somit eher das Deutsche Reich in seinen Grenzen von 1914 einschließlich seiner kolonialen Besitzungen als das des Versailler Vertrages.
Für die Volksschule galten in Preußen die Richtlinien von 1921 bzw. 1923. Dort wurde in den unteren vier Jahrgängen, also in der Grundschule, ausschließlich die Heimatkunde und der heimatkundliche Anschauungsunterricht gepflegt81.
Nach den "Richtlinien zur Aufstellung von Lehrplänen für die oberen Jahrgänge der Volksschule" von 1923 wurde Erdkunde in den Klassen 5-8 jeweils zweistündig erteilt. Das Unterrichtsziel unterschied sich in seiner nationalen Ausrichtung nicht von denen der Mittel- und Höheren Schule: "Vertrautheit mit der Heimat, nähere Kenntnis Deutschlands einschließlich des deutschen Sprachgebietes außerhalb der Reichsgrenzen, übersichtliche Bekanntschaft mit fremden Ländern und Erdteilen und Verständnis für die Stellung der Erde im Weltall."82
Neben der "Vaterlandskunde" galt es "vorwiegend die Länder zu behandeln, in denen Deutsche leben und wirken und zu denen Deutschland bedeutsame Beziehungen unterhält"83.
Nach der Neuordnung des Schulwesens in Preußen in den Jahren 1923-1925 stehen in allen Schulen die kulturkundlichen Fächer mit nationaler Ausrichtung im Mittelpunkt der gesamten Bildungsarbeit. Für die Richtlinien ist "charakteristisch, dass der Völkerbundgedanke nur mehr beiläufig Erwähnung findet, während 'die Notwendigkeit deutschen Kolonialbesitzes' besonders hervorgehoben und auch das Auslandsdeutschtum nicht vergessen wird" (MARGIES 1972, S. 125). Die Erdkunde spielt bei dieser Neuordnung eine bedeutende Rolle. Sie erfährt durch ihre Aufnahme in die Gruppe der Kernfächer und ihre Etablierung auf der Oberstufe eine beachtliche Aufwertung, die ihre wissenschaftstheoretischen Legitimationsprobleme vergessen lässt.