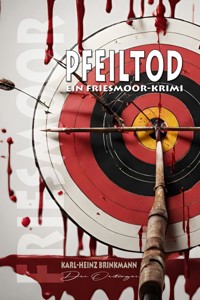Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein stilles Dorf, ein Jahrhundertgeheimnis und ein Mord, der die Vergangenheit weckt. Osten an der Oste, 1973. Das kleine Dorf befindet sich im Umbruch, gefangen zwischen Tradition und dem Aufbruch in eine neue Ära – und umgeben von einem hartnäckigen Schweigen. Als auf der altehrwürdigen Schwebefähre eine Leiche entdeckt wird, gerät die beschauliche Ruhe jäh ins Wanken. Das Opfer hat weder Ausweis noch Namen, nur ein Bahnticket, das seine Herkunft aus Hamburg nahelegt. Kriminalhauptkommissar Bernhard Kruse nimmt die Ermittlungen auf, doch schnell merkt er: In Osten hält man zusammen. Die alten Bande sind zu eng, und die Geheimnisse sitzen zu tief. Die verschlossene Dorfatmosphäre wirkt wie ein undurchdringlicher Nebel. Als kurz darauf ein zweiter Toter im Schilf gefunden wird, führen die Spuren Kruse nicht nur über die nahe Baustelle der neuen Brücke, sondern auch tief in die Geschichte der Schwebefähre selbst. Mithilfe der Heimathistorikerin Theda Liebknecht stößt Kruse auf das Tagebuch der jungen Marie Schiller und legt ein Jahrhundertgeheimnis frei, das bis in die Gegenwart nachwirkt. Es geht um die unglückliche Geschichte der Bäckerstochter Marie und eines verschwundenen Bauarbeiters aus dem Jahr 1909. Je tiefer Kruse gräbt, desto deutlicher wird: Es geht hier nicht nur um Mord, sondern um Schuld, Stolz und eine alte Fehde, die nie wirklich verziehen wurde. Ein atmosphärischer Kriminalroman über Loyalität, Verrat und die unerbittliche Macht der Vergangenheit – an einem Ort, wo die Oste still fließt und jedes Geheimnis seine Zeit braucht, um an die Oberfläche zu kommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karl-Heinz Brinkmann
… und still fließt die Oste
Ein Schwebefähren-Krimi
Danksagung
Die vielen Begegnungen mit Menschen am Fluss und auf der Schwebefähre haben mich zu diesem Buch inspiriert. Die Faszination für dieses besondere Bauwerk und der Umbruch, den die neue Schwebefähre 1909 für das Dorf bedeutete – später abgelöst von der festen Brücke im Jahr 1974 – haben mich nicht losgelassen. Was hat das für die Menschen damals geheißen, wie eng waren sie mit diesen Bauwerken verbunden?
Mein Dank gilt all denjenigen, die dazu beigetragen haben: den Arbeitern, die die Schwebefähre errichteten, und denen, die den Bau der Brücke möglich machten. Ohne ihre Arbeit und ihre Geschichten wäre dieses Buch nicht entstanden.
Mein ganz besonderer Dank gilt meiner Lektorin Katharina. Mit ihrem wachen Blick, ihrer direkten Art und ihrem feinen Gespür für Sprache hat sie diesem Buch den letzten Schliff gegeben. Sie hat mich gefordert, ermutigt und immer wieder den richtigen Ton getroffen. Ohne sie wäre vieles unausgesprochen geblieben – so aber durfte das Buch genau die Stimme finden, die es gebraucht hat.
Danke euch allen von Herzen!
Über das Buch
Osten an der Oste, 1973. Ein Dorf zwischen Vergangenheit und Aufbruch – und zwischen hartnäckigem Schweigen. Als der Fährmann auf der altehrwürdigen Schwebefähre eine Leiche entdeckt, gerät die beschauliche Ruhe ins Wanken. Ohne Ausweis, ohne Namen, nur ein Bahnticket von Hamburg nach Basbeck-Osten in der Tasche. Kriminalhauptkommissar Bernhard Kruse nimmt die Ermittlungen auf – doch schnell merkt er: In Osten hält man zusammen. Zu eng sind die alten Bande, zu tief sitzen die Geheimnisse. Als ein zweiter Toter im Schilf gefunden wird, führen die Spuren nicht nur über die nahe Baustelle der neuen Brücke, sondern auch tief in die Geschichte der Schwebefähre selbst. Mit Hilfe der Archivarin Theda Liebknecht stößt Kruse auf das Tagebuch der jungen Marie Schiller – und auf ein Jahrhundertgeheimnis, das bis in die Gegenwart nachwirkt.
Je tiefer er gräbt, desto deutlicher wird: Es geht nicht nur um einen Mord, sondern um Schuld, Stolz und eine alte Fehde, die nie wirklich verziehen wurde.
Ein atmosphärischer Kriminalroman über Loyalität, Verrat und die Macht der Vergangenheit – an einem Ort, wo die Oste still fließt und jedes Geheimnis seine Zeit braucht, um an die Oberfläche zu kommen.
Impressum
1. Auflage, 2025
© 2025 Alle Rechte vorbehalten.
Der Oestinger
Karl-Heinz Brinkmann
c/o IP-Management #47918
Ludwig-Erhard-Str. 18
20459 Hamburg
www.der-oestinger.de
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
… und still fließt die Oste
Ein Schwebefähren-KrimiKarl-Heinz Brinkmann
1
Ein unerbittlicher Rhythmus schlug Tag für Tag in das friedliche Antlitz der Oste. Kaum hatte der erste Hahn seine Morgenhymne angestimmt, erhob sich an der gewaltigen Baustelle der neuen Schwebefähre ein ohrenbetäubendes Crescendo aus Stahl, Schweiß und Maschinenlärm. Dort, wo einst sanfte Brisen über das Wasser strichen, wuchs nun ein monumentales Bauwerk in den Himmel – mehr als nur eine Verbindung zwischen zwei Ufern. Es war das kühne Versprechen der Gemeinde an sich selbst: ein stählernes Ausrufezeichen des Fortschritts, das den Ort mit aller Macht in eine neue Ära katapultieren sollte.
Während die einen in der ungewohnten Dynamik eine düstere Vorahnung spürten, träumten andere bereits von goldenen Zeiten. In dem stählernen Giganten sahen sie eine sprudelnde Einnahmequelle für die Gemeindekasse. Hinter verschlossenen Türen der Amtsstuben rieben sich die Verantwortlichen die Hände: Ihr ambitionierter Plan, etwas Einzigartiges zu erschaffen, schien aufzugehen.
Die Sonne färbte den östlichen Horizont in zarte Rosatöne, während ein vielstimmiges Vogelkonzert den neuen Tag willkommen hieß. Über den taufrischen Feldern schwebte ein feiner Dunstschleier, der einen prächtigen Sommertag verhieß. An der beinahe vollendeten Schwebefähre trafen die ersten Maler ein – unter ihnen August Johannson und Alvin Malstedt, zwei ungestüme Glücksritter mit einem ständigen Schalk im Nacken.
»Na, wie war die Nacht, mein wackerer Zecher?«, fragte August mit einem breiten Grinsen, die Augenbrauen vielsagend hochgezogen.
Alvin erwiderte das Grinsen mit einem Augenzwinkern, das mehr sagte als tausend Worte. »Feuchtfröhlich wie immer. Meine Leber ist erneut einen Heldentod für die gute Laune gestorben.«
Lachend schlenderten sie auf die Baustelle zu – doch mitten auf dem Weg blieben sie abrupt stehen. Eine Erscheinung war ihnen entgegengekommen, so anmutig, dass selbst die Müdigkeit der frühen Stunde augenblicklich von ihnen abfiel. Langes, pechschwarzes Haar umrahmte ihr zartes Gesicht und tanzte leicht im Wind. Ihr knöchellanges Kleid verhüllte nicht, es betonte – geheimnisvoll und elegant. Die sattgrüne Kittelschürze setzte einen frischen, fast ländlich heiteren Akzent.
Ein Hauch von Verlegenheit glitt über ihre Lippen – ein kaum merkliches Lächeln, das mehr verriet, als sie vielleicht wollte. Als die beiden Männer näherkamen, senkte sie den Blick, ihre Wangen röteten sich leicht, und sie huschte an ihnen vorbei, als wollte sie mit dem Morgennebel verschmelzen.
»Holla die Waldfee – was für ein Anblick!«, entfuhr es Alvin, während er theatralisch seinen Hut lüftete.
August setzte nach, die Stimme rau vor ungestümer Neugier: »Schon Pläne für den Abend, holdes Fräulein? Vielleicht ein gemeinsames Studium des Sternenhimmels über der Oste?«
Doch die junge Frau schien sich von derlei Floskeln nicht beeindrucken zu lassen. Als sie an ihnen vorbeiging, fühlte sie das Prickeln im Nacken, diesen hauchdünnen Schleier von Aufmerksamkeit, der sich auf sie legte wie Morgentau auf die Felder. Und doch blieb sie ruhig. Ihre Schritte waren leicht, aber bestimmt, als gehörte der frühe Morgen allein ihr.
Sie wusste, sie würde ihnen wieder begegnen. Das war unausweichlich. Alles hier war unausweichlich – wie das Ziehen eines Sturms, lange bevor er die ersten Äste knicken ließ.
Ohne einen Blick zurück ging sie weiter, als hätten ihre Ohren sich verschlossen. Und doch – sie spürte die Blicke der beiden Männer in ihrem Rücken. Ganz tief in ihr regte sich ein leiser Funke stiller Freude darüber, begehrt zu werden. Nur die allzu direkte Art der beiden widersprach ihrem feinen Wesen.
August und Alvin blickten ihr noch hinterher, bis ihre schlanke Gestalt hinter der Glastür eines Ladens verschwand.
»Hast du gesehen, wo sie hineingegangen ist?«, fragte Alvin ungeduldig. »Folgte sie dem Duft frischer Brötchen oder dem verheißungsvollen Klang klirrender Gläser?«
»Aber sicher doch, mein Freund«, entgegnete August mit einem selbstzufriedenen Grinsen, das Alvins Neugier nur weiter anfachte. August hatte einen entscheidenden Vorteil – welchen, das sollte sich bald zeigen.
»Und? Wirst du dein Geheimnis mit mir teilen?«, fragte Alvin drängend, während die Ungewissheit in ihm nagte.
»Warum sollte ich? Vielleicht will ich die Sterne ja doch lieber allein studieren«, erwiderte August mit einem schelmischen Grinsen und setzte seinen Weg zur Baustelle fort.
Alvin trottete hinter August her, doch seine Gedanken schienen auf eigenen Wegen unterwegs zu sein. Immer wieder tauchte ihr Gesicht vor seinem inneren Auge auf – diese Mischung aus Zartheit und einer unaussprechlichen Tiefe, als würde sie mehr wissen, als sie preisgab. Er hatte schon viele Frauen gesehen, viele flüchtige Flammen und vergängliche Liebeleien, doch sie…
Etwas an ihr ließ ihn innehalten, obwohl sie kaum ein Wort gesprochen hatte. Vielleicht war es genau das – das Schweigen. Es legte sich wie ein Schleier über sie, ein Rätsel, das ihn magisch anzog.
Wenn ich sie wiedersehe, muss ich anders sein, dachte er. Nicht der Witzbold, nicht der joviale Kumpeltyp. Nein, er würde ernst sein. Aufrichtig. Vielleicht zum ersten Mal.
Ein letzter Rest Vernunft hielt ihn davon ab, ihr einfach zu folgen. Nein, er würde warten. Auf eine zufällige Begegnung, einen günstigen Moment. Und dann – dann würde er all seinen Mut zusammennehmen und sie ansprechen. Mit Würde. Mit Stil. Auf eine Weise, die ihrer Anmut gerecht wurde.
August hingegen verfolgte längst einen eigenen Plan. »Du, Alvin… mir wird auf einmal ganz seltsam. Ich glaub, das letzte Bier gestern – das war wohl nichts mehr für Feinschmecker.« Er verzog das Gesicht und presste dramatisch die Hand auf den Bauch, gefolgt von einem überzeugenden Würgen.
»Ach du grüne Neune!«, rief Alvin erschrocken. »Ausgerechnet heute, wo wir endlich mit nach oben dürfen!«
»Tja, lässt sich nicht ändern. Stell dir mal vor, mir kommt das da oben hoch – das wäre kein Spaß für die Kollegen unter uns«, stöhnte August, nun gänzlich im Schauspiel versunken.
»Na gut, ich sag dem Bauleiter Pinette, dass du später nachkommst«, seufzte Alvin und ließ seinen angeblich leidenden Freund zurück. Die aufkeimende Verärgerung über Augusts plötzliche Schwäche mischte sich mit einer anderen Regung – einer brennenden Neugier auf die geheimnisvolle Fremde, deren Anblick ihm nicht mehr aus dem Kopf ging.
»Danke, mein Freund«, hauchte August mit übertriebener Schwäche und wedelte halbherzig zum Abschied mit seinem Hut.
Alvin beeilte sich, in den hämmernden Takt der Baustelle einzutauchen – jener eiserne Rhythmus, der den Tag bestimmte und jedes Zögern übertönen konnte.
August sah ihm noch einen Moment hinterher. Dann legte sich ein kaum merkliches, diabolisches Lächeln auf seine Lippen. Die gebeugte Haltung wich einer fast beschwingten Leichtigkeit. Mit federnden Schritten wandte er sich um – zurück zu jenem Ort, an dem das rätselhafte Fräulein verschwunden war.
Die Bäckerei, deren Duft bislang nur nach Mohnbrötchen und Hefegebäck gerochen hatte, trug für ihn nun eine neue, verheißungsvolle Bedeutung.
Ein zartes Glöckchen über der Tür kündigte Augusts Eintreten an. Die warme Luft der Bäckerei schlug ihm entgegen, durchtränkt von Vanille, Zimt und frisch gebackenem Brot. Hinter dem Tresen hantierte ein beleibter Mann mit mehlbestäubter Schürze, brummte ein altes Volkslied vor sich hin und schenkte August kaum Beachtung.
Aber sie war da. Marie.
Sie stand an der Seite, halb hinter einem Holzregal verborgen, gerade dabei, ein Tablett mit noch dampfenden Franzbrötchen von einem Blech zu schieben. Ihr Blick glitt kurz zu ihm – nur ein Augenblick – dann wieder zurück zur Arbeit. Kein Lächeln. Kein Wort. Und doch hatte August das Gefühl, dass sie ihn erkannt hatte.
Er räusperte sich. »Moin. Ich… also, ich dachte mir, ein Franzbrötchen könnte den Morgen noch retten.«
Der Bäcker lachte kehlig. »Na, dann haben Sie Glück. Die sind gerade aus dem Ofen.«
Marie trat nun hinter das Regal hervor. In der Hand ein Tuch, mit dem sie sich die Finger abwischte. Ihr Blick war offen, aber abwartend.
»Sie sind einer von den Malern an der Fähre, oder?«, fragte sie schließlich. Ihre Stimme war weicher, als August erwartet hatte, fast wie ein leiser Fluss im Morgendunst.
»August Johannson«, sagte er mit gespielter Förmlichkeit, lüftete den Hut. »Und Sie – Sie sind der Grund, warum ich mich krankgemeldet hab.«
Ein feines Lächeln zuckte über ihre Lippen, aber es hielt nicht lange.
»Das sollten Sie nicht sagen, Herr Johannson. Nicht jeder Mann, der sich nach mir umsieht, erlebt einen guten Tag.«
Er stockte, suchte in ihrem Ton nach Spott – fand aber etwas anderes. Eine Warnung?
»Vielleicht hab ich Glück. Vielleicht wär’s sogar Glück, Sie heute Abend auf einen Spaziergang einzuladen. Nur ein Stück den Fluss entlang. Sternenhimmel, wie versprochen.«
Sie schwieg einen Moment. Dann: »Heute Abend bin ich nicht da. Aber wenn Sie mich wirklich wiedersehen wollen – kommen Sie morgen. Zur gleichen Zeit. Vielleicht.« Und damit drehte sie sich um, verschwand durch eine halb geöffnete Tür, aus der kurz der würzige Duft nach dunklem Kaffee und… etwas anderem drang.
August stand noch einen Moment da, das Franzbrötchen in der Hand, das plötzlich ganz nebensächlich wirkte.
Der Bäcker sah ihm nach. »Schöner Teig, was?«, murmelte er. Doch es war nicht klar, ob er das Gebäck meinte – oder Marie.
Erst als die Mittagssonne ihren Zenit längst überschritten hatte und der Duft von Schweiß und Pausenbrot langsam verflog, tauchte August wieder auf der Baustelle auf. Mit betont lässiger Miene schulterte er sein Werkzeug und stieg die provisorische Treppe zum Gerüst hinauf, wo Alvin bereits emsig mit dem Pinsel zugange war.
»Na, mein Magenrebell? Geht’s dir wieder besser?«, rief Alvin, als er seinen Freund entdeckte. Ein Hauch von echter Besorgnis schwang in seiner Stimme mit.
»Blendend! Mir geht’s prächtig!« Augusts Grinsen breitete sich über sein Gesicht aus wie ein Sonnenaufgang nach einem Gewitter.
»Das freut mich. Aber du hast einiges aufzuholen, du alter Faulpelz«, konterte Alvin und deutete mit dem Pinsel auf die noch blanken Streben aus Stahl.
»Ja, ja, wird schon«, brummte August und machte sich widerwillig an die Arbeit.
Die beiden Männer saßen hoch oben auf dem Fährwagen – einer schwindelerregenden Plattform, die ihnen erlaubte, das stählerne Skelett bis in den letzten Winkel zu erreichen. Alvin arbeitete rechts, den Blick auf die ferne Mündung gerichtet, während August sich auf der linken Seite mühte. Auf knappe Kommandos der Männer unten setzte sich die Gondel knarzend in Bewegung – das schwere Dröhnen der Antriebsräder hallte durch das filigrane Gerüst wie ein fernes Donnergrollen.
Eine Weile herrschte Schweigen, nur unterbrochen vom rhythmischen Kratzen der Pinsel auf Metall.
Dann sagte Alvin leise, den Blick weiterhin auf seine Arbeit gerichtet: »Sag mal, August… dieses Mädchen von heute Morgen… ist sie dir hier in der Gegend schon mal begegnet?«
August schüttelte den Kopf, ohne ihn anzusehen. »Nein. Noch nie.«
Alvin seufzte, seine Stimme nun fast zärtlich. »Ich muss sie unbedingt wiedersehen. Ich weiß, das klingt verrückt, aber – ich glaube, ich hab mich verliebt.«
August hob kurz die Augenbrauen. Ein Anflug von Unruhe flackerte in seinem Blick, verschwand jedoch rasch. »Na dann… viel Glück bei der Sternenbeobachtung«, sagte er trocken und senkte wieder den Blick.
Ein Lächeln huschte über seine Lippen, kaum sichtbar. Die Erinnerung an Maries verlegenes Lächeln wärmte ihm das Herz – und ein winziges, kaum hörbares Knirschen breitete sich in der Stille zwischen ihnen aus.
August beendete seinen Abschnitt und gab dem Fährmann unten ein kurzes Zeichen. Die Gondel setzte sich ächzend in Bewegung. Von Alvin nahm er kaum noch Notiz – seine Gedanken waren längst bei Marie, bei dem Abend, der vor ihnen lag, bei flüchtigen Berührungen und versprochenen Blicken unter Sternenlicht.
Dann zerriss ein markerschütternder Schrei die Stille wie ein Donnerschlag.
August fuhr herum – zu spät. Eines der tonnenschweren Antriebsräder hatte Alvins Bein erfasst. Das grauenvolle Knacken von splitterndem Knochen war dem Schrei vorausgegangen. Blut schoss in pulsierenden Strömen aus der aufgerissenen Wunde, färbte das matte Metall mit schockierendem Rot. Die Schlagader war durchtrennt.
»Wir brauchen hier oben sofort Hilfe!«, schrie August, seine Stimme überschlug sich vor Entsetzen.
Die Männer unten reagierten geistesgegenwärtig. Mit zitternden Händen und vereinten Kräften brachten sie den Schwerverletzten über das Gerüst nach unten. Jeder Handgriff war begleitet von der bangen Frage, ob Alvin noch lebte. Sie betteten ihn auf eine Trage, eine einfache Konstruktion aus Stangen und Laken, und rannten mit ihm in Richtung Bahnhof Basbeck-Osten – ihr einziger Hoffnungsschimmer.
Doch noch bevor sie das Gebäude erreichten, entwich das Leben aus Alvins Körper. Sein Blick war leer, der Brustkorb reglos.
August, bleich wie die Wand des Wartesaals, trat dem herbeigeeilten Bahnbeamten entgegen. Seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, heiser vom Schreien, von der Schuld. »Er ist bewusstlos, zu viel Schnaps«, log er. Die Worte kamen automatisch, als hätte sein Innerstes beschlossen, die grausame Wahrheit für sich zu behalten – zumindest vorerst. Seine Hände, immer noch feucht vom Blut seines Freundes, zitterten.
Fortan lag ein bleierner Schatten über Augusts Dasein auf der Baustelle. Der Tod Alvins klammerte sich an ihn wie eine unsichtbare Krankheit, schwer und unerbittlich. Auch wenn die Bauleitung den tragischen Zwischenfall rasch und mit einer lakonischen Floskel – »bedauerlich, aber nicht unüblich auf Großbaustellen« – zu den Akten legte, ließ ihn das Geschehene nicht los. Das Bild des blutgetränkten Metalls verfolgte ihn bis in den Schlaf.
Trost fand seine gequälte Seele einzig in den flüchtigen Momenten mit Marie. Doch selbst dieses zarte Pflänzchen der Hoffnung stand unter einem finsteren Stern. Ihr Vater, der gestrenge Bäckergeselle Alfred Schiller, beäugte den jungen Mann aus Hamburg mit tiefem Misstrauen.
»Mädchen, lass dich nicht von so einem windigen Hallodri um den Finger wickeln«, hatte er ihr ins Gewissen geredet – mit einer Stimme, so rau wie die Kruste seiner Brote. Seine Worte zogen wie dunkle Wolken über das bescheidene Glück der beiden, ließen das heimliche Lächeln in Maries Gesicht immer seltener aufblühen.
Der Haussegen im Hause Schiller hing seither bedenklich schief.
Nur wenige Tage später war August Johannson wie vom Erdboden verschluckt. Ohne ein Wort des Abschieds, ohne eine Spur – er löste sich auf wie Nebel im Morgenlicht. Kein Bewohner der Gemeinde Osten hatte etwas gesehen, niemand wusste, wohin es ihn verschlagen haben mochte.
Auf der Baustelle und im Dorf begannen die Gerüchte zu blühen wie giftiges Unkraut. Die einen raunten von Schuld und Flucht, andere glaubten an einen Unfall, vertuscht und vergessen. Manche sprachen gar von dunkleren Dingen – von Stimmen im Nebel, von einem unheilvollen Blick in seinen Augen in den letzten Tagen.
In seiner Heimat Hamburg kam er nie an.
Und so wurde August Johannson zu einer weiteren rätselhaften Episode in der noch jungen Geschichte der modernen Schwebefähre – ein Name, den man mit einem Kopfschütteln erwähnte, wenn der Nebel sich an der Oste verdichtete und die Vergangenheit leise an die Tür klopfte.
***
»Was zum Teufel ist denn jetzt schon wieder los?« Ewald Gruneberg hämmerte frustriert auf den Hupenknopf seines blassgelben Opel Rekord – ein lautes, heiseres Aufbäumen gegen die bleierne Stille vor ihm. Mürrisch warf er einen Blick in den Rückspiegel: eine endlose Schlange stoisch wartender Fahrzeuge bis zum Horizont.
Fluchend öffnete er die Fahrertür. Die hitzige Luft des Sommers schlug ihm entgegen wie ein nasser Lappen. Er reckte den Hals, doch die Blechlawine vor ihm rührte sich keinen Millimeter.
»Das wird ja noch Stunden dauern, bis wir mit dieser verdammten Schneckenfähre über diesen Tümpel kommen! Und dann? Meinst du, wir kriegen die Elbfähre überhaupt noch?«, schnaubte er in Richtung seiner Frau Gertrud, die auf dem Beifahrersitz saß – gänzlich unbeeindruckt – und mit engelsgleicher Geduld Masche um Masche mit ihren Nadeln aus einem Wollknäuel formte.
»Ach, Ewald«, erwiderte sie mit der Gelassenheit eines bedachten Klosterschülers, »sich aufregen bringt doch nichts als Magengrimmen. Geh doch ins Wirtshaus und hol dir ein kühles Bier. Ich fahr den Wagen schon weiter, wenn’s vorangeht.«
Ihre Stimme plätscherte so ruhig dahin wie die Oste selbst – und wie so oft gelang es ihr mit dieser sanften Beharrlichkeit, Ewalds Groll in Durst umzuwandeln.
»Wenn du meinst«, grummelte er kleinlaut und stapfte los, in Richtung der beiden Gasthäuser, die sich rechts und links am Fuße der monströsen Schwebefähre duckten.
Er schlängelte sich an den wartenden Autos vorbei. In einem klammerte sich ein Kind kreischend an ein leuchtend grünes Plastikauto, während das andere mit erstaunlicher Zielgenauigkeit versuchte, seinen Bruder mit einer Brezel zu bewerfen. Genervte Elternaugen folgten Ewalds pfeifender Silhouette – »So ein Tag, so schön wie heute« – während er sich an ihnen vorbeischob. In diesem Moment war Ewald sich sicher: Seine kinderlose Ehe war ein Geschenk.
Er bog auf das Gasthaus zur Rechten ein – das zur linken Hand wirkte auf ihn irgendwie – feindselig. Gerade wollte er die schwere Eichentür öffnen, als diese mit einem Schwung nach außen aufflog. Nur ein geistesgegenwärtiger Schritt zur Seite bewahrte ihn vor einer schmerzhaften Begegnung mit dem Türblatt.
Ein Mann in dunklem Anzug, den Trenchcoat lässig über den Arm geworfen, stürmte heraus wie von der Tarantel gestochen.
»Weg da, du Landei! Ich hab’s eilig!«, schnauzte er Ewald an, der verdutzt einen Schritt zurückwich. Seine Augen weiteten sich – nicht wegen der Beleidigung, sondern wegen des Gesichts des Fremden.
Etwas daran war ihm seltsam vertraut.
Ewald rannte fluchend in Richtung Anleger, sein Bierbauch wippte empört bei jedem Schritt. Er war nicht gerade ein Sportler – eher der Typ, der beim Zusehen vom Schwitzen müde wurde –, doch jetzt trieb ihn der Schock, das alte Unrecht im Gesicht des Unbekannten gesehen zu haben, und der panische Gedanke, Gertrud könne mit dem Opel einfach ohne ihn verschwunden sein.
Die massive Schranke schwang langsam wieder zu, hinter ihm nur noch die letzten wartenden Autos. Die Fähre schob sich schon wieder zurück auf die andere Seite – seine Seite.
»Haben Sie Ihre Frau verloren?«, fragte ein älterer Herr mit Seemannsmütze und neugierigen Augen, der sich auf einen Spazierstock stützte.
Ewald blieb schwer atmend stehen.
»Meine Frau? Die Gertrud? Hat die jemand gesehen? Helles Haar, lila Bluse mit Katzen drauf? Strickt wie’n Weltmeister?«
Der Mann schüttelte bedauernd den Kopf. »Hier ist niemand mit Katzenbluse durch. Ich steh seit zwanzig Minuten hier. Die, die mit rüber sind – alles Männer. Und eine junge Frau mit einem Rucksack. Sonst keiner.«
Ewald schluckte. Ein unangenehmes Kribbeln breitete sich in seinem Nacken aus. »Das kann doch nicht sein…« Er schaute noch einmal zum Fluss, dann wieder zurück zur Straße. Sein Herz klopfte schneller – nicht wegen der Aufregung, sondern wegen des Gefühls, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmte.
Dann fiel ihm etwas auf.
Der Trenchcoat-Mann.
Kurz bevor er verschwunden war – hatte er nicht etwas in der Hand gehabt? Eine alte, bräunliche Mappe? Und hatte er nicht gerufen: »Ich hab’s eilig«?
Ewalds Blick wanderte zu einem kleinen Nebengässchen zwischen dem Gasthaus und dem alten Lagerschuppen, der seit Jahrzehnten leer stand. Die Tür war halb offen. Ein kalter Luftzug streifte seine verschwitzte Stirn, obwohl der Tag noch immer heiß war.
Was, wenn Gertrud nicht gefahren ist? Was, wenn sie ihm gefolgt ist?
Er trat einen Schritt auf die Gasse zu, dann noch einen. Irgendetwas zog ihn, wie ein Magnet. Vielleicht war es Neugier. Vielleicht war es Angst. Oder einfach nur die Ahnung, dass dies kein gewöhnlicher Nachmittag mehr war.
Ewald drehte sich auf dem Absatz um und rannte zurück zur Anlegestelle der Schwebefähre. Der Fährmann – ein wortkarger Geselle mit einem wettergegerbten Gesicht, das Geschichten von Sturm und Gezeiten zu erzählen schien – war gerade dabei, die rot-weiße Schranke zu schließen.
»Willst noch mit rüber?«, grunzte er und hielt sie einen Spalt offen.
Ewald schlüpfte hindurch, das Herz wild pochend – nicht nur vom Lauf, sondern auch wegen dieses nagenden Gefühls, dass der Tag ihm noch die eine oder andere unliebsame Überraschung bereithalten könnte.
»Ist ‘n gelber Opel Rekord mit rüber?«, fragte er und musterte den Fährmann, der sich Hugo nannte und dessen Gesicht mehr Wind und Salz gesehen hatte als so mancher Leuchtturm.
Hugo schob die speckige Schiffermütze ein Stück in den Nacken – ein untrügliches Zeichen dafür, dass nun sein Gedächtnis in Gang kam – und strich sich langsam mit dem Handrücken über die Stirn.
»Nee«, brummte er schließlich, während er bedächtig die Pfeife vom linken in den rechten Mundwinkel verlagerte. Die Geste wirkte, als hätte er damit gerade eine finale Entscheidung gefällt.
»Dann bleib ich wohl hier«, murmelte Ewald und trat einen Schritt zurück, spürbar enttäuscht.
Hugo antwortete mit einem Schulterzucken, das mehr sagte als Worte – wortlos, schwer wie Nordseewind. Dann schloss er mit einem metallischen »Klack« die Schranke, verschwand im Führerstand und machte sich bereit, die stählerne Spinne gemächlich über den Fluss zu lenken.
Gerade als die Fähre in Bewegung geriet, fiel Ewald ein Gesicht ins Auge: der ungestüme Fremde aus dem Wirtshaus. Dort drüben stand er, lässig an die Reling gelehnt, den Blick ruhig und wachsam über das Treiben am Ufer gerichtet.
Drüben, nur wenige Hundert Meter weiter flussabwärts, schoben die Baufahrzeuge Sandberge wie riesige Ameisenhügel über das Gelände, als wollten sie einen neuen Landstrich erschaffen.
Eine Krähe krächzte lautstark, beschwerte sich über den Lärm. Weit entfernt rumpelte die Fähre über dem Wasser. Und plötzlich fühlte sich der warme Sommertag an wie ein vergilbtes Foto. Still, staubig, verloren. Und Ewald fragte sich zum ersten Mal an diesem Tag nicht mehr, was, sondern warum.
Er folgte dem Blick des Mannes und ließ seinen Augen über das imposante Bauareal schweifen. Die schiere Größe der Baustelle raubte ihm für einen Moment den Atem – ein labyrinthisches Geflecht aus Gerüsten, Kränen und emsig arbeitenden Menschen spannte sich entlang des Ufers wie ein gigantisches Spinnennetz aus Stahl und Staub.
»Bald is’se fertig, die schöne neue Brücke. Dann brauch’n wir uns hier nicht mehr die Haxen in den Bauch stehen«, raunte plötzlich eine Stimme neben ihm. Ewald fuhr zusammen. Neben ihm stand ein älterer Mann, dessen Gesicht aussah, als hätte der Nordseewind es in all den Jahrzehnten eigenhändig gezeichnet – Furchen, von der Sonne braungegerbt. Ein zahnloses Grinsen breitete sich über sein Gesicht wie die Flut über das Watt.
»Ach so, ‘ne Brücke«, murmelte Ewald, der die Information erst in seinem überhitzten Schädel sortieren musste. »Das ist ja… fantastisch«, setzte er hinzu, sein sarkastischer Unterton war kaum zu überhören. Ohne sich weiter mit dem Redseligen aufzuhalten, wandte er sich ab und schlenderte langsam die Schlange der wartenden Fahrzeuge entlang, deren Motoren knurrten und deren Fahrer mit zunehmender Ungeduld auf das Wiedererscheinen der Fähre warteten.
Und da stand er – sein blassgelber Opel Rekord. Genau an der Stelle, an der er ihn zurückgelassen hatte. Unversehrt. Offenbar unsichtbar.
Doch wo, zum Henker, war Gertrud?
Unzählige Fahrzeuge drängten sich hupend an seinem stillstehenden Wagen vorbei. Einige Fahrer gestikulierten wild, einer tippte sich vielsagend an die Stirn – jene universelle Geste, mit der die Menschheit seit jeher den Grad der geistigen Umnachtung ihrer Mitmenschen kommentiert.
Ewald riss die Fahrertür auf und spähte hinein. Und da lag sie – Gertrud. Friedlich ausgestreckt auf der Rückbank, die Stricknadeln fest umklammert, ein Lächeln auf den Lippen, als hätte sie von einer besseren Welt geträumt.
»So kommen wir heut wohl nicht mehr über die Elbe«, knurrte Ewald und spürte, wie sich die eben noch verpuffte schlechte Laune mit doppelter Wucht in seinem Inneren sammelte.
Mürrisch rüttelte er seine Frau wach, während draußen die Schwebefähre knarzend und stöhnend vom Basbecker Ufer ablegte – und mit ihr jede Hoffnung auf eine pünktliche Überfahrt gleich mit in den Fluss zog.
***
Die Schwebefähre wurde in Osten herbeigesehnt wie ein stählerner Messias im Kampf gegen die Stagnation. Der Fahrer eines knallgelben VW-Transporters der Deutschen Bundespost trommelte ungeduldig mit den Fingern aufs Lenkrad, die Augen starr auf die sich nähernde Erlösung gerichtet. Jeder Zentimeter, den sich die Gondel über das Wasser schob, rückte den Feierabend näher – und ließ den Geduldsfaden ein klein wenig nachgeben, der schon den ganzen Tag auf Spannung stand.
Mit einem dumpfen »Dong«, das wie ein metallischer Seufzer durch das Tal der Oste hallte, legte Hugo die Fähre an. Der Ruck, mit dem die Konstruktion zum Stillstand kam, war sanft – aber eindeutig. Für die Wartenden das lang ersehnte Zeichen, dass die Zeit des Stillstands nun vorüber war.
Routiniert, fast feierlich in seiner stoischen Ruhe, öffnete Hugo die Schranke. Ein kaum merkliches Kopfnicken entließ die Passagiere in die Freiheit des gegenüberliegenden Ufers. Der knallgelbe Postbus röhrte mit dem typischen Klang des Boxermotors los. Der Fahrer warf dem Fährmann im Vorbeifahren einen Daumen hoch zu.
Der Mann im dunklen Anzug – jener, der Ewald im Wirtshaus so unvermittelt zur Seite gestoßen hatte – war der Letzte, der die Gondel verließ. Mit federndem Schritt, aber gespannter Miene näherte er sich Hugo.
»Wie lange sind Sie heute noch im Dienst?«, fragte er, die Worte kamen hastig, fast atemlos über seine Lippen.
Hugo hob langsam den Blick, sein wettergegerbtes Gesicht wirkte unbeeindruckt, fast steinern. Die Pfeife hing schief im Mundwinkel, das Feuer darin war längst erloschen. »Bis Feierabend is’, wie immer«, brummte er und schob seine Schiffermütze tiefer in die Stirn, als hätte er mit dieser Geste genug gesagt.
»Sehr witzig«, gab der Fremde zurück, ein gezwungenes Lächeln huschte über sein Gesicht, das seine Ungeduld kaum verbergen konnte. Ohne ein weiteres Wort verließ er die Gondel. Hugo sah ihm kurz nach: schnelle, zielstrebige Schritte, dann die Deichlücke, und schließlich bog der Mann links in die ruhige Deichreihe ein. Wenige Sekunden später war er verschwunden – verschluckt von der Dorfstille.
Im gemächlichen Takt rollte der knallgelbe Posttransporter auf die nun freie Gondel. Hans, der Fahrer mit dem glatten Gesicht, grüßte mit einem knappen »Moin« und einem flüchtigen Nicken.
Hugo erwiderte den Gruß wortkarg – ein stummer Dialog, wie ihn nur Männer führen, die gelernt haben, dass zwischen Elbe und Oste jedes überflüssige Wort bloß den Wind stört.
Hans stellte den Motor ab, ließ die Scheibe halb herunter und atmete tief durch. Die salzige Luft trug den Geruch von Schlick und fernen Wiesen mit sich, gemischt mit dem Öl und Eisen der Schwebefähre. Ein Geruch, den er mochte. Er gehörte hierher, war Teil dieser Landschaft wie die Deichschafe und das ewige Kreischen der Möwen.
Er beobachtete den alten Hugo, der mit stoischer Ruhe die letzten Handgriffe vollzog. Der Mann war wie die Fähre selbst – aus der Zeit gefallen, aber zuverlässig bis zum letzten Knarzen. Hans lächelte leise. In einer Welt, in der alles immer schneller wurde, war Hugo so etwas wie ein Anker.
Sein Blick wanderte im Rückspiegel zurück zum Ufer, dorthin, wo der Fremde eben verschwunden war. Dunkler Anzug, Trenchcoat, ein Gang, der zu wichtig für diese Gegend wirkte. Etwas an dem Kerl gefiel Hans nicht. Zu glatt, zu gehetzt. Als würde er in Gedanken ständig vor irgendetwas weglaufen. Oder auf etwas zu.
Hans hatte gelernt, auf solche Dinge zu achten. Nicht nur wegen des Berufs – ein Postbote bekam viel mehr mit, als den Leuten lieb war – sondern auch wegen seiner Jugend auf dem Hof seines Onkels. Dort hatte man ein Gespür für Menschen, einfach, weil man sie kannte. Und der Mann eben? Der war keiner von hier. Nicht mal ansatzweise.
Hugo gab ihm ein kurzes Zeichen. Hans nickte, die Fähre setzte sich quietschend in Bewegung. Noch bevor sie ablegte, warf er einen letzten Blick zurück zur Deichreihe. Nur eine Bewegung. Ein flüchtiger Schatten hinter einem Fenster. Oder hatte er sich das eingebildet?
Die Fähre ruckelte vorwärts. Hugo stand am Bug, stützte sich auf das Geländer, als wolle er das Wasser lesen wie eine alte Zeitung. Hans lenkte seinen Blick auf die Oste. Breit und träge floss sie dahin, aber in ihren Tiefen bewegte sich mehr, als man ahnte.
Er nahm sich vor, bei der nächsten Tour genauer hinzusehen. Irgendetwas stimmte hier nicht. Und er hatte das ungute Gefühl, dass die Geschichte dieses Tages noch lange nicht zu Ende erzählt war.
***
Auf der geschäftigen Baustelle wirkte der Mann im makellos dunklen Maßanzug wie ein Rabe im Schneegestöber – ein Fremdkörper inmitten der grob gehauenen Bauarbeiter und der hell aufragenden Sandberge. Seine Augen huschten rastlos umher, durchkämmten die Szenerie mit nervöser Präzision, als suchten sie fieberhaft nach etwas Verlorenem oder jemandem ganz Bestimmten.
Dann setzte er sich gemächlich in Bewegung. Mit prüfendem Blick umrundete er die massiven Fundamente, die eines Tages das Gewicht der gewaltigen Stahlkonstruktion zu tragen hätten. Ein kaum wahrnehmbares Lächeln zuckte über seine Lippen – offenbar war die Inspektion zu seiner Zufriedenheit verlaufen.
Bedächtig stieg er den steilen Sandwall hinab, ließ den Baulärm hinter sich und tauchte in den gemächlichen Trubel des Dorfes ein.
Seine Schritte führten ihn durch pittoreske Gassen, vorbei an krummen Fachwerkhäusern und windschiefen Laternen. Schließlich verschwand er unauffällig durch die schwere Holztür eines altehrwürdigen Geschäftshauses in der belebten Langen Straße.
Georg Johannson hasste Sand. Diese körnige Allgegenwart, dieses Knirschen zwischen den Sohlen, selbst wenn man meinte, alles bereits abgeschüttelt zu haben. Und doch hatte ihn dieser Baustellensand für einen Moment milde gestimmt. Der Anblick der wachsenden Brücke hatte etwas Beruhigendes, fast Tröstliches. Ordnung im Chaos. Struktur im Ungewissen.
Er stand nun am Ufer, stumm, regungslos, und starrte auf die sich nähernde Fähre, als könne er mit bloßem Willen den Übergang beschleunigen. Die Sonne hatte sich längst hinter den Horizont verzogen, der Fluss glitzerte noch in einem letzten Abglanz wie flüssiges Blei. Die Kälte der beginnenden Nacht kroch langsam durch die feinen Nähte seines Anzugs, doch er rührte sich nicht.
Nur noch eine Überfahrt. Dann war es getan.
Sein Herz schlug ein wenig zu schnell. Nicht vor Aufregung, das redete er sich ein. Es war die Luft. Die kühle, feuchte Abendluft hier an der Oste – sie ließ die Lungen arbeiten, zwang den Körper, sich zu spüren. Er hatte sich nicht in diese Angelegenheit drängen lassen. Nein. Er hatte sie gewählt. Er war vorbereitet. Alles war durchdacht, durchkalkuliert, mit der Präzision eines Mannes, der sich keinen Fehler leisten konnte.
Nicht noch einen.
Er dachte an das Geschäftshaus, das er zuvor betreten hatte. Die Gespräche dort – unter vier Augen, im Flüsterton, bei zu starkem Kaffee und schweigsamen Blicken – hatten eine alte Ordnung wiederbelebt. Alte Netzwerke, alte Schuldverhältnisse. Die Brücke mochte noch im Bau sein, aber das, was er dort drinnen wieder aktiviert hatte, spannte bereits seine eigenen Verbindungen über den Fluss. Unsichtbare, aber ebenso tragfähig wie Stahl.
Ein Geräusch riss ihn aus den Gedanken – Schritte. Fest, gleichmäßig. Jemand näherte sich von der Seite. Georg wandte den Kopf leicht. Nur ein Mann, etwa in seinem Alter, vielleicht jünger, mit diesem offenen Gesicht, das ihn an etwas erinnerte, das längst vergangen war. Ein Mensch, der wahrscheinlich kein einziges Geheimnis mit sich herumtrug – oder es zumindest vortäuschte. Georg hasste es, wenn Menschen zu offen waren. Offenheit war ein Risiko.
Der andere nickte ihm freundlich zu. Georg erwiderte den Gruß mit einem angedeuteten Lächeln – höflich, kontrolliert. Es war nicht der Moment für Nähe.
Noch nicht.
In wenigen Minuten würde die Fähre anlegen. Dann nur noch ein kurzes Gespräch mit einem alten Bekannten am anderen Ufer. Ein Mann, der einst zu viel wusste. Vielleicht auch heute noch. Georgs Finger zuckten leicht in der Manteltasche, wo sich das alte Feuerzeug befand – Messing, schwer, ein Geschenk seines Vaters. Es war keine Waffe. Aber es erinnerte ihn daran, wer er geworden war. Und was er bereit war zu tun, damit alles so blieb, wie es war.
Die Fähre ächzte nun, stählerne Spannung, langsam werdender Stillstand. Gleich war sie da. Und mit ihr die nächste Entscheidung.
Der stählerne Koloss schob sich bedächtig näher, das Metall ächzte leise im Rhythmus der Strömung. Nur wenige Meter trennten ihn noch vom Anleger.
Mit dem vertrauten, metallischen »Dong« legte die Fähre sanft an. Hugo, dessen Schicht sich zwar dem Ende zuneigte, aber noch nicht ganz vorbei war, öffnete mit routinierter Gelassenheit die rot-weiße Schranke.
Wie oft er diesen Ablauf wohl schon wiederholt hat?, dachte der Mann im dunklen Anzug, während er die Fähre betrat – noch bevor auch nur ein einziges Fahrzeug von Bord gerollt war. Hugo schüttelte stumm den Kopf, als hätte er es geahnt. Schließlich war er hier der unangefochtene Kapitän seiner stählernen Arche, und niemand widersprach ihm – weder Mensch noch Maschine.
Die Fähre war nun entladen, und die ersten wartenden Autos setzten knatternd über die Rampe auf das Deck. Mit ihnen kam auch der zweite Fußgänger, Oskar, der Mann mit dem offenen, freundlichen Gesicht. Er betrat die Fähre mit einem leichten Schwung, als sei sie ein alter Bekannter.
»Moin Hugo, die letzte Tour für dich heute?«
»Schön wär’s«, knurrte Hugo und schob dabei die Mütze tiefer in die Stirn. Seine Vorfreude auf den Feierabend hatte sich bereits wie eine warme Decke über ihn gelegt – Oskars Frage machte ihn nur noch schwerer. Mit einem resignierten Seufzer schloss er die Schranke und wandte sich dem Führerstand zu, während der Ostestrom träge gegen die Pfeiler schlug und sich das stählerne Ungetüm langsam wieder vom Ufer löste.
Der Fluss unter ihr war ruhig, silbergrau im schwindenden Abendlicht.
Georg Johannson, der Mann im Maßanzug, hatte sich bereits in den kleinen Raum für Fußgänger zurückgezogen. Er ließ sich auf einer harten Holzbank nieder, die Hände verschränkt, den Blick starr auf das bullige Stahlgeflecht der Konstruktion gerichtet. Außen schabte der Wind an den Wänden, innen schabte die Unruhe in seinem Kopf. Doch er blieb regungslos.
Draußen auf dem Deck hatten sich Hugo und Oskar in ihre gewohnte Position gebracht: Rücken an Reling, Blick zum Ufer, das sich langsam entfernte.
»Hast du das Spiel gesehen?«, fragte Oskar, während er die Hände in die Jackentaschen schob.
Hugo knurrte ein zustimmendes »Hmm«, das irgendwo zwischen Zustimmung und Mitleid rang.
»4:0. Ich mein, 4:0! Zu Hause!«, fuhr Oskar fort, der immer noch nicht recht glauben konnte, was er am Sonntag auf dem Sportplatz gesehen hatte. »Die aus der Börde haben wir regelrecht abserviert.«
»War auch nix los bei denen vorne. Der Junge von Brügge – wie heißt er gleich?«, fragte Hugo, der sich jetzt eine Pfeife aus der Jacke zog.
»Kalle. Kalle Brügge. Der hat gespielt, als wär er mit einem Bein im Schnapsfass hängen geblieben. Kein Zug, kein Biss.«
»Hat er vielleicht auch«, brummte Hugo und stopfte Tabak in die Pfeife. »War auf’m Sommerfest Samstag bis um vier, hat mein Neffe erzählt. Da muss man dann durch.«
Oskar lachte leise. »Und dann meckert der Trainer wieder über mangelnde Disziplin. Als ob das nicht jedes Jahr dasselbe wär.«
»Seit ‘69«, meinte Hugo trocken. »Aber wenigstens gab’s Bier.«
Hinter der Scheibe saß Georg, scheinbar versunken in sich selbst. Doch sein Ohr hatte die Worte eingefangen wie ein Netz, das am Ufer treibt. TSV Osten, Börde Lamstedt, Kalle Brügge. Alles klang nach Dorfidylle, nach Unschuld – nach etwas, das ihm seltsam fern war.
Er warf einen flüchtigen Blick zu den beiden Männern auf dem Deck. Sie gehörten zu dieser Welt, mit ihrer lakonischen Wärme und der rauen Sprache, wie Schafe zum Deich. Er dagegen war nur auf der Durchreise. Und doch war es gerade diese Normalität, die ihn wachsam machte.
***
Still und unaufhaltsam zog die Oste ihr silbriges Band landeinwärts, die Flut schob träge ihr Wasser unter der Schwebefähre hindurch. Am westlichen Horizont hing die Sonne, tiefrot wie eine glühende Kohle, kurz vor dem Versinken. Die Fähre hatte gerade die letzten Fahrzeuge am Basbecker Ufer entlassen und trat nun, mit nur einer Handvoll Wagen an Bord, die kurze Rückfahrt nach Osten an.
Hugo, der alte Fährmann mit den derben Händen und den weisen Augen, spürte die nahende Ruhe seines Feierabends wie eine wohltuende Brise. Der Gedanke, bald keine Nachtschichten mehr schieben zu müssen, wärmte sein müdes Herz. Früher, als er noch ein junger Spund gewesen war, hatte er die nächtlichen Überfahrten sogar genossen. Die endlosen Stunden unter dem sternenübersäten Himmel hatten ihn nicht gestört – im Gegenteil, sie hatten ihm etwas gegeben, das er nie so recht in Worte hatte fassen können.
Im Sommer saß er oft auf der stählernen Gondel, ließ die Beine baumeln und sog die meditative Stille der Oste in sich auf, wie sie mal gemächlich in die eine, mal in die andere Richtung strömte. Im Winter zog er sich in die windschiefe Fährbude an der Deichlücke zurück, wo ein knisternder Ofen behagliche Wärme spendete. Manchmal bekam er Besuch von den jungen Leuten aus dem Dorf – neugierige Gesichter, rote Wangen, eine Mischung aus Respekt und Abenteuerlust in den Augen. Für ein kleines Trinkgeld überließ er ihnen gern das warme Plätzchen, stellte sich nach draußen, die Pfeife im Mundwinkel, das Gesicht dem Wind entgegengestreckt.
Doch diese unbeschwerte Zeit war vorbei. Vergangenheit. Klar und unbestechlich, wie das trübe Wasser der Oste nach einem Sturm, war ihm bewusst, dass seine Tage als Fährmann gezählt waren. Die neue Brücke – dieses stählerne Ungetüm, das sich am Horizont auftürmte – würde das Ende bedeuten. Er wusste es, und doch verbitterte es ihn nicht. Im Gegenteil: Er genoss jeden einzelnen Tag, an dem er noch seinen Dienst verrichten durfte. Atmete die salzige Luft tief ein. Lauschte dem vertrauten Knarzen und Ächzen der alten Stahlkonstruktion. Und ließ seine Gedanken treiben, zurück zu all den Begegnungen über die Jahre hinweg.
So viele Gesichter hatte er gesehen – manche freundlich, andere wortkarg, wieder andere zugeknöpft wie das Wetter im November. Menschen, die Zeit für ein kurzes Pläuschchen fanden. Und solche, die getrieben waren von einer Eile, als hinge ihr ganzes Leben davon ab, möglichst schnell ans andere Ufer zu gelangen.
Und immer, wenn Hugo in die leuchtenden Augen der Kinder blickte, die von diesem stählernen Ungetüm auf dem Wasser aufrichtig überwältigt waren, wurde ihm warm ums Herz. Für die Kleinen war die Schwebefähre kein Fortbewegungsmittel, sondern ein Wunderwerk – ein schwebender Riese, der die Ufer verband. Ganz besonders liebe Kinder durften dann auch mal in sein kleines Reich: das staubige, nach altem Öl duftende Führerhaus, das für sie wie die Brücke eines gewaltigen Schiffes wirkte.
An einen Jungen erinnerte er sich besonders gut. Heinzi wurde er von seiner Mutter genannt. Immer, wenn im tiefsten Winter die Oste unter einer dicken Eisschicht erstarrt war, kam dessen Mutter mit ihm zur Fähre. Der Junge, vielleicht vier oder fünf Jahre alt, stand dann mit riesigen Augen vor dem stählernen Koloss, stumm, die Pudelmütze tief im Gesicht, aber erfüllt von reiner Ehrfurcht.
Hugo hatte ihn damals an der Hand genommen, gemeinsam hatten sie die schwere Schranke geschlossen – und unter der wachsamen Aufsicht des erfahrenen Fährmanns durfte der kleine Heinzi sogar die Hebel bedienen, durfte mithelfen, die gewaltige Konstruktion in Bewegung zu setzen. Stolz wie ein kleiner König hatte er im Führerstand gestanden, seine Augen hatten vor Freude geglitzert, und sein Lächeln war für Hugo mehr wert gewesen als jedes Lob oder Trinkgeld.
Doch dann war wieder ein Winter gekommen. Der Fluss hatte sich unter bedrohlich wirkenden Eisschollen gestaut – aber Heinzi war nicht mehr erschienen. Kein Zucken kleiner Finger an der Schranke, kein strahlendes Kinderlachen zwischen Schnee und Metall. Hugo vermisste ihn. Der Junge war ihm ans Herz gewachsen wie ein eigener Enkel.
Er war gern Fährmann gewesen auf der Schwebefähre von Osten. Schon sein Vater hatte hier gedient, und auch sein Großvater, der einst noch mit den Händen die Taue des alten Fährprahms gespannt hatte. Hugo war wohl der Letzte seiner Familie, der diese Arbeit noch tun würde. Und Klaus, sein einziger Sohn, würde sich wohl oder übel etwas anderes suchen müssen. Die Brücke würde kommen, unausweichlich. Und sie würde all das – die Gespräche, die kleinen Wunder, die glitzernden Kinderaugen – überflüssig machen.
Gern ließ Hugo seine Gedanken zu den Geschichten seines Vaters schweifen, der einst selbst am Bau dieser einzigartigen Schwebefähre mitgewirkt hatte. Als kleiner Junge hatte Hugo stundenlang in der warmen Stube gesessen, gebannt den abenteuerlichen Erzählungen gelauscht, während draußen der Wind an den Fenstern rüttelte.
Eine seiner Lieblingsfragen war stets gewesen – und auch bei den Kindern aus dem Dorf erfreute sie sich bis heute großer Beliebtheit:
»Was hat die Schwebefähre hier in Osten eigentlich mit der berühmten Freiheitsstatue in New York gemeinsam?«
Natürlich kannten sie die Antwort längst. Und doch stellten sich die Kinder jedes Mal wieder unwissend, schauten mit großen Augen und zuckten ratlos mit den Schultern – nur um dem alten Mann die Freude nicht zu nehmen. Dann leuchtete in Hugos Gesicht das gleiche verschmitzte Lächeln auf, das schon sein Vater getragen hatte, und er sagte mit sonorer Stimme:
»Na, die Betonfüße! Beide kommen von der Portland-Zementfabrik aus Hemmoor!«
Ein kleiner Satz, der Hugo noch heute zum Schmunzeln brachte – ein Stück Weltgeschichte, verborgen in seiner stillen Heimat zwischen Deich und Fluss. Hier, wo die Zeit langsamer zu vergehen schien und doch voller Geschichten war, die weit über die Dorfgrenzen hinauswiesen.
Doch die absolute Lieblingsgeschichte seines Vaters – und die, die Hugo vermutlich hundert Mal gehört und doch nie überdrüssig geworden war – handelte vom sagenumwobenen, versunkenen Fährprahm, der durch Übermut in den Tiefen der Oste versank.
»Hör mal, mein Junge«, hatte sein Vater immer gesagt, »ich war damals beim Bau der Schwebefähre dabei. Das Mittelstück, ein tonnenschweres Stahlungetüm, sollte eingesetzt werden. Die Ostener hatten ihre Pfähle in den Schlamm gerammt, die Seitenteile ragten schon in den Himmel – fehlte nur noch dieses Schußstück.
Da kamen die Gustavsburger, eine Truppe hitziger Kerle, und wollten das Teil mit dem alten Fährprahm über die Oste bringen. Der Fährmann warnte sie, doch sie hörten nicht. Und was geschah? Mitten im Strom sackte das Ding ab, verschluckt von den Fluten. Plötzlich war alles still.
Ratlos standen sie am Ufer, bis ein Taucher aus Hamburg kam. Ein breiter Kerl, eiskalt, mit Augen wie Stahl. Am ersten Tag fand er nichts. Aber am zweiten ertastete er das Eisen im Schlamm, befestigte es mit Drahtseilen – und wir zogen es Zentimeter für Zentimeter nach oben. Schließlich hatten wir es.
Und als wäre das nicht schon genug gewesen, tauchte auch der Fährprahm wieder auf, taumelnd, als hätte ihn jemand zurück ans Licht gedrückt. Ohne diesen Taucher, mein Junge, gäbe es die Brücke heute nicht.«
Hugo hatte nie im Leben einen anderen Beruf in Erwägung gezogen als den des Fährmanns. Die Oste war sein Revier, die Fähre sein Zuhause, der Fluss sein ständiger Begleiter gewesen – bei Tag und bei Nacht, im Nebel, bei Sturm und im goldenen Schein der Sommersonne.
Ein stilles Lächeln huschte über sein wettergegerbtes Gesicht, während sein Blick über das ruhige Wasser glitt. Die Erinnerungen an frühere Tage – an rutschige Stege, schwere Ketten, rußige Öfen und an das leise, zufriedene Brummen der alten Maschinerie – waren so lebendig, als hätte er sie erst gestern erlebt.
Nun aber richtete sich sein Blick zur Deichlücke. Die Abendsonne war schon lange hinterm Horizont im Meer versunken, und die Luft war erfüllt vom leicht salzigen Duft des nahen Watts. Wie ein Leichentuch legte sich dichter Nebel von der See über den Fluss.
Es war der Moment, auf den er sich jeden Tag aufs Neue freute – das Kommen der Ablösung, das langsame, gemächliche Auftauchen eines vertrauten Gesichts. Kein großes Aufheben, kein lautes Willkommen – nur ein Nicken, ein stummes Einverständnis: Dein Tagwerk ist getan. Ich übernehme.
Er lehnte sich an das Geländer und sog tief die frische Luft ein. Der Fluss glitt träge unter der Fähre hindurch, so verlässlich und ruhig wie eh und je. Bald würde er heimgehen, durch die schmale Gasse mit den alten Kopfsteinen, vorbei an der Bäckerei, deren Fenster längst dunkel waren, und dann in sein kleines Haus, wo der Ofen schon längst erloschen war, aber ein warmes Licht auf dem Küchentisch wartete.
Doch noch war er hier – Fährmann Hugo.
Im traulich-dunklen Fährkrug erloschen die letzten warmen Lichter hinter den Fenstern. Der Wirt hatte Feierabend gemacht, und die Stille der Nacht kroch langsam durch die Gassen von Osten.
Wird dann wohl nichts mehr mit einem gemütlichen Absacker, dachte Hugo und legte die Schwebefähre mit seiner gewohnten, sanften Routine am Ostener Ufer an.
»Dong.«
Mit müden Beinen, die das Gewicht eines langen Arbeitstages trugen, schlurfte er zur Schranke und öffnete sie. Die wenigen verbliebenen Autos rollten gemächlich von Bord. Ein freundlicher Fahrer winkte ihm im Vorüberfahren zu und wünschte einen ruhigen Feierabend.
Kein weiteres Fahrzeug wartete mehr auf Überfahrt – und auch drüben, am dunklen Basbecker Ufer, herrschte friedliche Stille. Zu sehen war nichts. Der Nebel wurde dichter.
Hugo holte tief Luft. Die kühle, feuchte Nacht tat seiner müden Lunge nicht gut. Noch einmal sog er die salzige Luft der Oste ein, dann wandte er sich dem Führerstand zu, bereit, die Abrechnung zu beginnen.
Doch da – ein Schatten im Fahrgastraum, kaum erkennbar im schwachen Licht. Ein Mann saß auf der Bank, tief zusammengesunken, den Kopf an die Wand gelehnt. Offenbar war er eingeschlafen.
»Ist ja auch kein Wunder«, murmelte Hugo leise, »bei dem gemächlichen Tempo unserer stählernen Schnecke – das wirkt wie ein Schlaflied.« Ein müdes, fast zärtliches Lächeln huschte über sein wettergegerbtes Gesicht.
»Wir, die Gondoliere des Nordens – Tiefenentspannung erster Klasse«, flüsterte er, mehr zu sich selbst, als er langsam auf den erschöpften Fahrgast zuging. Die Schritte hallten leise auf dem Metallboden wider.
Sein Blick blieb für einen Moment an dem schlafenden Mann hängen – zu ruhig, zu reglos. Irgendetwas daran ließ ihn zögern.
Hugos Lächeln erstarb.
Der Mann saß reglos da, den breitkrempigen Hut tief ins Gesicht gezogen, als wolle er sich vor der Welt verbergen. Angelehnt an die kühle, feuchte Außenwand der Fähre, wirkte seine Haltung unbequem und merkwürdig unnatürlich – die Arme verschränkt, die Beine unter die hölzerne Bank geklemmt.
»Hallo? Aufwachen, mein Herr. Feierabend«, sagte Hugo mit ruhiger, beinahe väterlicher Stimme, wie er es oft getan hatte, wenn ein Fahrgast mal auf der letzten Tour eingenickt war.
Doch der Mann reagierte nicht. Keine Regung, kein Laut. Hugo trat einen Schritt näher, seine Stimme nun fester, durchzogen von einem Hauch Unbehagen:
»Feierabend!«
Stille.
Mit einer Mischung aus Pflichtgefühl und wachsender Beklommenheit beugte sich Hugo vor und stupste den Fremden leicht an der Schulter.
Wieder nichts.
Kein Zucken, kein Murren. Nur die unbewegte Gestalt in der Dämmerung des leeren Passagierraums.
Ein kalter Schauer kroch Hugo den Rücken hinauf. Widerwillig, aber entschlossen, hob er vorsichtig den dunklen Hut ein Stück an.
Dann wich er entsetzt zurück – ein heiserer Laut entrang sich seiner trockenen Kehle. Der Hut entglitt seinen zitternden Fingern und fiel lautlos aufs eiserne Deck. Zwei große, glasige Augen starrten ihn leblos an.
»Scheiße…«, stieß Hugo hervor, seine Stimme kaum mehr als ein Hauch.
Der grausige Anblick raubte ihm den Atem. Eben noch hatte er sich auf den wohlverdienten Feierabend gefreut – nun wich alle Wärme aus seinem Körper, die Nacht wurde mit einem Mal kälter, dunkler, schwerer.
Ohne ein weiteres Wort drehte sich Hugo um und floh von seiner geliebten Fähre. Seine Beine, eben noch träge vom langen Dienst, trugen ihn nun mit ungeahnter Geschwindigkeit durch die nächtliche Stille. Atemlos erreichte er die Tür des Fährkrugs, wo kein letzter Lichtschein mehr durch die Gardinen drang. Mit zitternden Fäusten trommelte er gegen das massive Holz der Tür.
»Willi! Mach auf! Willi!«
Die Schläge wurden schwächer, kraftloser. Hugos Brust hob und senkte sich stoßweise, seine Lungen brannten, sein Herz pochte wie wild.
Schließlich öffnete sich die Tür.
Der Wirt, Wilhelm Richter, stand in der Schwelle, die Augen vom Schlaf verquollen, ein deutliches Aroma von Korn in seiner Fahne.
»Hugo? Um Himmels willen, was soll der Lärm? Ist denn die Hölle los?«
Hugo klammerte sich an den Türrahmen, seine Stimme kaum noch ein Flüstern: »Willi… du musst sofort die Polizei rufen. Da… da liegt einer… auf meiner Fähre. Und der… der lebt nicht mehr.«
»Warum zum Teufel sollte ich das um diese gottverdammte Uhrzeit tun?«, brummte Wilhelm, während sein Geist längst wieder bei seiner warmen Frau und dem weichen Kissen weilte.
»Weil… weil da ein Toter auf meiner Fähre liegt«, stieß Hugo hervor. Die Worte kamen abgehackt, seine Stimme brüchig, als müsste er sich selbst erst vergewissern, was er da gerade gesagt hatte.
Wilhelm blinzelte, die Stirn gerunzelt. »Sag das noch mal – langsam.« Er konnte kaum glauben, was er da gehört zu haben glaubte.
»Nun mach schon, Willi! Ruf endlich die Polizei an!«, brauste Hugo auf, die Nerven blank wie angerostete Stahlträger im Salzwind.
»Jaja, ist ja gut, Hugo.« Wilhelm seufzte schwer, schob die Tür weiter auf. »Komm erst mal rein und beruhig dich. Einen Schnaps?«
Wortlos folgte Hugo ihm in die stickige Gaststube. Der abgestandene Geruch von Zigarettenrauch und altem Bier hing wie ein müder Schleier über dem Raum. Er ließ sich schwer auf einen der wackeligen Holzstühle sinken, atmete tief durch, während sein Herz noch immer wie wild gegen die Rippen pochte.
Wilhelm zog zwei dickwandige Gläser aus dem Regal, stellte sie mit einem leisen Klirren auf den Tresen und füllte sie randvoll mit klarem Korn. »Prost«, sagte er beiläufig, hob sein Glas und kippte es in einem Zug runter, als wäre es Wasser aus dem Hahn.
Hugo rührte sein Glas nicht an. Der Alkohol drehte ihm schon beim bloßen Gedanken daran den Magen um.
Wilhelm zuckte mit den Schultern, schnappte sich Hugos Glas und ließ auch den zweiten Schnaps verschwinden. »Wäre ja schade drum«, murmelte er.
»Nun ruf endlich die Polizei, Willi!«, drängte Hugo, diesmal lauter, schärfer. Sein Blick war starr, die Hände fest um die Stuhlkante gekrallt.
»Ja, ja, wird ja nicht gleich davonlaufen, deine Leiche«, witzelte Wilhelm und goss erneut nach, als könne er das Unbehagen mit einem doppelten Korn wegsaufen.
Da schoss Hugo hoch.
Sein Stuhl kratzte über die alten Dielen, und er fixierte Wilhelm mit einem Blick, so finster und kalt wie die Oste bei Nacht.
»Dann eben nicht! Dann geh ich eben selbst zum Dorfsheriff!«, blaffte er.
Wilhelm hob gerade sein drittes Glas zum Mund, sah ihn dabei an wie einen störrischen Gast, der nicht wusste, wann es Zeit war zu gehen.
»Dann mach doch!«, rief der Wirt ihm grinsend hinterher, während Hugo bereits mit hastigen Schritten das Lokal verließ und die Tür krachend ins Schloss fiel.
Hugo wusste in diesem Moment selbst nicht so recht, worüber er sich mehr ärgern sollte: über die unheimliche Leiche auf seiner geliebten Fähre – oder über den saufseligen, ignoranten Wirt, dem offenbar jedes Gespür für die Realität fehlte.
Nur wenige Minuten später erreichte er die kleine Polizeistation in der Deichreihe. Das solide Backsteingebäude mit seinen hell erleuchteten Fenstern ragte wie ein tröstliches Bollwerk aus der Dunkelheit – ein stilles Leuchtfeuer der Ordnung in einer Nacht, die sich zunehmend fremd und unheimlich anfühlte.
Zaghaft klopfte Hugo an die schwere Holztür. Es dauerte nicht lange, bis sie sich knarrend öffnete.
Annegret, Günters resolute Ehefrau, blickte verschlafen in die Nacht hinaus. Ihr Blick wurde sofort wachsam, als sie Hugo erkannte.
»Herr Schulz? Um diese Uhrzeit? Ist etwas passiert?«
»Ist Günter da?«, fragte Hugo knapp, ohne auf ihre besorgte Stimme einzugehen. Seine Ungeduld und das Entsetzen über das, was er auf dem Deck entdeckt hatte, ließen ihm keinen Raum für Höflichkeiten.
Annegret nickte und rieb sich die Augen. »Ja. Er ist noch in der Amtsstube. Ich hol ihn.«
»’Tschuldigung«, murmelte Hugo nur, während er sich an der überraschten Annegret vorbeischob – ohne ihr auch nur einen Blick zu schenken.
Sie blieb wie angewurzelt stehen, sah ihm hinterher, wie er, ohne zu zögern und ohne anzuklopfen, die Tür zur Amtsstube aufriss, getrieben von einer Unruhe, die sich wie ein Sturm in seinem Inneren zusammengebraut hatte.
»Günter, es ist was Schreckliches passiert!«, rief er atemlos, kaum dass er die Schwelle überschritten hatte. Die Worte stolperten über seine Lippen, überhastet und schwer verständlich in ihrer Panik.
Günter Dunkelmann, der in aller Seelenruhe an seinem Schreibtisch saß und gerade eine Tasse Pfefferminztee abstellte, hob nur leicht die Brauen. Er war ein Mann, der selbst bei Orkanstufe zehn kaum ein Stirnrunzeln zeigte.
»Ganz ruhig, Hugo. Immer mit der Ruhe. Eins nach dem anderen«, sagte er mit seiner gewohnten stoischen Gelassenheit – eine Ruhe, die in Hugos Zustand fast noch beunruhigender wirkte als die Nachricht selbst.
»Setz dich erst mal. Und dann erzähl mir, was los ist.«
Hugo nickte fahrig, ließ sich schwer auf den nächstbesten Stuhl sinken und rang nach Fassung.
»Auf der Fähre…«, begann er, seine Stimme brüchig wie morsches Holz. »Da liegt ein Toter. Einfach so. Tot. Im Fahrgastraum.«
Günters Blick wurde scharf, sein Körper blieb reglos.
»Nicht dein Ernst, Hugo?«, fragte er leise, den Fährmann nun mit einem prüfenden Blick musternd – als wolle er aus dessen aufgewühltem Gesicht die Wahrheit wie eine Spur im Schlick lesen.
»Doch, Günter, ganz sicher. Im Fahrgastraum, angelehnt an der Wand. Ein feiner Pinkel, würde ich sagen – Anzug, Lederschuhe, alles vom Feinsten«, bekräftigte Hugo seine Beobachtung mit Nachdruck. Nach all den Jahren auf der Fähre hatte er ein sicheres Gespür für Menschen entwickelt – ihre Herkunft, ihre Stimmung, ihre Absichten.
Günter seufzte leise.
»Schön. Oder eben auch nicht. Komm, Hugo, wir gehen zur Fähre.«
Mit einem leisen Ächzen erhob sich der Polizist aus seinem knarrenden Schreibtischstuhl. In bedächtiger Routine legte er die Lesebrille ab, griff nach der grünlichen Uniformjacke, die stumm am alten Garderobenhaken hing, und holte anschließend seine betagte Dienstwaffe aus der Schreibtischschublade. Mit geübtem Griff steckte er sie in das abgewetzte Holster seines breiten Ledergürtels.
»Liebling, bin noch mal kurz weg!«, rief er in Richtung Flur, bevor er die Haustür öffnete und sich im Gehen seine speckige Dienstmütze aufsetzte.
Auf dem kurzen Weg zur Fähre stellte Günter gezielte Fragen: ‘Wann Hugo den Mann bemerkt hatte, ob es zuvor Auffälligkeiten gegeben hatte, seltsame Fahrgäste, ungewöhnliches Verhalten’.
Hugo mühte sich, die Fragen zu beantworten – doch der Abend war bis zu jenem Moment so normal gewesen wie unzählige davor.
»Ehrlich, Günter, es war nichts Besonderes. Kein Streit, kein Ärger. Alles ganz ruhig.«
Die dunkle Silhouette der Schwebefähre tauchte vor ihnen auf – stumm über dem schwarzen Band der Oste. Der Fährkrug lag längst wieder im nächtlichen Schlummer, nur ein einsames Licht im Obergeschoss flackerte träge hinter einem Gardinenschlitz.
»Der Willi hat jetzt wohl endgültig den Kanal voll«, murmelte Hugo und schüttelte leicht den Kopf. Ein bitterer Unterton mischte sich in seine Stimme – eine Mischung aus Enttäuschung und Wut.
Am Anleger angekommen, trat ihnen Karl entgegen, Hugos Ablösung – nervös und aufgewühlt. Er lief unruhig hin und her, seine Schritte hallten unnatürlich laut über das eiserne Deck.
»Mensch, Hugo, endlich!«, rief er ihnen entgegen, sichtlich erleichtert, als er den Polizisten an Hugos Seite erkannte.
»Auf der Fähre liegt ‘ne Leiche! Ich dachte schon, ich wär verrückt geworden! Wo warst du denn so lange?«
Seine Anspannung fiel mit einem Mal von ihm ab, während sich die Nacht weiter über den Fluss senkte – schwer, still, und voller Fragen.
Günter Dunkelmann, seit Jahrzehnten der ruhige Fels in der Brandung des beschaulichen Dorfes, näherte sich dem leblosen Körper mit beinahe andächtiger Abgeklärtheit. Im fahlen Schein seiner klobigen Taschenlampe beugte er sich über den Toten und musterte ihn aus verschiedenen Winkeln, die Stirn tief gefurcht.
»Hm«, brummte er nachdenklich. »Auf den ersten Blick würde ich sagen: Herzstillstand. Vielleicht ein Infarkt.« Doch etwas in Günters Blick blieb wachsam, misstrauisch – seine berufliche Intuition ließ ihn nicht los.
Er begann, systematisch die Taschen des Mannes zu durchsuchen, jede Bewegung präzise, fast rituell. In der Innentasche des eleganten Anzugs fand er lediglich einen zerknitterten Fahrschein – erste Klasse, Hamburg Hauptbahnhof nach Basbeck-Osten und zurück. Kein Portemonnaie. Keine Papiere. Kein Ausweis. In der Außentasche ein Feuerzeug, das Günter unauffällig in seine Tasche gleiten ließ.
»Seltsam. Kein Geldbeutel, kein Ausweis, nichts«, murmelte Günter mit wachsender Ernüchterung. »Wer bist du, mein Freund, und was hast du in unserem kleinen Osten gesucht?« Seine Worte hallten leise durch die Nacht – laut genug, dass Hugo und Karl sie vernehmen konnten, obwohl sie lieber mit etwas Abstand warteten.
»Ich hab ihn heute Nachmittag mit rübergenommen«, warf Hugo zögerlich ein. »Er ist dann in Richtung Deichreihe verschwunden, mehr hab ich nicht gesehen.«
»Na, das ist doch schon mal ein Anfang.«
Günter fuhr mit seiner Untersuchung fort. Als er den Körper leicht anhob, kippte der Kopf des Mannes unnatürlich nach vorn. Der Polizist hielt inne, ließ den Lichtkegel seiner Lampe über Nacken und Schultern gleiten. Dann schnaubte er leise, eine Mischung aus Entdeckung und Unmut.
»Genickbruch«, stellte er trocken fest, sein Tonfall hatte sich verändert – kühler, ernster. »Verdammt. Das sieht ganz und gar nicht nach einem natürlichen Tod aus.«
»Aber… wer bringt denn auf meiner Fähre jemanden um?«, hauchte Hugo, erschüttert, mit bebender Stimme.
»Deine Fähre?«, wiederholte Karl ungläubig.
»Unsere Fähre«, verbesserte sich Hugo leise. Die Worte kamen nur schwer über seine Lippen, als hätte der Gedanke, dass dieses ruhige, schwankende Zuhause nun zum Tatort geworden war, ihn körperlich getroffen.
Die stille Nacht, eben noch voller Frieden und dunkler Wasser, war nun von einem unheilvollen Schatten durchdrungen.
»Und genau das«, sagte Günter bestimmt, während er sich den beiden Männern zuwandte, »ist jetzt die alles entscheidende Frage. Wer hatte etwas gegen diesen Mann – und wer hatte Zugang zur Fähre?«
Er zückte seinen zerfledderten Notizblock, der schon viele Geschichten der kleinen Gemeinde aufgenommen hatte, und blickte Hugo eindringlich an.
»Ist dir irgendjemand aufgefallen? Jemand, der sich auffällig in der Nähe des Mannes aufgehalten hat? Jemand, der sich gedrückt hat oder sich merkwürdig benommen hat?«
Hugo schwieg einen Moment, dann schüttelte er langsam den Kopf. Seine Gedanken rasten. Zu viele Fragen, die sich wiederholten. Die sanften Wellen der Oste wirkten plötzlich wie das bedrohliche Flüstern eines dunklen Geheimnisses. »Ich… ich habe ja nicht einmal gemerkt, dass der Mann überhaupt noch an Bord war«, gestand Hugo leise, seine Stimme kaum mehr als ein Hauch. Die Scham stand ihm deutlich ins müde Gesicht geschrieben.
»Wie bitte? Du hast ihn mitgenommen und nicht gesehen, dass er in Basbeck gar nicht abgestiegen ist?«, fragte Karl ungläubig. Er schüttelte langsam den Kopf, fassungslos über die Nachlässigkeit seines älteren Kollegen.
»Bin eben auch nicht mehr der Jüngste«, murmelte Hugo zur Verteidigung, ein Hauch von Selbstironie in seiner Stimme, der seine Entschuldigung kaum zu kaschieren vermochte.
»Nach so einer langen Schicht ist das kein Wunder. Geht mir manchmal genauso«, warf Karl versöhnlich ein, legte Hugo eine Hand auf die Schulter – ein stiller Akt der Solidarität.
Günter ließ den Moment wirken, bevor er weiter bohrte. »Wann genau hast du ihn entdeckt?« Seine Augen ruhten fest auf Hugo.
»Als ich zum Feierabend die Abrechnung machen wollte. Da hab ich ihn da sitzen sehen, ganz still. Ich dachte, er schläft einfach nur tief und fest.« Hugo deutete mit einer zittrigen Hand auf den Fahrgastraum, in dem der Tote nach wie vor unheimlich und regungslos lehnte.
»Gut, Hugo«, sagte Günter ruhig, »aber noch mal zu meiner eigentlichen Frage: Ist dir irgendjemand aufgefallen, der sich vor dem Fund in der Nähe des Mannes aufgehalten hat? Irgendein Fahrgast, der auffällig war oder sich merkwürdig benommen hat?«