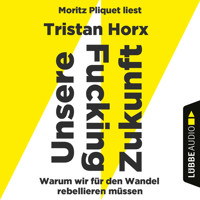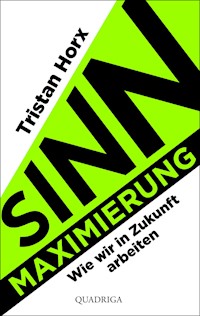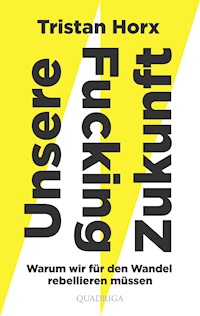
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Quadriga
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Fridays for Future, Black Lives Matter und Occupy Wallstreet waren nur der Anfang, das Zeitalter neuer Generationenverträge beginnt jetzt! Die Coronakrise hat diesen im Hintergrund schlummernden Konflikt endlich in den Vordergrund gebracht. Tristan Horx untersucht, ob unsere Generationenbilder nach wie vor zutreffen. Sind wir noch in Altersschubladen einzuordnen? Wie können wir das Netz nutzen, um zusammen eine Zukunft aufzubauen, die nicht auf Abgrenzung und Spaltung basiert? Ein Blick in die Welt von morgen - frech und verständlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungVorwortFor PosterityKapitel 1: Das Zeitalter der RebellionKapitel 2: GenerationenDie »Boomann«-Generation: 1946–1964Generation X: 1965–1979Generation Y: 1980–1994Generation Z: 1995–2015/2020Ein Krieg beginntPolitical CorrectnessVon Nazis und BorkenkäfernKapitel 3: Generationsthesen – Das Post-Alter-ZeitalterDer GenerationsmythosWerte statt AlterDer KonfliktDigitalesDigitale Zukunft – radikale Ehrlichkeit als LösungsversuchNach der DigitalisierungEine Ode an den JournalismusWas sich zu digitalisieren lohntKapitel 4: Generation CoronaEin Moratorium für die Welt, wie wir sie kanntenNachhaltigkeitDie Beschleunigung der EntschleunigungSemi-FinBonus: Zukunft der ReligionArbeitBildungUrbanisierungGlobalisierungGenerationenpolitikEin wütendes FriedensangebotDankLiteratur- und QuellenverzeichnisÜber dieses Buch
Fridays for Future, Black Lives Matter und Occupy Wallstreet waren nur der Anfang, das Zeitalter neuer Generationenverträge beginnt jetzt! Die Coronakrise hat diesen im Hintergrund schlummernden Konflikt endlich in den Vordergrund gebracht. Tristan Horx untersucht, ob unsere Generationenbilder nach wie vor zutreffen. Sind wir noch in Altersschubladen einzuordnen? Wie können wir das Netz nutzen, um zusammen eine Zukunft aufzubauen, die nicht auf Abgrenzung und Spaltung basiert? Ein Blick in die Welt von morgen – frech und verständlich.
Über den Autor
Tristan Horx, Jahrgang 1993, ist Trend- und Zukunftsforscher beim Zukunftsinsitut und untersucht aus Perspektive derjüngeren Generationen die Themen Digitalisierung und Ökologie.
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Angela Kuepper, München
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-1507-2
www.quadriga.de
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Für meinen Großvater Paul Strathern – in Anerkennung seiner einmaligen Kombination aus Humor und Weisheit.
Vorwort
Immer wieder habe ich in meinem Leben versucht zu rebellieren. In einer Heavy-Metal-Band gespielt, mir Tattoos zugelegt, in Sri Lanka Englisch unterrichtet, Lederjacken getragen – die Klassiker. Doch irgendwie ist es mir nie so wirklich geglückt. Als Sohn zweier Babyboomer ist Rebellieren nun mal nicht so einfach. Sie sind Hyperindividualisten, geprägt von den Revolutionen der Siebzigerjahre, und waren somit bei jedem meiner Versuche eher erfreut, vermutlich sogar ein bisschen stolz. Ein individuelles Aufbegehren war also schon von vornherein zum Scheitern verurteilt, und auch die kollektiven Jugendrebellionen und Revolutionen, wie sie damals während der Ära der Hippies stattfanden, suchte ich lange Zeit erfolglos. Eine Rebellion ohne einen echten Antagonisten macht eben nur halb so viel Spaß. Bekanntlich braucht man eine Nemesis, um sich wirklich zu wandeln.
Doch dann, 2018, geschah es – Fridays for Future! Die jüngere Generation – zu der ich nicht mehr ganz gehöre – ging auf die Straße und kämpfte für das Klima. Sie brachte damit endlich einen Generationenkonflikt zum Vorschein, der zwar lange da gewesen war, aber immer nur unter der Oberfläche vor sich hin gebrodelt hatte. Dabei war vielen längst klar, dass die Welt des zwanzigsten Jahrhunderts nicht linear ins einundzwanzigste fortgeführt werden konnte. Dafür waren – und sind – die Probleme zu komplex.
Das Schöne an Fridays for Future war: Es wurde nicht gegen etwas, sondern für etwas rebelliert: die Zukunft – genau mein Thema. Bald aber ging gehörig etwas schief. Fingerzeige, Anschuldigungen, Unterstellungen, das Übliche – die Kommunikation ging den Bach runter. OK Boomer!, hieß es, die Fronten zwischen den Generationen verhärteten sich. Auf der Seite der Jungen wurde das Boomer-Bashing en vogue, während die Ära der von 1946 bis 1964 Geborenen, von denen viele als Entscheidungsträger:innen in Wirtschaft und Politik fungieren, den Rebellierenden Naivität unterstellte. Auf einmal konnte auch ich, der sich eigentlich als objektiver Generationenforscher sieht, fühlen, wie ich auf eine Seite gezogen wurde – und das war definitiv nicht die der Boomer. Die haben mir bekanntlich meine eigene Rebellion versaut.
Einer wachsenden Rebellion zuzusehen, an der man nur beobachtend teilnimmt, führt, gelinde gesagt, zu Frust. Darf man nicht mitmachen, weil man schon zu alt ist? Was für eine Schande, dass die Zukunft von so etwas Gewöhnlichem wie einem Generationenkonflikt zerstört werden könnte. Dabei ist eines klar: Mit einer Rebellion um ihrer selbst willen ist es nicht getan, es muss sich definitiv etwas ändern. Für unsere Gesellschaft und den Planeten.
Die Zeit drängt, um die verschiedenen Rebellionen und ihre Fronten zu erkennen und sie anschließend konstruktiv auszutragen. Um ein neues Miteinander zu finden, das sich über alte, verkrustete Altersgrenzen hinwegsetzt, statt sich einfach nur an dem ewigen Kämpfen aufzugeilen. Ein Konflikt ist eigentlich etwas Wunderbares, er hält uns innovativ und produktiv, sogar lebendig und evolutionär fit – sofern er richtig gestaltet wird. Ohne eine gemeinsame Zukunftsvision aber wird das nichts. Insofern sollte es ein explizites Ziel sein, positive Veränderungen unserer überbeschleunigten Zeit hervorzuheben und zu zeigen, wohin die Reise geht, seien es Arbeit, Umwelt, Wohnen, Einkommen oder Digitalisierung. Themen, entlang derer sich der Generationenkonflikt abbildet, der mittlerweile nicht mehr ansatzweise produktiv ist.
Es ist eine falsche Dichotomie zwischen Alt und Jung entstanden, die vermeintlich entgegengesetzte Ziele haben. Dabei ist das absoluter Quatsch – es verbindet uns weit mehr, als uns trennt. »Besser streiten!«, lautet daher die Devise. Besser eine Auseinandersetzung austragen, sie klären, um dann gemeinsam nach vorne schauen zu können, statt regressiv in sich hineinzuschmollen.
Fridays for Future hat den Anfang gemacht. Das wahre Zeitalter der Rebellion, vielleicht sogar Revolution, beginnt zum Glück erst jetzt. Vielleicht hilft uns sogar eine Pandemie ein bisschen beim Wandel. Mögen wir in spannenden Zeiten leben.
For Posterity
Im Englischen gibt es ein fantastisches, fast vergessenes Wort namens posterity – nicht zu verwechseln mit prosperity, dem Wohlstand. Gewöhnlich setzt man posterity mit dem Begriff »Nachwelt« gleich, wobei »enkelfit machen« es noch besser trifft. Beide klingen allerdings etwas pathetisch. Nichtsdestotrotz beschreibt es ein Prinzip, das wir als Gesellschaft dringend wieder brauchen. Es bedeutet schlicht und ergreifend, etwas für die Generationen und die Welt nach der eigenen zu tun. Noch pathetischer könnte man es mit dem altgriechischen Leitsatz beschreiben: »Eine Gesellschaft wird groß, wenn alte Männer Bäume pflanzen, in dessen Schatten sie niemals sitzen werden.« Bisschen ausgelutscht, I know. Vor allem der Teil mit den Männern ist nicht so wahnsinnig gut gealtert – aber der Sinn ist klar.
Bis jetzt waren wir eher im Prosperity-Modus unterwegs. Live long and prosper, wie der große Babyboomer-Philosoph Mr Spock von Star Trek einst sagte. Das ist ja an sich nichts Schlechtes, ich würde auch gerne lang leben und gedeihen (so lautet die halboffizielle Übersetzung). Wachstum, Wohlstand, Individualisierung: lohnenswerte Ziele für jede Generation. Nur ist das Ganze leider etwas zu ichbezogen, das »Wir« gerät dabei außer Reichweite. Eigentlich kein Wunder, die Babyboomer sind schließlich auch bekannt als die Me-Generation. Und nicht nur sie: Generationenkonflikte, gemischt mit der Hyperindividualisierung der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, haben dazu geführt, dass Generationen tendenziell eher im eigenen Interesse handeln. Es wurde rebelliert, gekämpft, und in den Siebzigern änderte sich kulturell so einiges. Die Welt wurde schöner, liberaler und globaler. Wachstum, Wachstum, Wachstum …
Die Grundformel des »Ich, immer mehr, immer besser« ging rund dreißig Jahre lang gut. Bis zur Fridays-for-Future-Bewegung schaute die Generation Prosperity zu, ruhte sich auf ihren Lorbeeren aus, viel mehr Wandel passierte subsequent nicht. Würde die Erde das aushalten, könnten wir dieses Spiel ewig so weiterspielen. Linearität aber kann gefährlich sein: ein bisschen Veränderung hier, eine kleine Reform dort, während eine Generation in die Fußstapfen der nächsten tritt. Der Blick der Boomer war zu sehr nach innen gekehrt, die Generationstrennlinien zu verhärtet. Nun ist eine neue Einstellung gefordert, eine neue Zukunftsvision muss her, hinter der sich alle Altersgruppen vereinen können. Genug ge-prospert, Zeit für posterity. Dass Eltern das Beste für ihre Kinder wollen, ist nicht neu – doch dass der Blick dabei über die Grenzen der eigenen Familie, des Landes, des Kontinents hinausreicht, birgt eine Menge Potenzial für gesunde Veränderungen. Das Gute an dem Prinzip: Es gilt für alle, auch für mich, meine Kinder und all die, die folgen werden. Somit kann man niemandem Generationsegoismus unterstellen.
Prosperity im einundzwanzigsten Jahrhundert wird es ohne posterity nicht geben – kein Zufall, dass die Worte so ähnlich und doch anders sind.
Kapitel 1
Das Zeitalter der Rebellion
Sie standen vor den Toren der Hegemonie und rebellierten. Auf den Straßen, auf Social Media, überall dort, wo man sie sah, dort, wo es wehtat. Aber warum? Eigentlich war doch alles ganz in Ordnung. Die Wirtschaft, der Motor der Welt, schnurrte genüsslich vor sich hin – wenngleich es alle zehn Jahre mal crashte. Halb so schlimm. Wir flogen um die Welt, und während die Sommer graduell heißer wurden, versteckten wir uns in unseren Filterblasen im Netz. Egal, lief doch alles so, wie es sollte – zumindest an der Oberfläche. Und doch standen sie da und rebellierten. Es gab da nämlich ein kleines Problem in der noch sehr fernen Zukunft: das Klima. Wir Menschen haben es ernsthaft geschafft, die Kohlendioxidwerte der Atmosphäre auf ein Level zu bringen, das es seit mindestens 800.000 Jahren nicht gegeben hat. Die Gletscher schmelzen in den Ozean, die Temperaturrekorde überbieten sich mit vorausschaubarer Regelmäßigkeit. Wobei: »Zwei Grad wärmer« klingt für viele Schlechtwetterhassende gar nicht so schlimm. Bisschen mehr Sonnencreme, und geht schon. Nur doof, wenn der Lieblingsstrand unter Wasser steht, weil die Ozeane durchgehend ansteigen, da kommt man schon ins Nachdenken. Andererseits: »Erderwärmung? – Bei mir schneit es doch gerade!«
Wer zwischen Wetter und Klima nicht unterscheidet, sollte sich Sorgen machen, denn ihm mangelt es an der Fähigkeit, das große Ganze zu verstehen. Im Kontrast zum regionsbezogenen Wetter ist das Klima mit viel größeren Zeiträumen und meteorologischen Prozessen verbunden – und genau dort schlagen die Expert:innen Alarm. Die Erderwärmung könnte die Menschheit an den Rand der Existenz drängen. Trotz der Brisanz, der Dringlichkeit ist dies für viele ein langweiliges Thema, nur tauglich für Verzichtsfetischisten oder Öko-Fritzen. Warum sollte man sich für ein Problem in fünfzig Jahren ändern oder gar Lebensqualität verlieren – wer will das schon?
Die Fridays-for-Future-Bewegung war vor allem eines: unangenehm. Sie steckt uns noch in den Knochen, verschwunden ist sie nicht, sondern eigentlich im Zeitgeist angekommen. Noch nie ging es uns so gut, und gerade da begannen die Kids von ökologischer Bewegung zu sprechen und entwickelten utopische Vorstellungen von einer grünen Zukunft. Sie verbündeten sich im Netz und gingen für den guten Zweck auf die Straße. Unfassbar, lebten sie doch hauptsächlich in ihrem Smartphone. Forderungen wie bedachter Konsum, weniger Reisen und vor allem ein leicht antikapitalistischer Unterton gefielen der Hegemonie so gar nicht. Versuche, die Bewegung generationenübergreifend zu gestalten, erwiesen sich als nahezu unmöglich. Die Frage ist nur: Warum? Denn eigentlich ist die Erderwärmung doch ein Problem für jeden Einzelnen von uns.
Wenn Ältere sagen oder auch nur denken, es betreffe sie nicht, sie seien zum Zeitpunkt des globalen Meltdowns ja schon tot, ist das zu kurz gegriffen, vom Zynismus ganz abgesehen. Dahinter steckt vermutlich eine ungesunde Dosis Gier oder Egoismus, gelegentlich aber auch eine tiefere Verletzung. »Wir haben euch diese wunderschöne Welt geschaffen, und als Dank geht ihr auf die Straße und kritisiert uns? Fuck you – we’ll burn the whole house down!« Dank Facebook und Co. war die passende Gegenbewegung zu Fridays for Future schnell vor Ort, jeder ihrer Anhänger:innen angeblich mit mehr Wissen ausgestattet als sämtliche Expert:innen zusammengenommen. Mit Halbwahrheiten wurde rumgefuchtelt, auf Klimatologe:innen herzlich wenig gehört. Anfangs glaubten die jungen Klimakämpfer:innen, diese »Querdenker:innen« würden sich schon noch beruhigen. Doch das stellte sich als Quadratur des Kreises dar – eine unlösbare Aufgabe, solange ein inhaltlicher Diskurs nicht möglich war. Die Klimaleugner:innen wurden schon bald die Impfgegner:innen des Planeten. Lästig, laut, pseudowissenschaftlich und nur dank einer noch gesunden Umwelt möglich. Doch es ist leicht, Bullshit zu reden, wenn die Gefahr einen selbst noch nicht betrifft. Sobald die Covid-19-Pandemie zum Normalzustand wurde, waren genug Verschwörungstheorien im Umlauf, und sie kamen wieder aus ihren Löchern gekrochen. Die Lage erhitzte sich – zumindest weitgehend –, aber nur auf einem diskursiven Level. Es blieb ja noch etwas Zeit.
Das Machtgefälle sprach nicht gerade für die Verfechter:innen des Planeten. Gefühlt hauptsächlich aus der Generation Z stammend, also ab 1995 geboren, war die Fridays-for-Future-Bewegung im Schnitt sehr jung. Das Medien-Narrativ lautete entsprechend: »Noch nicht einmal im Berufsleben angekommen, geschweige denn mit irgendeinem Kapital ausgestattet – außer einem moralischen –, stellen die plötzlich Forderungen? Frechheit.«
Nicht wenige Klimaaktivisten:innen mag es erstaunt haben, mit welch lahmen Argumenten ihnen die Gegner:innen kamen. Und dass sie damit Erfolg hatten. Eine Symbolfigur musste her, und das schleunigst, sonst würde das nichts, dachten sie sich. Die Lage war so düster, sie drängte jeden noch so Introvertierten zu den Protesten. Untypisch, so wie die Leitfigur der neuen Öko-Bewegung. Greta Thunberg ist keine laute, charismatische oder narzisstische Person. Das ruhige, stille schwedische Schulmädchen wurde dennoch zum Gesicht der Fridays-for-Future-Bewegung – und sie wurde gehört.
Politiker:innen und Schauspieler:innen, Welt- und Zeitgeist-Führer:innen ließen sich mit Greta abfotografieren. Sich noch schnell den Thunberg-Stempel holen, bevor man dann entspannt, genau, nichts tat. Ein paar luftige, nicht bindende Klimaziele absegnen, und die Sache war gegessen. Endlich wieder Ruhe für das System, das war ja anstrengend. Hoffentlich würden die unbequemen Kids bald wieder Ruhe geben. Man konnte doch die Wirtschaft nicht herunterfahren! Das hieße ja Verzicht. Und der ist gegen den menschlichen Fortschritt. Die »Bewegung« samt ihrer schüchternen Anführerin sollte endlich zurück in die Schule – sonst gäbe es am Ende keinen guten Job. So ein Pech, Aufstand abgesagt. So viel zur Geschichte der Rebellion.
Öko-Proteste gegen »das System« und dessen Institutionen, die den Planeten langsam zermürben, sind im Grunde nichts Neues. Nur hatte diesmal die vorherige Generation die Welt nicht fast zerstört, sondern sie eigentlich wiederaufgebaut. Gegen den Zweiten Weltkrieg und die Gräueltaten, die dort unter dem »Deckmantel des Fortschritts« passierten, »durfte« man ja noch richtig protestieren. Das war begründbar und rechtschaffen, hier setzt mein Zynismus für einen Moment sogar aus. Leider aber beging die Hippiebewegung den Fehler, zu viele soziale Normen gleichzeitig zerbrechen zu wollen. Freie Liebe schön und gut, aber Umwelt und Drogen? Das war zu viel des Guten.
Tragischerweise hätte es zwischen Fridays for Future und der Achtundsechziger-Bewegung viel synergetisches Potenzial gegeben. Statt Konflikt und Generationenstreit hätte man gemeinsam der früheren Mission der Eltern und Großeltern nachgehen können. Die Hegemonie bestand generationsmäßig schließlich zu einem Großteil aus denjenigen, die damals rebelliert hatten. Aber irgendwie versandete jenes Potenzial im Generationenkonflikt, von Medien und Echokammern ins Netz getrieben. Anstatt sich darauf zu besinnen, dass man eigentlich dieselben Werte verfocht oder zumindest mal verfochten hatte, wurden Lager gebildet. Die stillen Unterstützer:innen aller anderen Altersgruppen wurden nicht gehört, obwohl sie sicherlich die Mehrheit bildeten. Die Babyboomer-Generation, die das Fundament für die Welt des einundzwanzigsten Jahrhunderts legte, ist nicht spießig geworden. Oder wenn, dann nur ein paar. Sie fühlte sich aber kritisiert und nicht für ihre Errungenschaften wertgeschätzt. So wurde den Boomern schnell unterstellt, sie hätten ihre Ideale verloren. Seien in den Achtzigern und Neunzigern selbstgefällig geworden, hätten ihren Einsatz für das Klima eher als »Jugendrebellion« statt als Suche nach echtem Wandel verbucht, und seien vom handlungsbereiten Hippie zum Spießer geworden. Mieses Timing, anders kann man es nicht ausdrücken. Denn eigentlich richtete sich die Rebellion ja nicht gegen die Eltern. Die jüngere Generation musste lange nach einem Grund suchen, um auf die Straße zu gehen. Sich gewohnheitsmäßig gegen die starren, konservativen Einstellungen der Eltern aufzulehnen, war nicht zwingend nötig. Schließlich hatten die Babyboomer die Welt in sozialen wie in finanziellen Fragen maßgeblich verbessert und für eine Liberalisierung der Gesellschaft gesorgt. Wie also rebelliert man nun gegen jemanden, der einen im Grunde so akzeptiert, wie man ist? Im Vergleich zur Revolution der Siebzigerjahre fand somit keine Rebellion gegen die Eltern per se statt, sondern die Forderung nach einer weiteren Evolution der schönen Welt, die sie geschaffen hatten. Auch wenn das nicht immer so rüberkam. Allerdings sind bei der Kommunikation Sender und Empfänger gleich wichtig.
So gingen die Anhänger:innen der Fridays-for-Future-Bewegung also auf die Straße, und es brachte außer ein bisschen Aufmerksamkeit herzlich wenig. Ein paar leere Versprechen folgten, umgesetzt wurde von denen »da oben« jedoch relativ wenig. Mit Neo-Nationalisten und protektionistischen Größen wie Trump & Bolsonaro an der Macht, weigerten sich sogar große Staaten, beim gängigen moralischen Greenwashing mittels PR und Spenden mitzumachen. Und das trotz der erdrückenden Fakten, trotz der extremen Erderwärmung. Ganz offenbar war es einigen immer noch zu viel, wenigstens so zu tun, als täten sie etwas.
Was könnte dann helfen?, fragten sich die jungen Protestierenden und mit ihnen, meist im Stillen, auch jene, die mit ihnen sympathisierten.
In der Verzweiflung braucht es einen außergewöhnlichen, unerwarteten Verbündeten. Am Ende rückte die Kavallerie in Form einer Pandemie an. An der Spitze der Coronakrise wurde auf einmal all das, was in der Fridays-for-Future-Bewegung gefordert wurde, möglich – und weit mehr. Reisen, Konsum, unser Alltag wurden auf ein Minimum zurückgeschraubt. Rückbesinnung auf das Wesentliche. Vielleicht ging der Zeitgeistwandel so leicht vonstatten, weil die Klimaleugner:innen mit dem Impfgegnertum beschäftigt waren. Fünfzehn Prozent der Gesellschaft sind anscheinend einfach dafür, dagegen zu sein. Die Wirtschaft wurde also heruntergefahren, um Menschenleben zu retten. Im ökologischen Footprint des Jahres 2020 können wir sogar einen Dip im CO2-Ausstoß erkennen. So hat sich der »Earth Overshoot Day«, also der Tag, an dem wir Ressourcen für ein ganzes Jahr auf der Erde bereits verbraucht haben, zum ersten Mal verspätet. Seit 2010 hatten wir bereits im August unsere ökologische Grenze für das gesamte Jahr erreicht, im Coronajahr 2020 war es September – immerhin. Starke Stilbilder machten im Netz die Runde: Delfine schwammen in Venedig, man konnte London dank reduziertem Smog auf einmal wieder in seiner vollen Pracht sehen. Während der kurzen Spaziergänge schien der Wald sogar grüner. Und sei es nur, weil man seit Jahren wieder hinging.
Pardon, so extrem war das doch gar nicht gemeint, mögen sich einige Ewiggestrige gedacht haben. Ihnen hatte maximal eine graduelle, leichte Reduktion vorgeschwebt sowie neue Technologien, die endlich ernsthaft gefördert werden sollten. Ein bisschen Entschleunigung, etwas weniger Benzin. Doch auf einmal sahen unsere Rebellierenden, dass es möglich war – wenn auch anders als geplant.
Nicht nur technologische Erlösung, sondern soziale Intelligenz hat uns zu einem Sieg gegen das Virus verholfen. Über die Impfstoffe freuen wir uns alle, aber gerettet haben wir uns auch mit sozialem Verzicht, Maskentragen und einer Prise Solidarität. Der Konsum, das ewige Hamsterrad, das sich Arbeitswelt nennt, alles war kurzzeitig einem völligen Stillstand unterworfen. Vor allem, weil es um die Gesundheit der Alten und Schwachen ging. Das war für die Rebellierenden, die jetzt nicht mehr wirklich aktiv waren, keine große Sache. Schließlich lieben sie ihre Eltern, Opas, Omas. Kein Problem, sich eine Zeit lang einzusperren, nicht zu reisen und zu konsumieren, um sie zu schützen.
Das ist natürlich leicht überspitzt gesagt. Die Jungen haben nicht die Alten gerettet. Im besten Sinne haben wir uns gegenseitig gerettet, so gut das in einer Pandemie geht. Wir haben erlebt, dass mit menschlicher, sozialer Intelligenz und Verhaltensänderung vieles möglich ist. Veränderung, so haben wir gesehen, muss nicht in der Bürokratie und den Institutionen der Welt erstarren und versickern. Ein Wandel ist durchaus möglich, wenn wir als Gesellschaft über die Generationengrenzen hinweg kooperieren – und uns sogar solidarisieren. Ausnahmen bestätigen die Regel. Nach einer gefühlt gescheiterten Rebellion war dies also das nächste prägende Ereignis.
Kann Veränderung also nur dann stattfinden, wenn konkrete Gefahr vor der Tür steht? Wenn nicht das Klima, sondern ein Virus anklopft?
Wir sind besser als das. Diese Katharsis wird Konsequenzen haben. Als unveränderbar erklärte Systeme, Strukturen und Institutionen werden untersucht, hinterfragt und gesprengt werden. Ohne eine Pandemie hätte es in Klimafragen vermutlich noch wesentlich länger gedauert, etwas zu bewegen. Da die Wirtschaft sowieso am Boden ist, haben nun viele der Machtträger:innen jedoch verstanden, dass der Weg nach vorne ein ökologischer sein muss. Mit mehr Erdöl und Kohlekraftwerken wird es keine Zukunft mehr geben – das haben Industrien von Autoherstellern bis Fast Fashion nun endgültig erkannt. Es gibt keinen Weg zurück, das macht der Konsument und Bürger von morgen nicht mehr mit. Spätestens in zwanzig, dreißig Jahren, wenn die Fridays-for-Future-Generation zum Hauptkonsumenten- und Arbeitsblock wird, wird’s schwierig mit althergebrachten Wegen. Unternehmen mögen Planbarkeit – hier ist sie. Wenn sogar Audi und Porsche die Verbrennungsmotoren absagen, wissen wir, da hat sich etwas fundamental verändert.
Eine Flucht nach vorne ist unsere einzige Option. Krisen sind nicht mehr abstrakt, die Gesellschaft wird sich Greenwashing nicht länger gefallen lassen. Insofern mussten wir vielleicht erkranken, um anschließend wirklich zu gesunden. Sollten wir es nicht schaffen, einen besseren Generationsdiskurs zu schaffen, könnte sich das Muster einfach wiederholen – an dieser Stelle liebe Grüße an die Beteiligten der Achtundsechziger-Bewegung. Dann werfen die Kinder der Fridays-for-Future-Generation einen Blick auf ihre Eltern und denken sich: Wie konnten die so spießig werden? Dazu noch ein abwertender Begriff wie »Fridays für Faulenzen«, und wir haben gesellschaftlich wirklich nichts dazugelernt.
Diese Abwärtsspirale gilt es zu brechen.
Das Erlebnis einer intergenerationalen gesellschaftlichen Solidarität, gepaart mit einem Veränderungswillen, der in erster Instanz enttäuscht wurde, ist eine feurige Mischung. Die Kombination dieser Dynamiken war nicht aufzuhalten, aus der Glut entstand eine lodernde Flamme des Wandels. Kaum hatte man Corona nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 gefühlt in den Griff bekommen, ging die nächste Rebellion los. Und auch sie war gigantisch. Die Kombination aus dem Wissen, was alles wirklich möglich ist, und der angespannten Stimmung führte zu den Black-Lives-Matter-Protesten, die sich prompt über fast den ganzen Globus verteilten. Diesmal richteten sie sich gegen soziale Normen, die nicht hinterfragter Alltag waren. Gegen Rassismus, Ausgrenzung aufgrund der Hautfarbe. Durch die bereits gesellschaftsdurchdringende digitale Vernetzung und verstärkt durch den Fakt, dass wir alle Corona-bedingt sowieso zu Hause vor dem Rechner festsaßen, ging es richtig durch die Decke. Außerdem waren wir nicht von unserem Alltag abgelenkt und konnten reflektieren und sehen, wie schlimm der Zustand in Fragen des Rassismus wirklich ist. Alteingesessene Ressentiments, die teilweise auch institutionell gefestigt waren und es teils noch sind, wurden massiv kritisiert. Von den zugespitzten gewaltvollen Zuständen in Amerika bis hin zum weltweiten Alltagsrassismus.
Gezündet wurde diese Rebellion durch ein mit einer Handykamera aufgenommenes Video, in dem zu sehen ist, wie der Afroamerikaner George Floyd in Minneapolis von einem weißen Polizisten getötet wird. Tragisch ist, dass es solche Videos immer wieder im Netz gab, sie nur niemals zu solch viraler Stärke gekommen waren. Entweder man legitimierte die Inhalte mit »die verrückten Amerikaner und ihre Waffen«, oder man ging in sich und erinnerte sich daran, dass man doch selbst einen Schwarzen im Freundeskreis hat. Hinterlässt im Nachgang einen bitteren Geschmack, oder? Unter Umständen führte das isolierte Reflektieren, das wir alle im Lockdown durchleben mussten, zu ein bisschen Katharsis. Die Zeit war also reif, das Momentum diesmal nicht zu stoppen. Wir konnten nicht wegsehen. Zumal im Hinterkopf noch immer das vermeintliche Scheitern der Fridays-for-Future-Bewegung schwelte, mit einem Drang nach gesellschaftlichem Fortschritt.
Politisch war die Situation eine Katastrophe für die Hegemonie. Populisten wie Trump und seine Freunde konnten mit keiner der beiden Krisen wirklich umgehen. Kooperation ist für Schwache, ich bin mir selbst der Nächste. Soziales oder meteorologisches Klima? Betrifft mich nicht … Die Folge war ein Kollateralschaden, der den Rest der Welt mit sich herunterzog.
An dieser Stelle ist bitte zu beachten, dass die »heile Welt« des späten einundzwanzigsten Jahrhunderts diese Neo-Populisten an die Spitze der Weltmacht beförderte. Vielleicht war die Welt doch nicht so heil, wie wir glaubten. Da muss man sich schon fragen, ob der Status quo wirklich der Weg vorwärts ist oder ob es eine Wende braucht. Populistische Machthaber:innen verkörpern genau das, wogegen sich die Rebellionslust richtet. Wir im Westen haben eine Tendenz, die Gegenwart aufzublähen, weil es uns schließlich ganz gut geht. Von der Spitze aus kann es bekanntlich nur bergab gehen. Tief mit den Strukturen verwachsen, verherrlichen wir die Vergangenheit, getarnt als Gegenwart. Wenn kein Wandel stattfindet, reproduziert sich die Vergangenheit. Somit sorgen wir für eine Zukunft, die es für garantiert niemanden geben wird.