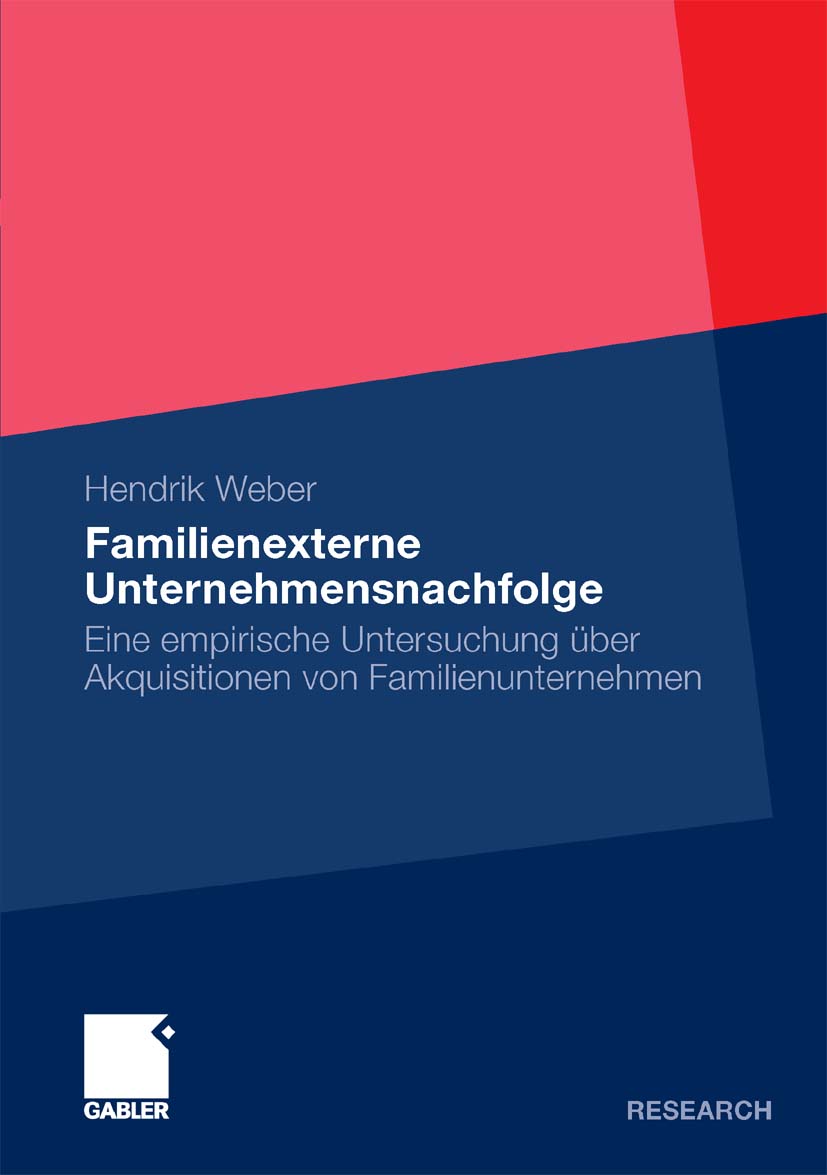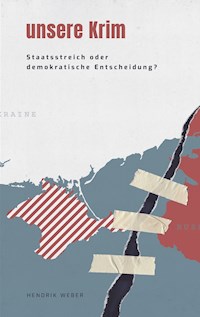
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Krim, Ukraine, Donbass 2014 wurde die Krim von russischen Streitkräften annektiert und die Ukraine destabilisiert. So der Westen. Wer hat das Recht auf die Krim? Was geschah auf dem Maidan in Kiew? Wie ist die Situation im Donbass? Nach zahlreichen Reisen auf die Krim und die Volksrepublik Donezk, kommen in diesem Buch Stimmen zu Wort, die in unseren Medien normalerweise kein Gehör finden. Um die Situation besser verstehen zu können, ist es wichtig, beide Seiten gehört zu haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Geostrategisches Interesse
Der Maidan
Vladimir Konstantinov
Reise auf die Krim
Das Völkerrecht
Sanktionen
Die Krimtataren
Die NATO
Die Volksrepublik Donezk
Volksdiplomatie
Resümee
Landkarte
Literatur- und Quellennachweise
Quellennachweise
Vorwort
Antirussische Sanktionen: ein gefährlicher Weg Europas, der in eine Sackgasse führt.
Zuallererst möchte ich dem Autor dieses Buches für die Möglichkeit danken, die zu informieren, die an wahrheitsgemäßer Information über Russland und der Krim interessiert sind, und die unsere Position zu einem so sensiblen Thema, wie Sanktionen, die unsere fragile und aus dem Gleichgewicht gekommene Welt ruinieren, kennenlernen wollen.
In dieser Hinsicht möchte ich gerne drei Hauptthemen nennen.
Der erste Aspekt ist der ökonomische Einfluss der illegalen Sanktionspolitik der westlichen Länder. Wir betiteln diese als illegal, denn legal kann diese nur sein, wenn sie vom UN-Sicherheitsrat beschlossen wird. Die Absurdität dieser Politik gegen Russland, ein Land, das nicht nur eine starke und stabile Wirtschaft hat, sondern auch in der Tat eine Ressourcenbasis für Europa darstellt, ist offensichtlich. Es entsteht der Anschein, als ob jemand die Tür zu seiner eigenen Kammer, gefüllt mit wichtigen Waren, schließt und sich selbst der Dinge beraubt, die er täglich braucht. Und es sieht ungünstig aus.
Gemäß unserer Einschätzung ist der Verlust für die Wirtschaft Europas viermal höher als die Russlands (50 Milliarden US-Dollar Verlust für Russland und mehr als 200 Milliarden US-Dollar für die EU-Länder). Lassen Sie mich unterstreichen, dass Russlands Gegenmaßnahmen absolut symbolisch waren und nur den Agrarsektor betrafen. Diese Umstände brachten uns die schnelle Entwicklung unserer eigenen Landwirtschaft.
Ferner zerstört die Sanktionspolitik die Weltwirtschaft und das Kapital der Welthandelsorganisation.
Der zweite Aspekt bezieht sich auf die Sanktionen, die aus einem politischen Standpunkt gesehen, zu Instabilität und in den internationalen Beziehungen in eine Sackgasse führen. Sie können der Grund für Konfrontationen zwischen den involvierten Ländern sein und einen realen Konflikt schaffen.
Ohnehin endete historisch gesehen Wirtschaftspolitik häufig mit Krieg und Zerstörung. Wollen wir das wirklich? Natürlich nicht! Das ist der Grund, warum wir die Sanktionen gegen Russland eine Sackgasse nennen.
Der dritte Aspekt ist ein humanitärer. Die Sanktionspolitik beeinträchtigt die Lebensstandards und die Qualität unserer Gesellschaft. Die Wachstumsrate der Arbeitslosigkeit, soziale Spannungen und die Abnahme des Realeinkommens der Bevölkerung sind praktische Ergebnisse dieser Politik.
Eine bildhafte Demonstration dieser Politik sind Sanktionen gegen Syrien, um internationalen Terrorismus zu bekämpfen, und gegen Venezuela, ein Land, das für die eigene Souveränität und gegen den Eingriff in innere Angelegenheiten des Staates kämpft.
Sofern unser Land betroffen ist, vergessen die Organisatoren der Sanktionen die starke Existenzfähigkeit Russlands, ein Land, das selber über alle natürlichen Ressourcen und Produktionsmöglichkeiten verfügt. Unsere Belastbarkeit ist deutlich höher als die Europas. In dieser Hinsicht möchte ich darauf hinweisen, dass wir über historische Erfahrungen verfügen.
Bezüglich der Krim, von der es heißt, Russland hätte ein Gebiet mit Russen «besetzt» (verrückt, nicht wahr?), war es das Bestreben der EU, die totale Blockade dieser russischen Republik zu organisieren. Dies war als Strafe für die Einwohner der Krim gedacht, die (97 % der Bewohner) bei dem legalen Volksentscheid 2014 für die Wiedervereinigung mit Russland stimmten. Es ist der höchste demokratische Ausdruck des Willens der Menschen, im Einklang mit den Gesetzen der Autonomen Republik Krim und der Ukrainischen Verfassung (Art. 138.2).
Aber die Initiatoren dieser Sanktionspolitik müssen die Sinnlosigkeit darin, eine einzelne Region des mächtigen Russlands zu blockieren, verstehen. Der Beweis dieser Affirmation ist eine rapide Entwicklung der Krim ungeachtet der Sanktionen.
Als ein Ergebnis der Transportblockade hat Russland Auto- und Eisenbahnbrücken sowie einen modernen internationalen Flughafen errichtet. In Erwiderung zu der, durch ukrainische Nationalisten verursachten Sprengung von Stromleitungen, die 80 % der Energie lieferten (und das passierte während des Winters), erwarb Russland sofort hunderte von Stromgeneratoren. Letzten Endes haben wir jetzt zwei enorme Stromkraftwerke auf der Halbinsel selbst fertiggestellt.
Es gibt viele weitere Beispiele für die Ineffizienz der Anti-Krim-Sanktionen.
Das generelle Ergebnis dieser Blockade waren 50 % Zunahme unseres Bruttosozialproduktes in den letzten vier Jahren, ebenso gut wie die Tourismusbranche auf der Halbinsel ein erhebliches Einkommen erwirtschaftet.
All das Obengenannte demonstriert, dass das Regime der Sanktionen generell nutzlos und schädigend für alle Länder und Menschen ist, die in dieses tragische Spiel involviert sind. Wir müssen wirksame Maßnahmen ergreifen, um dies zu stoppen und zu einer fruchtenden konstruktiven Kooperation zwischen Europa und Russland zurückzukehren.
Abschließend würde ich gerne Repräsentanten der Geschäftswelt auf die Krim, zum sechsten Yalta International Economic Forum im April 2020, einladen, um unserem Einsatz für eine neue, positive Agenda und den Aufbau unseres gemeinsamen Wohlstandes beizuwohnen.
Die Organisation Volksdiplomatie Norwegen unter Leitung von Hendrik Weber hat die Krim bereits viele Male besucht und die Auswirkungen der Sanktionen aber auch die Entwicklung der Krim mit eigenen Augen gesehen.
Zum Thema Sanktionen möchte ich schließlich an die symbolischen Worte eines «Rubais», dem Werk des antiken Philosophen und Dichters Omar Chayyām, erinnern:
«Diese, die vom Leben gebissen werden, erreichen viel mehr in Taten,
Wer ein Gel aus Salz gegessen hat, wird den Honig stärker schätzen.
Wer viele Tränen vergoss, dessen Lachen wird herzlich sein,
Und die, die starben, die wertschätzen das Leben so sehr.»
Mit freundlichen Grüßen Dr. Georgy L. Muradov Stellvertretender Ministerpräsident, Ständiger Vertreter der Republik Krim beim Präsidenten der Russischen Föderation, Botschafter
Einleitung
Ich möchte dieses Buch mit einem Zitat beginnen:
«Nun, natürlich, das Volk will keinen Krieg. Warum sollte auch irgendein armer Landarbeiter im Krieg sein Leben aufs Spiel setzen wollen, wenn das Beste ist, was er dabei herausholen kann, daß er mit heilen Knochen zurückkommt? Natürlich, das einfache Volk will keinen Krieg; weder in Russland, noch in England, noch in Amerika, und ebenso wenig in Deutschland. Das ist klar.
Aber schließlich sind es die Führer eines Landes, die die Politik bestimmen, und es ist immer leicht, das Volk zum Mitmachen zu bringen, ob es sich nun um eine Demokratie, eine faschistische Diktatur, um ein Parlament oder eine kommunistische Diktatur handelt. ( …)
Das Volk kann mit oder ohne Stimmrecht immer dazu gebracht werden, den Befehlen der Führer zu folgen. Das ist ganz einfach. Man braucht nichts zu tun, als dem Volk zu sagen, es würde angegriffen, und den Pazifisten ihren Mangel an Patriotismus vorzuwerfen und zu behaupten, sie brächten das Land in Gefahr. Diese Methode funktioniert in jedem Land.»1
Das Zitat stammt vom 18. April 1946 und ist von Hermann Göring, als er in der Gefängniszelle in Nürnberg sein letztes Interview gab.
Kann man diese Aussagen auch auf die heutige Zeit übertragen? Durch unsere Regierungen und Medien wird uns tagtäglich Angst gemacht. Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, vor einer schlechteren sozialen Absicherung, vor dem islamischen Terrorismus, dem Iran, Nordkorea und natürlich Angst vor Russland. Angst ist allerdings ein schlechter Ratgeber: Sie lähmt uns, die richtigen Entschlüsse zu fassen und für diese zu streiten.
Medien spielen in der heutigen Politik eine noch viel wichtigere Rolle als zu Hermann Görings Zeiten. Sie transportieren die Meinung der Regierung in unsere Wohnzimmer und teilen uns allzu oft auch gleichzeitig mit, wie wir über die jeweilige Nachricht zu denken haben.
Medien, die in ihren Artikeln von der offiziellen Meinung abweichen, werden von den etablierten Medien als Fake News beschimpft und teilweise aktiv in ihrer Arbeit behindert. Das heißt selbstverständlich nicht, dass unsere staatlich kontrollierten Medien generell schlecht und sogenannte alternative Medien generell gut sind. Durch das Internet haben unsere staatlichen Medien und große Medienhäuser in den letzten Jahren ohnehin dramatisch an Einfluss verloren. Die Verkaufszahlen der meisten Zeitschriften und Zeitungen fallen seit Jahren.2 Heute hat jeder die Möglichkeit, weltweit Informationen aus dem Internet zu bekommen: an jedem Ort und zu jeder Zeit. Es ist scheinbar einfacher geworden, sich eine eigene Meinung zu bilden.
Noch vor 20 Jahren wäre das undenkbar gewesen. Während man damals auf die Fernsehnachrichten angewiesen war, um zum Beispiel Informationen aus einer Pressekonferenz zu erhalten, ist es heute möglich, das gesamte Geschehen live im Internet zu verfolgen und gleichzeitig auch noch Kommentare oder Einschätzungen der jeweiligen Journalisten zu erhalten. Diese ständige Verfügbarkeit von Informationen hat unsere Möglichkeiten der Informationsbeschaffung stark erweitert, birgt aber gleichzeitig auch große Risiken. Zeitungen und Medienhäuser sehen sich unter dem stetigen Druck, neue Nachrichten so schnell wie möglich zu veröffentlichen. In einer Welt, in der Medienhäuser im Wettbewerb zueinander stehen und um Werbeeinnahmen kämpfen müssen, zählen vor allem Geschwindigkeit und die Anzahl der Zugriffe auf die jeweiligen Internetseiten. Eine gute Recherche aber braucht Zeit und kostet daher Geld. Beides ist im derzeitigen Medienalltag kaum vorhanden. Das führt dazu, dass Journalisten und Reporter nicht mehr die Freiheit haben, eine Nachricht wirklich fundiert zu recherchieren.
Die sogenannten «alternativen Medien», die sich auf einzelne Themen oder Nachrichten konzentrieren können und dazu teilweise sehr sachliche und fundierte Artikel schreiben, gewinnen immer mehr Leser, weil der Informationsgehalt ihrer Artikel oft erheblich höher ist als der der sogenannten «Mainstream-Medien».
Das führt dazu, dass Medienhäuser und damit auch der Staat immer mehr das Monopol auf die Meinungsbildung verlieren. Beide kommen durch aufgeklärte Bürger immer mehr unter Druck. Offensichtlich werden falsche oder ungenaue Berichte und Artikel schneller enttarnt, wodurch der Druck auf die Medienhäuser noch verstärkt wird.
Das Resultat ist, dass in vielen Ländern sogenannte «Faktenfinder» eingerichtet wurden. Diese Organisationen sollen den Zuschauern und Lesern bei strittigen Themen die reinen Fakten liefern. Die Gemeinsamkeit bei fast allen dieser Organisationen besteht darin, dass sie von einem Zusammenschluss der grössten Medienhäuser der jeweiligen Länder finanziert werden.3 Hier kontrolliert der Kollege den Angeklagten. Wie objektiv und neutral diese Faktenfinder im Endeffekt wirklich sind, ist daher fraglich.
Im Zuge der sogenannten Ukraine-Krise von 2014 haben die Medienhäuser einem Sturm von entrüsteten Bürgern gegenübergestanden. Leser warfen den Zeitungen vor, zu einseitig zu berichten und die wichtigen Zusammenhänge nicht ausreichend zu erklären.
In diesem Buch will ich mich mit den Themen Ukraine, Krim und Donbass und der gefühlten Angst vor Russland befassen. Ist diese Angst wirklich berechtigt oder nur erzeugt? Meine Antwort dazu ist klar: Sie ist seit Jahren künstlich erzeugt. Das Einzige, was uns helfen kann, diese Angst und das Misstrauen zu überwinden, ist ein Dialog mit Russland und gegenseitiges Verständnis. Verständnis heißt dabei nicht, dass man sich die Meinung des anderen zu eigen machen muss. Aber Dialog und Diplomatie helfen, den anderen zu verstehen, um die Situation richtig einschätzen zu können. Man kann dies Volksdiplomatie nennen.
Mit Russland verband mich bis 2015 gar nichts. Ich hatte weder russische Freunde noch russische Arbeitskollegen und hatte daher keinerlei Kontakte zu Menschen aus Russland. In den Jahren zuvor, hatte ich die Nachrichten im Bezug auf Russland weder im Fernsehen noch in der Zeitung besonders aufmerksam verfolgt.
Einzig von meinem Großvater, der im Zweiten Weltkrieg zwischen 1941 und 1944 als Panzergrenadier der 6. Panzerdivision in Russland gekämpft hat, kannte ich Geschichten mit oder von Russen.
Ende 2013, im Zuge der Ukraine-Krise und der beginnenden Demonstrationen auf dem Maidan in Kiew, mehrten sich die Zeitungsartikel in unseren westlichen Medien darüber, dass Russland der eigentliche Auslöser der Unstimmigkeiten zwischen West und Ost war.
Vladimir Putin, der 2012 erneut zum russischen Präsidenten gewählt worden war, wurde in westlichen Medien persönlich für die Ausschreitungen und das Scheitern der Verhandlungen zwischen der Ukraine und der Europäischen Union verantwortlich gemacht. Er wolle einen Keil zwischen Europa treiben. Das Bild eines skrupellosen Despoten, der auch vor dem Abschuss von Passagierflugzeugen (MH 17) nicht zurückschreckte, um seine Ziele zu erreichen, wurde auf Zeitschriften-Covern und in Zeitungsartikeln verbreitet.4
In den darauffolgenden Jahren, als die Krim längst wieder ein Teil der russischen Föderation geworden war, und in der Ostukraine die beiden selbstständigen Republiken Donezk und Lugansk ausgerufen worden waren, rissen die Zeitungsartikel über ein «unberechenbares Russland» nicht ab.
Anfang 2015 habe ich angefangen, mich für die Zusammenhänge in Russland und in der Ukraine zu interessieren. Auslöser für dieses Interesse war einzig und allein die Berichterstattung unserer westlichen Medien, in welchen der russische Präsident Putin nahezu für alles Unheil in der Welt verantwortlich gemacht wurde. Die Überschriften waren teilweise derart übertrieben und polemisch gestaltet, dass es mir schwerfiel, mich den Artikeln mit dem nötigen Ernst zu widmen. «Wann stoppt die Welt endlich Putin?», «Der Putin-Komplex», «Putin-Russland übt Krieg über Schweden und Norwegen» und so weiter. Es sah dabei so aus, als wolle Präsident Putin die Weltherrschaft ergreifen, während der Westen nur Demokratie und Menschenrechte fördern wollte.
Zwei Dinge haben mich dabei besonders angetrieben:
1. Ich sah und ich sehe noch immer die Gefahr, dass wir den Kontakt zum größten Land der Erde verlieren. Ein isoliertes Russland kann für uns weder wirtschaftlich noch politisch erstrebenswert sein.
2. Ich finde es ganz einfach nicht gerecht, wenn wir Russlands Handeln mit einem anderen Maß messen als unser eigenes: Sei es das Handeln der EU-Staaten, Norwegens, der USA oder das der NATO. Wir berufen uns auf das Völkerrecht, wenn es uns passt, ansonsten finden wir andere Erklärungen.
Mir schien es wichtig und an der Zeit, mich mehr mit diesem komplexen Thema auseinanderzusetzen, um die Zusammenhänge besser zu verstehen.
Deutschland und Russland verbindet eine lange gemeinsame Geschichte, die bis in das Jahr um 970 nach Christus zurückreicht. Gegenseitiger Respekt und Anerkennung für Leistungen in Kunst, Literatur, Wissenschaft und Technik, trugen selbst in schwierigen Zeiten zu einem überaus guten Umgang miteinander bei.
In Norwegen verbindet uns nicht nur eine gemeinsame neuere Geschichte im Kampf gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg, sondern auch eine gemeinsame Grenze im Norden. Anders als andere Staaten haben sich die sowjetischen Soldaten nach der Befreiung Norwegens umgehend komplett zurückgezogen. Im Norden Norwegens bestehen seit Jahren enge und grenzüberschreitende Verbindungen mit russischen Kultur- und Sportvereinen, zwischen Geschäftsleuten und Freunden. Auf dem zentralen Friedhof in Oslo steht die ca. vier Meter hohe Statue eines sowjetischen Soldaten und darunter die Innschrift «Norwegen dankt euch».
Das politische Norwegen hingegen, wie auch die meisten anderen europäischen Regierungen, baut eine drohende Gefahr auf, die die Bürger unter anderem dazu bewegen soll, mindestens 2 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes für Rüstung auszugeben. Nur sehr wenige offizielle Kontakte zwischen den europäischen Staatsoberhäuptern und dem russischen Präsidenten sind seit 2014 überhaupt zustande gekommen. Die ehemalige norwegische Verteidigungsministerin Ina Eriksen Søreide sprach in einem CNN-Interview am 26. Februar 2015 davon, dass das Verhältnis zu Russland nie mehr so wird, wie es mal war. «( …) Wir stehen vor einem anderen Russland. Ich möchte davor warnen, dass einige Leute das als etwas sehen, was vorübergehen wird. Die Situation hat sich geändert. Und sie hat sich grundlegend verändert.»5 Nicht viel anders reagieren auch andere europäische Minister und Regierungschefs. Die norwegische Staatsministerin Erna Solberg hat Russland Anfang 2019 zum ersten Mal seit fünf Jahren für ein kurzes Gespräch mit Vladimir Putin besucht.
Die Kette der Beschuldigungen gegen Russland und speziell gegen Präsident Vladimir Putin scheint nicht abzureißen. In vielen Medienberichten wird er als der persönlich Schuldige dargestellt. Das Scheitern des EU-Assoziierungsabkommens mit der Ukraine, die militärische Auseinandersetzung in der Ostukraine, der Abschuss der Passagiermaschine der Malaysia Airlines MH17, die Vergiftung des Doppelagenten Sergey Skripal und seiner Tochter im englischen Salisbury, die Einmischung in die US-Präsidentschaftswahlen etc.: Die Liste der Vorwürfe ist lang.
Das Problem bei allen diesen Anklagen ist, dass eindeutige Beweise fehlen. Als Reaktion auf die vermeintliche Vergiftung des Doppelagenten Sergey Skripal durch Russland, wies die Bundesrepublik Deutschland vier russische Diplomaten aus. Norwegen schickte einen Diplomaten zurück nach Russland.6 Eine drastische Maßnahme für eine Tat, für die noch immer keine Beweise vorliegen. Die stellvertretende Regierungssprecherin der Bundesregierung sagt dazu im April 2018 in der Bundespressekonferenz, «( …) dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine russische Verantwortung gibt und dass es aus unserer Sicht keine andere plausible Erklärung gibt.»7
Die ständige Wiederholung der Vorwürfe – auch ohne Beweise – lässt diese bei vielen automatisch zur Realität werden. Selbst wenn sich nachher herausstellen sollte, dass Russland keine Schuld trifft, so bleibt für viele unbedarfte Bürger doch ein Beigeschmack.
Ein anderes Beispiel dafür ist die angebliche Einmischung Russlands in die US-Präsidentschaftswahlen 2016. Als nach langen Ermittlungen des Sonderberaters Robert Mueller, 2019 der sogenannte Mueller-Report erschien, konnten keinerlei Beweise für eine russische Einmischung dokumentieren werden. Auch konnte keine unerlaubte Verbindung zwischen den Präsidenten Putin und US-Präsident Trump nachgewiesen werden, die zu rechtlichen Konsequenzen führen können. Durch die ständige Wiederholung der falschen Vorwürfe in den Jahren zuvor, bleibt bei vielen Menschen trotzdem eine Verbindung zwischen «Russland» und den «US-Wahlen» hängen. Nach Veröffentlichung des Berichtes haben viele Medien ihre Strategie daher einfach geändert und behauptet, dass der Bericht keine konkreten Beweise vorlege, die Russland bzw. US-Präsident Donald Trump entlasten könne. Übergangen wird dabei von den Journalisten, dass ein Ermittler nicht zur Entlastung des Angeklagten eingesetzt wird, sondern zum Beweisen seiner Schuld.
Der Eindruck entsteht, dass der Westen im Verhältnis mit Russland mit einer Beweislastumkehr arbeitet. Wir legen zwar keine Beweise einer Schuld vor, sollte aber Russland tatsächlich unschuldig sein, muss es das erst einmal beweisen. Bei anderen Ländern verfahren wir nicht so.
Die Tatsache, dass der ehemalige US-Präsident Bush – genau wie der jetzige US-Außenminister Mike Pompeo – der Direktor des Geheimdienstes CIA8 war, spielt in den meisten Medien keine Rolle, wohingegen Putin als verdächtig und gefährlich gilt, weil er beim KGB in Ostdeutschland als Offizier gearbeitet hat.
Während der frühere US-Präsident Obama den Friedensnobelpreis erhielt und beim Deutschen Evangelischen Kirchtag zum Thema «Engagiert Demokratie gestalten – Zuhause und in der Welt Verantwortung übernehmen» referiert, weitete er gleichzeitig den Drohnenkrieg9 extrem aus. Dabei verschweigen unsere Zeitungen und Journalisten die Tatsache, dass Obama, als erster Präsident der USA, an jedem einzelnen Tag seiner Amtszeit Krieg geführt hat. Viel lieber erzählen uns die Medien, dass sehr wahrscheinlich Vladimir Putin den Befehl zum Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 über der Ostukraine gegeben habe. Stichhaltige Beweise gibt es nicht und wenn, dann nur von selbsternannten Rechercheteams wie «Bellingcat» oder anderen zwielichtigen Netzwerken, die zum grössten Teil von US-Amerikanischen Think-Tanks finanziert werden.
Das ist Messen mit zweierlei Maß. Unsere Medien blasen mit Hilfe von vermeintlichen Russlandexperten, Nachrichten zu Top-Storys auf, obwohl bereits von Anfang an klar sein dürfte, dass keine Fakten dahinterstehen.
Wir sollten uns fragen, warum das passiert. Ist es nur Zufall oder steht eine Strategie dahinter?
Geostrategisches Interesse
Jedes Land verfolgt in seiner Außenpolitik geopolitische Interessen: die USA, die Länder der Europäischen Union und auch Russland. Zu glauben, dass der Westen keine geostrategischen Interessen hat, ist bestenfalls naiv.
In Bezug auf Russland fällt es uns oft leicht, dieses Interesse zu benennen. Der Grund dafür ist, dass diese Information gerne von den Medien transportiert wird, während das Benennen der eigenen Interessen oft im Hintergrund bleibt.
Das geopolitische Interesse der USA in Bezug auf den eurasischen Kontinent und Russland wurde bereits 1997 von Zbigniew Brzezinski in seinem Buch «Die einzige Weltmacht – Amerikas Strategie der Vorherrschaft»10 beschrieben. Er war jedoch nicht der erste, der diese Ziele beschrieben hat, sondern bezieht sich teilweise auf die Thesen des Engländers Halford Mackinder (1861–1947), der im Jahr 1904 einen Aufsatz veröffentlichte mit dem Titel «Der geografische Drehund Angelpunkt der Geschichte». Dieser Aufsatz ist die Grundlage für die sogenannte «Herzland-Theorie». Mackinder teilte die Welt in verschiedene Teile und war der Meinung, dass die zusammenhängenden Kontinente Europa, Asien und Afrika die «Weltinsel» darstellen. Hier leben die meisten Menschen der Erde und hier gibt es die wichtigsten Bodenschätze und Ressourcen. Er schreibt: «Wer über Osteuropa herrscht, beherrscht das Herzland. Wer über das Herzland herrscht, beherrscht die Weltinsel. Wer über die Weltinsel herrscht, beherrscht die Welt.»11
Zbigniew Brzezinski bezieht sich teilweise auf diese Theorie. In seinem Buch schrieb der ehemalige US-Präsidentenberater bereits vor Jahren nieder, wie sich seiner Meinung nach die Verhältnisse auf dem eurasischen Kontinent entwickeln müssen, damit die USA ihre Vormachtstellung in der Welt behalten.
Er schreibt unter anderem: «Die Ukraine, Aserbaidschan, Südkorea, die Türkei und der Iran stellen geopolitische Dreh- und Angelpunkte von entscheidender Bedeutung dar. ( …) Die Ukraine, ein neuer und wichtiger Raum auf dem eurasischen Schachbrett, ist ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt, weil ihre bloße Existenz als unabhängiger Staat zur Umwandlung Russlands beiträgt. Ohne die Ukraine ist Russland kein eurasisches Reich mehr. Es kann trotzdem nach einem imperialen Status streben, würde aber dann ein vorwiegend asiatisches Reich werden, das aller Wahrscheinlichkeit nach in lähmende Konflikte mit aufbegehrenden Zentralasiaten hineingezogen würde, die den Verlust ihrer erst kürzlich erlangten Eigenständigkeit nicht hinnehmen und von den anderen islamischen Staaten im Süden Unterstützung erhalten würden. ( …) Wenn Moskau allerdings die Herrschaft über die Ukraine mit ihren 52 Millionen Menschen, bedeutenden Bodenschätzen und dem Zugang zum Schwarzen Meer wiedergewinnen sollte, erlangte Russland automatisch die Mittel, ein mächtiges Europa und Asien umspannendes Reich zu werden. ( …) Da zunehmend Konsens darüber besteht, dass die Nationen Mitteleuropas sowohl in die EU als auch in die NATO aufgenommen werden sollten, richtet sich die Aufmerksamkeit auf den zukünftigen Status der Baltischen Republiken und vielleicht bald auf den der Ukraine.»12
Brzezinski beschreibt sehr genau die internationalen und geopolitischen Zusammenhänge und Schritte, die seiner Meinung nach nötig sind, damit die USA weiterhin die «einzige Weltmacht» bleiben. In einem ganzen Kapitel widmet er sich dabei den für ihn sehr wichtigen Themen Russland, Ukraine und Europa. Die Kernaussage seines Buches könnte man wie folgt zusammenfassen:
Die USA muss den Einfluss auf Europa ausbauen und Europa und Russland voneinander trennen, um ihre Vormachtstellung zu behalten. Wenn man dem Glauben schenken möchte, kann man dieses Buch als eine Art Drehbuch ansehen, das momentan von der US-Regierung «abgearbeitet» wird.
Da Zbigniew Brzezinski der Berater gleich mehrerer US-Präsidenten war, sollte man es mit dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt halten, der schrieb: «Ein Buch, das man lesen und ernst nehmen sollte.»13
Auch der ehemalige stellvertretende US-Verteidigungsminister Paul Wolfowitz, der in seiner Funktion eine globale Militärstrategie ausarbeitete, kommt zu dem einfachen Beschluss:
«Unser erstes Ziel ist es, das Wiederauftreten eines neuen Rivalen auf dem Territorium der ehemaligen Sowjetunion oder woanders zu verhindern ( …) und eine feindliche Macht daran zu hindern, eine Region zu dominieren, deren Ressourcen unter konsolidierter Kontrolle ausreichen würden, eine Weltmacht entstehen zu lassen.»14
Im Vorfeld des zweiten Irakkrieges tauchte 2002 diese sogenannte «Wolfowitz-Doktrin», als «Bush-Doktrin», wieder auf, in welcher die USA auch militärische Maßnahmen und Präventivschläge gegen andere Staaten zum zentralen Bestandteil der Außenpolitik macht.
Die Politiker und Strategen der USA gehen mit ihren geopolitischen Überlegungen sehr offen um und verheimlichen ihre Absichten nur selten. Unzählige Bücher, Interviews, Internetseiten von NGO`s und Think-Tanks sowie Berichte, lassen tiefe Einblicke in die außenpolitischen Strategien der USA zu.
Wir vergessen leider allzu oft, dass es überhaupt geopolitische Interessen und Strategien gibt. Diese Interessen und Überlegungen sind oft abgekoppelt von unseren täglichen Entscheidungen und politischen Themen mit denen wir uns befassen und sind auf Jahre und Jahrzehnte hinaus geplant und vorbereitet. Wer dies für Verschwörungstheorien hält, der sollte sich Bücher wie «Die einzige Weltmacht» von Brzezinski durchlesen und mit der heutigen Politik der USA vergleichen.
Würden wir diese geopolitischen Interessen der verschiedenen Staaten besser im Blick haben, würden sich uns einige politische Zusammenhänge und Entscheidungen viel besser erschließen.
«In der Politik geschieht nichts zufällig. Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass es auch auf dieser Weise geplant war.»15
Franklin D. Roosevelt (US-Präsident 1882–1945)
Der Maidan
Um die Zusammenhänge in der Ukraine und der vermeintlichen Annexion der Krim durch Russland im März 2014 sowie den Konflikt in der Ostukraine richtig einzuschätzen, ist es notwendig, die Chronologie der Ereignisse zu kennen. Nur so lässt sich verdeutlichen, welche Handlungen Folgen von Aktionen oder Reaktionen waren.
Das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine, welches die wirtschaftlichen und staatsrechtlichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern regelt, sollte eigentlich bereits im Jahr 2011 unterzeichnet werden. Am 21. November 2013 lehnte es der damalige ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch allerdings per Dekret erneut ab, den Vertrag zu unterschreiben.16 Präsident Janukowitsch und Ministerpräsident Asarow sahen vor sich, erst die wirtschaftlichen Probleme der Ukraine in den Griff zu bekommen, bevor sie als Bittsteller auf die Europäische Union angewiesen waren. Frühere Zusagen der Europäischen Union und des Internationalen Währungsfonds (IWF) auf finanzielle Hilfe waren nicht in dem von ihnen erwarteten Umfang eingehalten worden.17 Die Schuld daran lag allerdings teilweise auch bei der ukrainischen Vorgängerregierung, die vereinbarte Absprachen nicht eingehalten hatte. Außerdem hatte der IWF einschneidende Reformen gefordert, die die ukrainische Führung unter Janukowitsch nicht akzeptieren konnte.
Der frühere ukrainische Ministerpräsident Nikolai Asarow sprach dazu 2016 in einem Interview mit dem Onlinemagazin Telepolis von den offensichtlichen Nachteilen des Assoziierungsabkommens für die Ukraine: «( …) Ich würde gern noch zwei, drei Gedanken zum Inhalt dieses Assoziierungsabkommens anbringen. Das, was wir in Wahrheit nach Europa exportieren können, sind zum großen Teil Agrarprodukte. Aber genau diese Produktkategorien waren sehr limitiert durch Einfuhrquoten. Ein Beispiel: Als wir die Gespräche mit Europa begonnen haben, war die Quote für die Einfuhr von Getreide in die EU 20.000 Tonnen. Im Verlauf der Gespräche habe ich es geschafft, dass wir die Quote zumindest auf 200.000 Tonnen erhöhen konnten. Aber die Ukraine produziert mehr als 60 Millionen Tonnen. Und das potenzielle Volumen, das die Ukraine exportieren könnte, sind 30 Millionen Tonnen. Die Frage, die sich für mich natürlich gestellt hat, ist: «Was ist das für ein Freihandelsabkommen, wenn gerade das, was wir exportieren können, sich nicht exportieren lässt, weil man es durch Quoten sehr stark begrenzt?
Oder wir hätten mehr als eine Million Tonnen Fleisch in die EU liefern können. Und man hat uns eine Quote von 20.000 Tonnen gegeben. Wir wären auch in der Lage gewesen, ein großes Volumen an Stahl zu exportieren. Die Produkte des Maschinenbaus, die wir unter Umständen auch hätten exportieren können, waren natürlich limitiert und reglementiert durch die technischen Normen der EU, die nicht identisch waren mit denen der Ukraine.
Aus diesen ganzen Punkten heraus hat sich Ende 2013 die Meinung manifestiert, dass der ökonomische Teil des Assoziierungsabkommens in der derzeitigen Form für die Ukraine nicht vorteilhaft gewesen wäre. ( …) Aber im November 2013, was hatten wir damals vor dem Gipfeltreffen mit der EU? Die finanzielle Hilfe für die Modernisierung der ukrainischen Wirtschaft wurde abgelehnt. Die Erhöhung der Quoten wurde abgelehnt. Ein Überbrückungskredit wurde ebenfalls abgelehnt. Daher hat sich für uns die Frage gestellt, die Unterschrift zu verschieben, bis wir die eben benannten Probleme mit einem Kompromiss gelöst haben. Diesen Moment hat man zur Vorbereitung eines Staatsstreichs genutzt. Auf der diplomatischen Ebene hat Barroso (Präsident der Europäischen Kommission 2004–2014) sehr klar gesagt: «Wenn ihr das nicht unterschreibt, wird es ein anderer Präsident und ein anderer Ministerpräsident unterschreiben.» Ich glaube, dass diese Aussage sehr deutlich unterstreicht, welches Machtverhältnis zwischen der EU und der Ukraine damals existierte.»18
Die Ukraine hatte sehr gute und lang zurückreichende Beziehungen zu Russland, die vom Westen oft unterschätzt werden, oder absichtlich außer Acht gelassen werden. Am 17. Dezember 2013 verabschiedeten Vladimir Putin und der ukrainische Präsident Janukowitsch ein Abkommen, welches der Ukraine 15 Milliarden Dollar seiner Schulden erlassen sollte.19 Zudem bestand gleichzeitig das russische Angebot, Mitglied einer Zollunion mit Russland, Weißrussland und Kasachstan zu werden. Dieses Angebot wäre bei einer Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit der EU in Gefahr gekommen.20
Es hätte bedeutet, dass zollfreie, in die Ukraine eingeführte Waren, zum Beispiel aus Frankreich, aufgrund der Zollunion auch zollfrei weiter nach Russland oder Kasachstan geliefert werden könnten. Zollfreier Handel mit Europa in einer gleichzeitigen Zollunion mit Russland konnte allerdings keine der beiden Seiten akzeptieren. Obwohl Präsident Putin offen für Gespräche mit der EU und der Ukraine war, um eine einvernehmliche Lösung zu finden, wurde dieses Angebot von der Europäischen Union kategorisch, ja fast empört abgelehnt.
Die Ukraine stand in der Mitte, und von beiden Seiten wurde an ihr gezogen. Gleichzeitig hatte das Land weder die wirtschaftliche noch die politische Macht, sich mit Forderungen oder Angeboten gegen einen oder beide möglichen Partner durchzusetzen bzw. selber zu vermitteln.
Das ukrainische Volk, welches von der Unterzeichnung und deren Folgen direkt betroffen gewesen wäre, wurde wie auch bei den meisten Entscheidungen in anderen westlichen Ländern nicht befragt.
Als die Proteste auf dem Maidan, dem großen Platz in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, am 21. November 2013 begannen, waren sie zunächst gegen die Regierung gerichtet – für bessere Lebensbedingungen und gegen Korruption. Anfänglich war die Mehrzahl der Protestierenden Studenten, und die Proteste sollten laut Absprache zwischen der Stadtverwaltung und dem Koordinationsausschuss der Studenten am 29. November um 24.00 Uhr beendet werden, da am darauffolgenden Tag die Stadt mit dem Aufbau des Weihnachtsmarktes beginnen wollte.21
Die Ukraine, die als Teil der Sowjetunion eine der wirtschaftlich stärksten Republiken gewesen war, lag seit Jahren weit unter dem europäischen Durchschnitt. Das BIP (Bruttoinlandsprodukt) pro Ukrainer lag in der Spitze bei knapp 4.000 USD pro Jahr, während Länder wie zum Beispiel die Slowakei ein BIP von rund 19.000 USD22