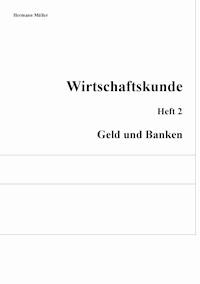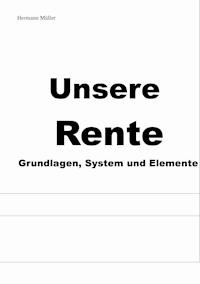
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Autor, Jahrgang 1934, Diplom-Volkswirt mit Versicherungsmathematik, zeigt hier, wie mit dem jedem verfügbaren Kalkulationsprogramm EXEL oder Calc aus den wenigen leicht vom Statistischen Bundesamt zu bekommenden Daten der Sterbewahrscheinlichkeiten sowie der Geburtenziffern die Belastungen des erwerbsfaehigen Bevölkerungsteils durch den Unterhalt der vorhergehenden Generation (Rentner) sowie der Folgegeneration (Kinder) unter beliebigen Annahmen berechnet werden kann, und wie sich die Ansprueche der Rentner auf die Reproduktion der Bevölkerung auswirken. Der Leser kann diese Erkenntnisse dann auf die reale Bevölkerung anwenden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 83
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Bevölkerungsstatistik
2.1 Erhebung der Lebenden und Gestorbenen
2.2 Sterbetafel, die einjährigen Sterbewahrscheinlichkeiten
2.3 Stationäre Bevölkerung
2.4 Stationäre Bevölkerung, modifiziert; verlängerte Sterbetafel
2.5 Stationäre Bevölkerung, modifiziert, Geschlechterverhältnis
„Rentnerseuche“
„Rentnerblühte“
2.6 Natürliche Bevölkerung; die Geburtenwahrscheinlichkeit
2.7 Wanderungen
2.8 Die dynamische Bevölkerung
2.9 Reale Bevölkerung
Die Last der Erwerbsfähigen
3.1 Lastquoten, abgeleitet aus der Demographie
3.2 Lastquote in Geld
Alterssicherung ohne Kinder?
Finanzierung
5.1 Biologische Vorsorge (eigene Kinder)
5.2 Kapitalansammlung
5.2.1 Sparen in Nominalwerten
5.2.2 Sparen in Realwerten
5.2.3 Steuern
5.2.4 Private Eigenvorsorge
5.2.5 (Zusatz-)Versorgung durch den Arbeitgeber
5.2.5.1 Die Sicht des Arbeitnehmers
5.2.5.2 Die Sicht des Arbeitgebers
5.2.6 Beamtenpensionen
5.3 Umlagefinanzierung
Einzelfragen einer allgemeinen Altersversorgung
6.1 Wer soll versichert werden?
6.2 Was soll versichert werden?
6.3 Nominal-Rentenhöhe
6.4 Wartezeit
6.5 Leistungsbezogenheit der Rente
6.6 Eigenleistungsarten
6.7 Eigenleistung: Geld
6.8 Eigenleistung: Kinder
6.9 Eigenleistungen während des Rentenbezuges
6.10 Organisation
6.11 Nenneintrittsalter
6.12 Rentenzuschlag, Rentenabschlag
6.13 Rentenantrag
6.14 Rentenauskunft
6.15 Mindesteintrittsalter
6.16 Lastquote und demographischer Faktor
6.17 Dynamisierung der Rente
6.18 Stichworte zu einer allgemeinen Rentenversicherung
Schlussbemerkungen
Rentenbarwert a
n
und Versicherungsmathematik
1. Einführung
Prolog
Irgendwann, lange vor unserer Zeit und der Erfindung der gesetzlichen Renten- und Pflegeversicherung, zu einer Zeit, als irgendein Tier beschloss, Mensch zu werden, da war das Problem der Versorgung ganz einfach.
Die Eltern pflegten und versorgten ihre Kinder bis sie selbständig geworden - oder gestorben - waren. Hätten die Eltern dies seinerzeit nicht getan, gäbe es keine Menschen, denn bekanntlich ist das gerade geborene kleine Menschlein für die nächsten Jahre nicht in der Lage, für sich selbst zu sorgen. - Und das ist der eine Teil des Generationenvertrages, ungeschrieben, ohne Juristen, gut, einfach und von Anfang an genau deshalb funktionierend.
Wann der erste Mensch den Einfall hatte, seine alten Eltern zu pflegen und zu versorgen, ist schon sehr viel schwieriger festzustellen. Sicher ist aber, dass es irgendwann einmal geschehen ist und sicher ist auch, dass dies kein Einzelfall war, sondern mehr oder minder zur Regel geworden ist. - Und dies ist der andere Teil des Generationenvertrages, praktiziert, lange bevor ihn irgendwelche Juristen in Gesetze gegossen haben.
Der Generationenvertrag hat also zwei Seiten: Er umfasst einerseits die Pflege und Unterstützung der Eltern und andererseits die Pflege und Unterstützung der Kinder. Wer nur eine dieser beiden Seiten, die Pflege der Alten, wahrhaben will, wird mit seinem System immer früher oder später scheitern.
Die Autoren des BGB, des Bürgerlichen Gesetzbuches, die über zwanzig Jahre daran gearbeitet haben, bis das Gesetz dann zum 01.01.1900 in Kraft getreten ist, haben bezüglich des Unterhalts sehr klare, einfache und für jeden einsehbare Normen geschaffen (§§ 1601 bis 1615 BGB):
"Verwandte in gerader Linie sind verpflichtet, einander Unterhalt zu gewähren." (§ 1601 BGB).
Kurz, knapp und klar. Bezogen auf den Unterhalt Fordernden in aufsteigender Folge also: seine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern; und in absteigender Folge: Seine Kinder und Kindeskinder. Und weiter:
"Unterhaltsberechtigt ist nur, wer außerstande ist, sich selbst zu unterhalten." (§ 1602 BGB Abs. 1 BGB).
Und das bedeutet, jeder ist zunächst für seinen Unterhalt selbst verantwortlich.
Und über die Rangfolge der Unterhaltspflichtigen sagt das Gesetz:
"Die Abkömmlinge sind vor den Verwandten der aufsteigenden Linie unterhaltspflichtig." (§ 1606 Abs. 1 BGB).
Und diese Vorschrift zeigt ganz deutlich, dass hier keineswegs, wie heute üblich, nur an den Kindesunterhalt gedacht war, sondern ganz ausdrücklich und vordringlich an die Altersversorgung.
Mit diesen einfachen drei Bestimmungen des BGB ist eigentlich das ganze Problem der Altersversorgung erschlagen. Aber selbstverständlich, es geht auch anders - und damit haben wir die Probleme.
Gesetzliche Rentenversicherung
Mit Gesetz wurde 1889 die Invaliditäts- und Altersversicherung für Arbeiter geschaffen, die jedoch nur Minimalleistungen bot. 1911 wurde eine vergleichbare Regelung für die Angestellten geschaffen. 1916 wurde die Altersgrenze von bisher 70 Jahre auf 65 Jahre herabgesetzt. 1923 wurde als Folge der Inflation, in der praktisch das gesamte Vermögen dieser Kassen verloren ging, die Finanzierung teilweise von der Kapitaldeckung auf das Umlageverfahren umgestellt. Weitere Gesetzesänderungen in den Folgejahren. Mit der Rentenreform 1957 wurden die Grundlagen für das heute noch geltende Recht gelegt. Zwanzig Jahre später Beginn des Aufbaus des Sozialgesetzbuches.
Gesetzliche Grundlage des heute geltenden Rechts ist das Sozialgesetzbuch (SGB) mit seinen Büchern. Hieraus interessiert uns vor allem das Buch SGB VI (Gesetzliche Rentenversicherung, Zusammenfügung der bisher getrennten Arbeiter- und Angestelltenrentenversicherung sowie Eingliederung der Knappschaftlichen Rentenversicherung, die allerdings mit vielen Sonderbestimmungen.
Das heutige Recht des Systems der gesetzlichen Rentenversicherung weist eine Reihe von Mängeln auf. Dies erkennt auch der Gesetzgeber und so reihen sich die Rentenreformgesetze in munterer Folge, mal (früher) die Leistungen etwas erhöhend, mal (seit Jahren) die Leistungen mindernd. Weitere Reformen mit weiteren Leistungsänderungen sind bereits absehbar.
Das Netz der sozialen Sicherheit ist in viele Rechtsvorschriften aufgesplittert, es ist daher sehr unübersichtlich. Kein Bürger kennt sich dort aus, vermutlich auch keiner der oft zitierten „Sozialexperten“.
Der von den Regelungen betroffene Personenkreis ist willkürlich bestimmt und überlappt: Während der eine durch die Maschen des Netzes fällt, wird der andere gleich von mehreren Vorschriften aufgefangen. So unklar und sich überschneidend der begünstigte Personenkreis ist, so willkürlich und sich überlappend ist der bunte Strauß der gebotenen Leistungen, die dann gegenseitig untereinander verrechnet/aufgerechnet/erstattet werden oder auch ruhen. Das Netz der sozialen Sicherheit ist kein ordentlich ausgespanntes Sicherheitsnetz, sondern ein Knäuel in sich verhedderter Fäden, Strippen, Seile, Taue und vor allem immer wieder Löcher.
In einem Punkt aber sind sich viele dieser Leistungen versprechenden Rechtsvorschriften einig: Der Leistungsbezieher darf nicht gleichzeitig arbeiten. Folge: Der Leistungsempfänger wird immer mehr an die Abhängigkeit von den Wohltaten des sozialen Netzes gewöhnt ja direkt hineingezwungen. Das Netz schafft sich so selbst seine Hilfsbedürftigen immer von Neuem selbst.
Es ist aussichtslos, ein solches Gestrüpp (an dessen Fortbestand viele egoistische Interessen hängen!), entwirren zu wollen. Man kann es nur, wenn man wohl definierte Teile davon herausschneidet und diese dann, das Fernziel einer Neukonstruktion nicht aus den Augen lassend, einzeln nach und nach reformiert. Hier also der Teil der gesetzlichen Altersversorgung.
Der Begriff „Rente“ ist nicht eindeutig. In dieser Schrift geht es um die Leibrente, also die an einen Körper, den des Versicherten, gebundene Rente. Sie wird nach heutigem Recht ab einem unterschiedlich definiertem oder gewähltem Zeitpunkt für bestimmte Zeit oder lebenslänglich gezahlt und sogar nach dem Todesfall in der Form der Hinterbliebenenrenten (abgeleitete Rente) als Witwen-/Witwerrente und Waisenrente.
Die Rente nach heutigem Recht gewährt Zusatzleistungen, zwingend zum Beispiel als Zuschuss zur Krankenversicherung oder als Kannleistung zum Beispiel als Kur und schafft damit Konkurrenz zur Krankenversicherung. Bei Kleinstrenten übersteigt der Wert dieser Zusatzleistungen bei weitem den Wert der eigentlichen Rente.
Unsere gesetzliche Rente wird auch „Sozialrente“ genannt. Aber sie umfasst nur einen Teil der Gesamtbevölkerung. Sie schließt andere aus, weil diese eine andere – teilweise bessere – Altersversorgung haben (zum Beispiel Beamtenpensionen) oder, weil sie eine andere bevorzugte vom Staat geförderte Altersversorgung bekommen. Und es werden wieder andere ausdrücklich ausgeschlossen und nicht hereingelassen, weil politische Verfechter unseres Rentensystems – aus historischen Gründen – einen „Feind“, einen „Gegner“ brauchen, denn sie wollen bestimmte Regelungen, man kann auch sagen Geschenke, an die eigene Klientel in das System auf Kosten des Staates, also der Allgemeinheit, einbauen und aufrechterhalten.
Es werden wissentlich falsche Argumente verwendet. Als die gesetzliche Rentenversicherung mit ihrem Vorläufer 1889 als Invalidenversicherung der über siebzigjährigen Arbeiter gegründet wurde, war die von privaten Versicherungen angebotene Leibrente längst bekannt und in ihren Leistungsmerkmalen definiert. Von diesen so definierten Merkmalen hat sich unser Rentensystem nie freigemacht. Es gab und gibt zwar viele darüber hinaus gehende Leistungen, aber diese werden als „versicherungsfremde Leistungen“ diffamiert, um daraus abzuleiten, dass diese versicherungsfremden Leistungen vom Staat aus Steuermitteln finanziert werden müssen, während die anderen aus den Beiträgen der Versicherten finanziert werden, was aber so in der Regel auch nicht stimmt.
Nach heutigem Recht werden die Beiträge zur Hälfte vom Versicherten, zur anderen Hälfte von dessen Arbeitgeber gezahlt – so jedenfalls das Rechtssystem nach außen. Wirtschaftlich ist diese Darstellung Unsinn, denn der Arbeitgeber als Unternehmer rechnet alle Kostenteile eines Arbeitnehmers zusammen, also Bruttolohn plus alle anderen wie immer bezeichneten Nebenleistungen, zu denen eben auch die Anteile zur Sozialversicherung gehören.
In dieser Schrift werden die Kernelemente unseres Rentensystems dargestellt und gezeigt, auf welche Elemente es ankommt und wie sich Änderungen und Manipulationen daran auswirken.
Unser Rentensystem ist über hundert Jahre alt. Seitdem sind zwei Weltkriege und zwei Inflationen über uns hinweggegangen, das Finanzierungssystem wurde vom Kapitaldeckungsverfahren auf ein Umlageverfahren umgestellt.
Soll die Neukonstruktion oder die Reformation einer gesetzlichen Altersversorgung bestand haben, dann muss sich der Konstrukteur zunächst über einige Grundlagen Klarheit verschaffen. Ein Modell kann uns dabei helfen.
Aus den einjährigen Sterbewahrscheinlichkeiten bauen wir uns eine stationäre Bevölkerung auf. Wir passen diese weiter an die besondere Verlängerung des Lebens, also die fallenden einjährigen Sterbewahrscheinlichkeiten an, versuchen dann die Geburtenzahlen zu schätzen und fügen die Wanderungsbewegung ein. Zum Abschluss dieses ersten Schritts übertragen wir die so gewonnenen Erkenntnisse auf die reale Bevölkerung und kommen so zu der uns interessierenden Bevölkerungsprognose der nächsten 50 Jahre. Fehler in diesem grundlegenden Schritt erschüttern das ganze Rentengebäude, die derzeitigen Streitereien zum Stichwort „demographischer Faktor“ zeigen dies überdeutlich.
Ausgehend von dieser Bevölkerungsprognose bestimmen wir die Alten- und Kinderlastenquoten, wobei wir die ersten Versuche mit der Bestimmung des Renteneintrittsalters machen. Und in einem Exkurs prüfen wir die Möglichkeit der Altersversorgung ohne Kinder.
Wir prüfen die Probleme der Rentendynamisierung und kommen damit zur Wahl der richtigen Bezugsgrößen und wenden uns abschließend den möglichen Finanzierungsarten und der Lasttragung zu.
Diese Fragen sollen in den folgenden Abschnitten diskutiert werden. Erst dann kann an die Konstruktion oder in unserem Fall besser die Reformation eines Rentensystems gegangen werden.
Die Rente geht alle an, die einen als zwangsweise Steuer- und Beitragszahler, die anderen als - manchmal zwangsweise – Leistungsempfänger.