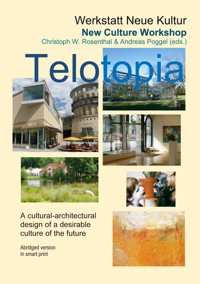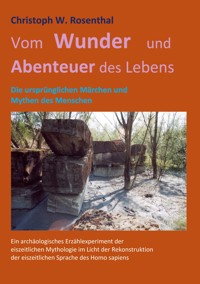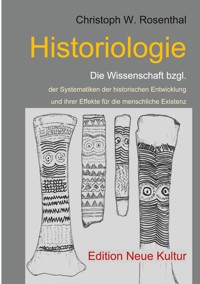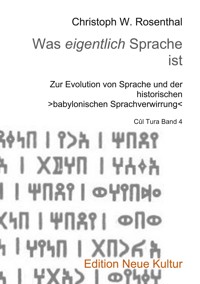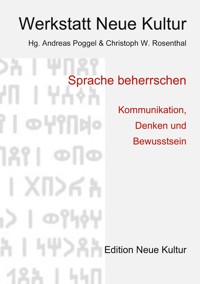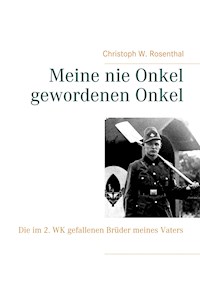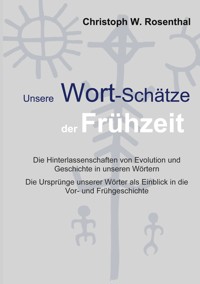
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Ursprung unseres Vokabulars erklärt sich nicht erst aus dem Indogermanischen. Bei einem Alter von rund 6.000 Jahren ist das Indogermanische wie das Deutsche wohl eine neuartige Sprach-Anlage, aber nichts absolut Neuartiges, wie es die 150 Jahre alte Vorstellung der Indogermanistik annimmt. Dass unsere Wörter auf einer älteren Sprachtradition basieren, belegt sich dadurch, dass sich etliches unseres Vokabulars auch in anderen Sprachfamilien findet, mitunter weltweit. Vor allem ermöglichte das Erforschen der Verbindungen zwischen Wörtern, Namen, Mythologien und Symbolen von den eiszeitlichen Plastiken und Höhlenmalereien an neuartige Anhalte. Da sich die Ausgangsformen unserer Wörter unterschiedlichen vor- und frühgeschichtlichen Epochen zuordnen ließen, ließ sich die Herkunft unserer Wörter und ihre ursprüngliche Bedeutung in völlig neuer Form erschließen. In umfassenderer Form stellt C.W. Rosenthal die neuen Einsichten in einem Herkunftswörterbuch dar. In diesem Buch geht es darum, diese Erkenntnisse für Einblicke in die Humanevolution, die eiszeitliche Kultur des Homo sapiens (z.B. in den Höhlenmalereien) wie in die frühgeschichtlichen Kulturen und Entwicklungen zu nutzen. Dieses Werk ist eine Fundgrube für historisch und sprachlich Interessierte!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Autor:
Christoph W. Rosenthal (Jg. 1957) hat in Wuppertal, Göttingen und Bochum Ev. Theologie und Religions-/Geschichte studiert. Er lebt seit 1981 als freier Kulturschaffender mit Jobs, Kulturarbeit, Kunst und Forschungen und veröffentlichte als Kulturologe und Historiologe etliche Bücher zu Humanevolution, Geschichte und Sprache.
www.christoph-w-rosenthal.de
Aufriss
„Ein Beispiel für die Syntax der […] Jäger in Altamira. Die Gravierungen zeigen eine Assoziation von Bilderschriftzeichen und Psychogrammen aus dem Aurignacien [Europa von 40.000 – 31.000 v. Chr.].“ 1
Die Grundlagen unseres Vokabulars liegen in der humanevolutionären Entwicklung im Vorfeld unserer Art Homo sapiens. Dies ging mit der Evolution von Kultur einher, aus der die kulturale Anlage unserer Art entstand. Auf ihr baute die Befähigung zu Selbststeuerung und sprachlicher Kommunikation auf, mit der sich – und zwar allein - der evolutionäre Unterschied zwischen Mensch und Tier verknüpft.
Im Gegensatz zu der inzwischen über 150 Jahren alten Vorstellung erklärt sich der Ursprung unseres Vokabulars nicht erst aus der Entstehung des Indogermanischen. Bei einem Alter von rund 6.000 Jahren ist das Indogermanische ebenso wie das Deutsche wohl eine neuartige Sprach-Konzeption, doch ebenso wenig wie das Deutsche etwas absolut Neuartiges, wie es die über 150 Jahre alte Vorstellung von Indogermanisch annimmt, als man die Zeit vor 6.000 Jahren noch mit der Entstehung des Menschen in Verbindung brachte. Diese Erklärung ist nach den heutigen Einsichten völlig ausgeschlossen. Ebenso wie das Deutsche basiert auch das Indogermanische auf einer älteren Sprachtradition. Dies belegt sich dadurch, dass sich etliches unseres Vokabulars auch in anderen Sprachfamilien findet, mitunter tendenziell weltweit.
Vor allem ermöglichte das Erforschen der Verbindungen zwischen Wörtern, Namen, Mythologien und Symbolen wie auch bei den eiszeitlichen Plastiken und Höhlenmalereien neuartige Anhalte. Da sich zudem die Ausgangsformen unserer Wörter aufgrund bestimmter Merkmale unterschiedlichen vor- und frühgeschichtlichen Epochen zuordnen ließen, ließ sich die Herkunft unserer Wörter und ihre ursprüngliche Bedeutung in völlig neuer Form erschließen.
In umfassenderer Form stellt C.W. Rosenthal die neuen Einsichten in die Herkunft unserer Wörter in einem Herkunftswörterbuch dar. In diesem Buch geht es darum, die etymologischen Einsichten für Einblicke in die Humanevolution, in die eiszeitliche Kultur des Homo sapiens (z.B. in den Höhlenmalereien) wie in die Frühgeschichte zu nutzen.
Der „Stier-Mensch“ in der Höhle von Fumane (Italien) min. 32.000 J. alt (GEO 2/2001, S. →)
der Minotaurus (rechts) Antike (Schefold S. →)
Minotaurus – Tauros griech. >Stier< - Taurus (=Gebirge) – Tauern usw.: die schon eiszeitliche Stier-Symbolik hat bei der Decodierung der alten Symbolik eine entscheidende Rolle gespielt.
Beispiel der paläolithischen Kultur- und Sprach-Code-Symbolik aus der Höhle von Niaux (F). Nachzeichnung aus: Emmanuel Anati: Höhlenmalerei, S. 400. Der Zusatz der Zahlen stammt von mir (CR)
„Seit Jahrtausenden hat der Geist des Menschen auf Zehntausenden von Felsoberflächen [und in Höhlen] aller Kontinente seine Spuren hinterlassen. Sie sind der sichtbare Ausdruck einer alles mitreißenden Explosion künstlerischer Kreativität. [...] Abgesehen von einigen wenigen bekannten heiligen Orten in gut zugänglichen Gebieten ist dieses Erbe weitgehend unbekannt. [...] Doch die Wiederentdeckung hat bereits begonnen. Schon jetzt können die Archive über zwanzig Millionen Darstellungen dokumentieren. [...].“ 2
1 Zitat und Nachzeichnung nach: E. Anati, Höhlenmalerei, S. 28
2 Emmanuel Anati: Höhlenmalerei, S. 9 f.
Inhaltsverzeichnis
Teil 1 Zur humanevolutionär entwickelten Sprache des Homo sapiens
1 Zur Evolution von Sprache
1.1 Zur Evolution des Gehirns
1.2 Laute und Sprache
1.3 Die neue Dimension der neurologischen Anlage des Menschen
1.4 Sprachspiele und Geschichten
1.5 Die >Mond - Mutter<-Symbolik
2 Zur humanevolutionär entwickelten Sprache HS
2.1 Die „Buchstaben-Sprache“
2.2 Zur semantischen Entwicklung der 6 Lautwurzeln
2.3 Zur urspr. Schulung von Sprache und Kultur
3 Zu der eiszeitlichen Technik der Wortbildungen
3.1 Die 6 eiszeitlichen Lautwortwurzeln
3.1.1 Die Ausgangsformen in den Sprachen der Welt
3.1.2 Sprachliche Belege zur Mond-Symbolik
3.2 Zum eiszeitlichen Symbol-System HS
4 Zum Ende der eiszeitlichen Sprache HS
Teil 2 Zur Etymologie unserer Wörter
1 Deutsche Wörter eiszeitlicher Herkunft
1.1 Ableitungen von den eiszeitlichen Lautwurzeln
1.2 Historisch modifizierte Wörter eiszeitl. Herkunft
2 Deutsche Wörter mesolithischer Herkunft
2.1 Das typische mesolithische Wortbildungs-Schema
2.2 Ableitungen von BaNa, LaNa, TaNa, KaNa
3 Deutsche Wörter aus dem Späten Mesolithikum
3.1 Bildungen der Wurzelform *
Kara
3.2 Wörter aus der Ahnen-Kult-Kultur
4 Deutsche Wörter aus dem Neolithikum
4.1 Neolithisches Vokabular auf mesolithischer Basis
4.2 Die neolithischen Wurzelerweiterung mit -R
5 Deutsche Wörter aus der Kupferzeit
Index der etymologisch erklärten Wörter
Literaturverzeichnis
Hinweis
Im Unterschied zu den runden Klammerzeichen (.) sind die eckigen Klammerzeichen […] in Zitaten Ausdruck meiner Bearbeitung [= CR]. Dies schließt auch mitunter eine Bemerkung [kursiv abgesetzt] ein. Dies wird an den Stellen nicht jeweils vermerkt.
In der Höhle Peche-Merle (F), Umriss ca. 15.000 Jahre alt, Punkte und Hände verschiedentlich hinzugefügt. - Auf dieser Abbildung ist am Kopfbereich die Technik gut zu erkennen, dass natürliche Formen aufgenommen wurden.3S. hierzu → Eid und → wissen
3 Nachzeichnung nach: Göran Burenhult: Illustrierte Geschichte der Menschheit I, S. 112 f.
Vorwort
Die Idee zu diesem Buch entstand im Verlauf meiner Arbeit an dem >ursprachlich und frühgeschichtlich orientierten Herkunftswörterbuch<. In der Frühphase dieser Arbeit ergab sich mir der Eindruck, die Worterklärungen in diesem Herkunftswörterbuch vermittelten gleichzeitig auch einen neuartigen und guten Einblick in die eiszeitliche Kultur des Homo sapiens wie in die verschiedenen frühgeschichtlichen Prozesse und Kulturen, die sprachlich und kulturell immer noch unser heutiges Fundament stellen.
Doch musste ich im weiteren Verlauf feststellen, dass mit der zunehmenden Zahl an Wort-Artikeln dieser Überblick verloren ging. Der Anspruch an ein Herkunftswörterbuch ergab einen anderen Charakter. Von daher kam ich auf die Idee, ein eigenes Werk zu schaffen, in dem die etymologischen Anhalte unserer Wörter nun ganz gezielt für Einblicke in die Evolution des Menschen, in die früheren Kulturen und die geschichtliche Entwicklung genutzt werden. Die Wörter bieten hierfür in Verbindung mit den vor- und frühgeschichtlichen Symbolen, den alten Mythologien und ihren etymologischen Zusammenhängen einen neu- und einzigartigen Zugang.
Es hat sich im Rahmen meiner vor- und frühgeschichtlichen Forschungen gezeigt, dass sich unsere Wörter nicht erst auf das in dieser Hinsicht so junge >Indogermanisch< mit einer Zeit von vor ca. 6.000 Jahren erklären. Auch geht die Indogermanistik mit ihren inzwischen über 150 Jahre alten Grundlagen völlig inadäquat von einer modernen Sprachauffassung aus, die in dieser Form überhaupt erst in der griechischen Antike aufgekommen ist. Die Kritik an der herkömmlichen Indogermanistik und ihrer etymologischen Erklärung unserer Wörter habe ich in meinen anderen Sprach-Werken näher erläutert. In diesem Buch darf man sich nicht wundern, wenn ich hier durchweg andere etymologische Erklärungen vorstelle.
Bei meinen Forschungen wurde deutlich, dass sich ein guter Teil unserer Wörter in ihren Verbindungen zu anderen Sprachfamilien auf die Anfänge ihrer historischen Entwicklung am Ende der Eiszeit zurückführen ließ und dass diese Anfänge weiterhin auf einer noch ganz andersartigen Sprach-Anlage aufbauten.
Dass sich diese ältere Sprach-Anlage der eiszeitlichen Kultur des Homo sapiens (HS) >entziffern< und rekonstruieren ließ, liegt freilich an ihrem einzigartigen Charakter. Dieser lässt sich in seiner Genialität mit unserem Dezimalsystem vergleichen, wo sich auf der Basis einiger weniger Elemente und Prinzipien jede beliebige Zahl, dort das ganze benötigte Vokabular bilden ließ.
Die eiszeitliche Sprache HS baut lautlich auf den etwa 6 grundlegenden Lautbereichen der Lallformen des Säuglings wie amma – MaMa, abba – BaBa usw. auf. Daraus wird zunächst im Sprachspiel und dann über Geschichten für die Kinder das gängige Vokabular geschaffen. Mit dem Kleinkind-Motiv der >Mond – Mutter< wird bereits der gesamte kulturelle Rahmen umfasst. Das Motiv der mythologischen Mond-Mutter war geeignet, Ideen bzgl. des >Ursprungs der Welt und des Lebens< zu vermitteln, und dabei auch, von woher die Kinder >auf die Welt kommen< und auch, wo man dereinst sein wird, „wo wir uns alle wieder sehen werden.“
Es ist erstaunlich, wie viele unserer Wörter in direkter Form dieser eiszeitlichen Konzeption entstammen. Doch auch die neuartige historische Konzeption der Wortbildungen baut, wenn auch in anderer Weise, darauf auf. Dabei werden aus diesen eiszeitlichen Grundformen nunmehr >Silben<, so etwa BaKa → Bauch, KaTa → Kate, Haus, Haut, Kutte >Mantel<, Hut, hüten usw., umgekehrt TaKa → Dach, Decke, Ziegel, Tuch, Textil usw. Entsprechende Wörter mit diesen Bedeutungen finden sich in weiter Verbreitung über die Welt.
Diese Grundprinzipien der eiszeitlichen Sprache und der historischen Sprachentwicklung werden in Teil 1 dieses Buchs – hier jedoch nur recht kurz – erklärt (für ausführliche Erläuterungen s. etwa mein Werk >Was eigentlich Sprache ist<). In Teil 2 werden sie an ausgewählten Wörtern etymologisch gezeigt.
Die aufgeführten Wort-Artikel stammen aus meinem Herkunftswörterbuch. Doch ist das hier vorliegende Werk anders als mein Herkunftswörterbuch nicht als Lexikon gedacht, wo man vor allem einzelne Wörter nachschlägt. Von daher sind die Wort-Artikel für die Konzeption dieses Buchs angepasst: mehr oder weniger vereinfacht, in Wiederholungen gekürzt und mitunter um Verweise auf weitere Wörter erweitert.
Auch geht es hier darum, die Wörter in überschaubarer Form für Einblicke in die früheren Kulturen zu nutzen. Von daher ist hier nur eine begrenzte Anzahl an ausgewählten Wörtern aufgenommen, die für diesen Zweck interessant erscheinen. Vielleicht wird es auch dem/der Leser/in so gehen, dass man zunächst gerne immer mehr wissen möchte, sich dann aber ab einem Punkt von der Masse der Wörter und Informationen ermüdet und/oder erschlagen fühlt. Hier liegt das Problem der Herkunftswörterbücher, die keinen Überblick über unser Vokabular ermöglichen – und auch selbst keinen inhaltlichen Überblick enthalten. Dabei ist ein solcher Überblick über unser Vokabular von dem Verständnis der eiszeitlichen Sprache HS sehr gut möglich. Die eiszeitliche Sprache HS zeigt wie analog unser Dezimalsystem, dass es möglich ist, sein Vokabular effizient und überschaubar anzulegen, was Sprache und Kultur auch erst wirklich steuerbar und gesellschaftlich beherrschbar macht.
Dieses Werk ist sowohl in der Auswahl der Wort-Artikel als auch in seinem Umfang darauf angelegt, dass es als eine Art Sachbuch dienen und gelesen werden kann. Für weitere Wörter kann – dann auch sehr sinnvoll - auf das Herkunftswörterbuch oder auf Cûl Tura Band 2 bzw. eine der beiden unterschiedlich umfassenden Kurzfassungen von Cûl Tura zurückgegriffen werden.
Eine sinnvolle Ergänzung bietet auch mein Werk >Vom Wunder und Abenteuer des Lebens<, wo die unserem Vokabular ursprünglich zugrunde liegenden Märchen und Mythen in ihrer Struktur in erzählter Form rekonstruiert werden. Andere Aspekte der Evolution von Sprache und der historischen Sprach-Entwicklung behandele ich in meinen anderen Büchern zu Sprache, Evolution und Geschichte.
Die Wörter werden hier nicht in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt, sondern nach ihren Informationen und den jeweiligen kulturgeschichtlichen Phasen zugeordnet. Ein alphabetischer Überblick über die aufgenommenen Wort-Artikel findet sich in dem Index.
Von den hier vorliegenden Einsichten bietet die Etymologie unserer Wörter Einblicke in das Denken früherer Kulturen und über kulturgeschichtliche Entwicklungen, die in manchem ausschließlich über den Weg der etymologischen Forschung zu erhalten sind. Entsprechendes gilt auch für die Beziehungen der frühgeschichtlichen Kulturen. Es zeigt sich, dass die sprachlichkulturellen (auch weltanschaulichen) und die technologisch-materiellen Komponenten auf keinen Fall gleichgesetzt werden können – ein Fehlschluss etlicher archäologischer Annahmen.
Gleichzeitig bieten die etymologischen Ergebnisse auch neue Einblicke über unsere eigene Geschichte, Kultur und die Grundlagen unseres Denkens und unserer Kommunikation. Aus diesen Gründen fand ich als Historiologe und Kulturologe die etymologische Arbeit spannend und von Bedeutung.
Christoph W. Rosenthal
PS. Die Veröffentlichung des Herkunftswörterbuchs wird sich noch etwas verzögern, da ich bei der Arbeit an dem hier vorliegenden Buch dort noch einigen Bedarf an Überarbeitungen festgestellt habe.
Teil 1
Zur humanevolutionär entwickelten Sprache des Homo sapiens
„Venus“ von Laussel (F), Relief Alter ca. 25.000 Jahre
S. dazu mehr in: Wikipedia: Venus von Laussel
Die zentrale Darstellung der Höhle von Lascaux (F) 4
Vgl. hierzu auch die Darstellung in der Ural-Höhle → S. →
„Unter zahlreichen traditionellen Völkern unserer Tage, einschließlich der australischen Aborigines und der südafrikanischen Buschleute, besitzen die Höhlenbilder einen direkten Bezug zu diesen Pubertätsriten. Beinahe immer dienen diese Riten auch dazu, Kenntnisse [… seiner Kultur] zu vermitteln. Tiere spielen in der Mythologie der meisten traditionellen Völker [...] eine entscheidende Rolle, und häufig dienen sie zugleich als Symbole der Geschlechtlichkeit und der Fruchtbarkeit.“5
Im eiszeitlichen Kontext geht es jedoch nicht um einen Fruchtbarkeits-Kult, sondern um die Aufklärung, dass Geschlechtsverkehr Folgen haben kann.
4 Nachzeichnung. S. dazu Fotos z.B. in: Mario Ruspoli: Die Höhlenmalerei von Lascaux, insbesondere S. 149
5 in: Göran Burenhult: Illustrierte Geschichte der Menschheit I, S. 116
2 Zur humanevolutionär entwickelten Sprache des Homo sapiens
(bis zum Ende der Eiszeit)
Mit einer wohl dem Sinn der paläolithischen „Venus“-Figuren entsprechenden Felsmalerei beginnt bei den Ngarinyin-Aborigines der dulwan nimindi (>Pfad des Wissens<) mit einer Personifikation von Jillinya, der >mother of all<, deren Hände Gruß bedeuten. Es formuliert ihr Kulturkonzept vom Leben als Bewusstseins- und Persönlichkeits-Entwicklung (Jeff Doring: Gwion Gwion, S. 36 ff., die direktesten Bilder S. 44 und 45)
Die Nachzeichnung ist ein Ausschnitt aus einem erheblich komplexeren Felsbild und der >Pfad< aus graphischen Gründen auf etwa die Hälfte verkürzt gezeichnet. Im Original ist die Farbe sehr verblasst, und die Konturen sind von dem nicht ganz ebenen Felsuntergrund beeinflusst.
Auf die Gegebenheiten der humanevolutionär entwickelten Sprache des Homo sapiens (HS) stieß ich bei einer Auseinandersetzung mit der eiszeitlichen und frühgeschichtlichen Symbolik in Verbindung mit einer etymologischen Forschung.
Denn es wurde für mich auffällig, dass sich – anders als es die gängige Etymologie sieht – vielfach Bezüge zwischen Wortformen andeuteten, die unserer Art zu denken nicht entsprachen, sehr wohl aber den alten Symboliken und Mythologien. So finden sich etwa unsere Wörter STier (= taurus, toro) – Kuh entsprechend der alten Symbolik parallel in Taurus (-Gebirge), Tauern – persisch kuh >Berg< usw. Dass diese Entsprechungen von Stier/Kuh und Berg kein Zufall waren, sollte sich in dem Gesamtbefund erweisen. Es ergab sich hierbei insgesamt das eindeutige Ergebnis, dass die Wortbildungen Ableitungen der alten Symboliken und mythologischen Geschichten waren – nicht umgekehrt. Dies zeigte sich als System.
Dass die eiszeitliche Sprache HS am Ende der Eiszeit von einer neuen historischen Sprach-Entwicklung abgelöst wurde, erklärt sich nicht aus einer Primitivität der eiszeitlichen Sprache HS. Im Gegenteil, ihre Anlage erwies sich überaus genial. Sie ist an sich