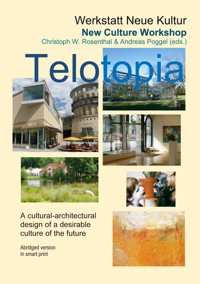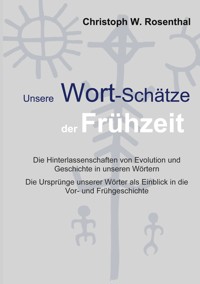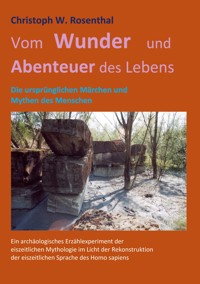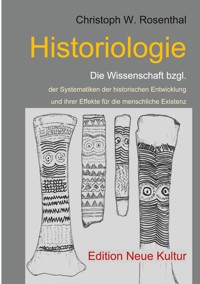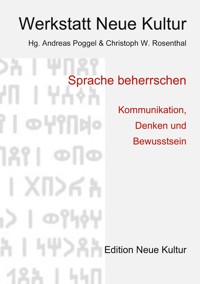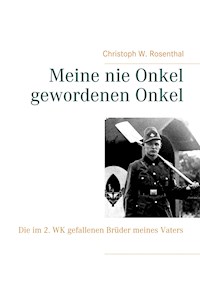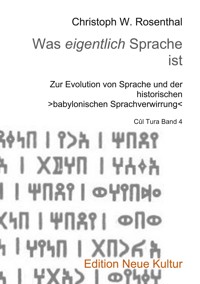
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Wittgenstein sagt, dass Probleme entstehen, weil wir die Arbeitsweise unserer Sprache missverstehen. Er sagt, wir seien von der Sprache >verhext<, und manchmal hätten wir einen >Drang<, sie misszuverstehen." (A.C. Grayling) Die evolutionär neuartige Dimension des Menschen begründete sich in Sprache. Mit ihr wurde eine aktive, selbst bestimmte und bewusste Gestaltung des Lebens und in Verbindung mit Kommunikation ein fähiges Sozial- und Beziehungs-Leben möglich. Doch lässt sich Sprache nicht schon in Vokabular und Grammatik verstehen. Dies ist nur die Form, in der wir Sprache handhaben. Leider kam es am Ende der Eiszeit aufgrund gigantischer Naturkatastrophen zu einem Verlust an Sprache sowie an Beherrschung von Sprache und Kommunikation. Daraus resultierte, wie auch Wittgenstein andeutet, eine wahrhaft >babylonische Sprachverwirrung< mit Tausenden von Sprachen. Der eigentlich entscheidende Bereich von Sprache wurde nicht mehr als Sprache begriffen und fiel Ideologien, Weltanschauungen und magizistischen Vorstellungen aller Art anheim. In all dem ist eine entscheidende Ursache für das Aufkommen der historischen Probleme wie Diktaturen, Absolutismus, Streitereien und Gewalt bis heute zu sehen. Neue Erkenntnisse aus Neurologie, Linguistik, Historiologie usw. bieten Aufschluss über diese Probleme sowie Ansätze für deren Überwindung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christoph W. Rosenthal (Jg. 1957) lebt seit 1981 als freier Kulturschaffender mit Jobs, Kulturarbeit, Kunst und Forschungen. Nach langjährigen Forschungsarbeiten begann er 2018 mit etlichen Veröffentlichungen zu Humanevolution, Geschichte und Sprache.
www.christoph-w-rosenthal.de
Mitarbeiter der
Werkstatt Neue Kultur
Projekt- und Bildungs-Werkstatt für eine neue Kultur
Die Werkstatt Neue Kultur arbeitet u.a. zu dem Bereich Kommunikation und Sprache und bietet hierzu auch Veranstaltungen und Kurse an.
www.werkstatt-neue-kultur.net
Aufriss
„Wittgenstein sagt, dass Probleme entstehen, weil wir die Arbeitsweise unserer Sprache missverstehen. Er sagt, wir seien von der Sprache >verhext<, und manchmal hätten wir einen >Drang<, sie misszuverstehen.“1
„90 Prozent der Zeit reden Menschen aneinander vorbei.“ 2
Dabei begründete sich die evolutionär neuartige Dimension des Menschen durch Sprache. Mit ihr wurde eine aktive, selbst bestimmte und bewusste Gestaltung des Lebens und in Verbindung mit Kommunikation ein fähiges Sozial- und Beziehungs-Leben möglich.
Doch lässt sich Sprache insgesamt nicht schon in Vokabular und Grammatik verstehen. Dies gilt nur für den evolutionär älteren Bereich von Sprache vor der Humanevolution, der mit Dienstleistung und Produktion verbunden ist. Ansonsten ist dies in der neurologischen Anlage von uns Homo sapiens lediglich die Form, Sprache zu handhaben. In Bezug auf das Eigentliche von Sprache besteht in unserer Kultur keine Klarheit mehr. Daraus entstanden und entstehen die vielen fundamentalen Missverständnisse, Verwirrungen und Entgleisungen, worauf Wittgenstein aufmerksam macht, wie auch die kommunikativen und entsprechenden Beziehungs- und sozialen Probleme.
Der Ursprung dieser wahrhaft >babylonischen Sprachverwirrung<, der zu solchen Problematiken und zu Tausenden von Sprachen führte, liegt in den Chaos- und Notstandsproblemen am Ende der Eiszeit, die durch gigantische Naturkatastrophen hervorgerufen wurden (z.B. durch die >Sintflut< des Anstiegs des Meeresspiegels um ca. 120 m, der u.a. auch „die Hälfte Westeuropas“ untergehen ließ 3).
Man fand hier über etliche Generationen keine Zeit, zureichend Kommunikation und Sprache beherrschen zu lernen. Hierbei gingen entscheidende Bereiche an Sprache verloren, und es kam zu sprachlichen Missverständnissen, dass aus Geist wahrhaft Gespenstisches wurde. Hierin liegt eine entscheidende Ursache für das Aufkommen der historischen Probleme wie Diktaturen, Disflikte und Gewalt und den gesellschaftlichen Zusammenbrüchen.
Neue Erkenntnisse aus Neurologie, Linguistik, Historiologie usw. bieten Aufschluss über diese Probleme sowie Ansätze für deren Überwindung. Mit ihrer Umsetzung wird genau wie in der humanevolutionären Entwicklung wieder ein fähiges Beziehungs- und Sozial-Leben in echter Lebens-Qualität und Freiheit möglich.
1 A.C. Grayling: Wittgenstein. S. 148
2 Aljoscha Long & Ronald Schweppe: Praxisbuch NLP, S. 178
3 David Hurst Thomas, in: Göran Burenhult: Illustrierte Geschichte der Menschheit II, S. 11
Inhaltsverzeichnis
I Zur Evolution von Sprache
1 Zur Evolution des Gehirns
1.1 Zu der Struktur des menschlichen Gehirns
1.2 Das Zwischenhirn – der Ort der Verhaltens-Programme
1.3 Der Großhirn-Sektor (Neokortex)
1.4 Zur Evolution der Primaten
2 Zur evolutionären Entstehung der Sprache
2.1 Laute und Wörter
2.2 Die neuen neurologischen Strukturen
2.3 Zur Evolution der Hominiden
2.4 Zu den angeborenen Grundlagen der menschlichen Sprachlichkeit
3 Zur humanevolutionären Entwicklung
3.2 >Vom Ursprung der Kultur im Spiel<
3.1 Der neurologisch unreifere Nachwuchs
3.3 Das Scheitern der Hominiden
3.4 Zu dem tatsächlichen Hintergrund der humanevolutionären Entwicklung
II Zur humanevolutionären Weiterentwicklung von Sprache
4 Die neue Dimension der neurologischen Anlage des Menschen
4.1 Der Dammbruch
4.2 Sprachspiele und Geschichten
4.3 Sprache und Selbststeuerung
4.4 Zur Bedeutung von Mythologie im urspr. Sinn
4.4.1 Das Motiv der >Mond-Mutter<
4.4.2 Zu dem Befund der Mond-Mythologie
4.4.3 Sprachliche Belege zur Mond-Symbolik
4.4.4 Ein Hinweis zur Entzifferung der eiszeitlichen Sprache des Homo sapiens
4.5 Zur urspr. Schulung von Sprache und Kultur
5 Zur eiszeitlichen Sprache des Homo sapiens (HS)
5.1 Die „Buchstaben-Sprache“
5.2 Die Entsprechung zur kindlichen Entwicklung
5.3 Zur Technik der urspr. Sprache des Homo sapiens
5.3.1 Die 6 Lautwortwurzeln
5.3.2 Zur semantischen Entwicklung der Lautwurzeln
5.4 Zum ursprachlichen Symbol-System HS
6 Zur historisch neuen Sprach-Entwicklung
6.1 Zur Entstehung der historischen Entwicklung
6.1.1 Die Mesolithische Revolution
6.2 Zur Entstehung der historischen neuen Sprachform
6.3 Zu Mebuntu und der Verbreitung der historisch neuen Sprachform
III Zur >babylonischen Sprachverwirrung< und ihrer Auflösung
7 Zur >babylonischen Sprachverwirrung<
7.1 Die Entstehung Tausender Sprachen
7.2 Mythologie, Weltanschauung und Religion
7.2.1 Das Aufkommen der Geister-Kulte
7.2.2 Das magizistische Denken
7.3 Ideologie, Wörter und Grammatik
7.3.1 Ideologie und Wörter
7.3.2 Grammatik
7.3.2.1 Das grammatische Geschlecht
7.3.2.2 Das Stammformen-System
7.3.2.3 Zum Subjekt – Objekt-Schema
7.4 Zur herkömmlichen Etymologie
8 Zur Auflösung der >babylonischen Sprachverwirrung<
8.1 Zur Wiederentwicklung von Sprache
8.2 Die beiden Hemisphären (Gehirnhälften)
8.3 Zum Frontalhirn als dem Ort der Selbst-Steuerung
8.4 Kommunikation
8.5 Zur Aneignung der inneren Wortmaschine
8.6 Abschluss und Ausblick
Literatur
Ein codierter Text
Vorwort
Gerade auch wenn die hier angesprochene Thematik in unserer Gesellschaft kaum an ein entsprechendes Bewusstsein anknüpfen kann, so ist sie mir gerade deswegen ein besonderes Anliegen. Wenn man erstmal einen Zugang zu ihr gefunden hat, sieht man, dass hier ein Ursprung der meisten Probleme unserer Gesellschaft liegen – die sich mit einem Verstehen dieser Thematik effektiv lösen lassen.
Die Aussagen Wittgensteins sind keineswegs überzogen. Doch da diese Problematiken allgemein verbreitet sind, nimmt man sie für >normal<. Wohl bemerkt man, dass die Kommunikation und auch das Sozialleben häufig nicht wie erwünscht funktioniert, aber man kommt zumeist nicht auf den Gedanken, dass es tiefere Gründe haben könnte, dass es so auch kaum funktionieren kann. Dies liegt keineswegs >am Menschen<. Denn gerade der Mensch ist an sich das kommunikative Wesen par excellence, und das wirkliche Beherrschen von Sprache befähigte ihn über Jahrzehntausende zu einem fähigen Sozial- und Beziehungs-Leben in guter Lebens-Qualität - bis es am Ende der Eiszeit zu der wahrhaft >babylonischen Sprachverwirrung< kam, die noch immer kultiviert wird.
Die erste Fassung dieses Werks entstand im Sommer 2010, nachdem ich im Rahmen meiner kulturgeschichtlichen Forschungen endlich dazu kam, mich speziell mit dem Bereich Sprache und Etymologie zu befassen.
Schon 2003 war ich bei meiner Studie >Frau Holle und der Drache von Lascaux< bzgl. der mindestens 40.000 Jahre zurückreichenden Venus-Figuren und der weltweit verbreiteten Stier-, Kuh- bzw. Drachen-Symbolik auf wichtige sprachliche Zusammenhänge gestoßen, die vielfältige Aufschlüsse ermöglichten.
Doch musste ich dabei feststellen, dass meine Ergebnisse auf etwas anderes hinausliefen, als die gängige Etymologie des Deutschen und ihre Auffassung von Sprache und unserer Sprachgeschichte vertraten. Dieser Eindruck verstärkte sich bei meinen etymologischen Studien ab 2010. Das brachte mich im Sommer 2010 dahin, bei meinen etymologischen Studien immer auch die Dimensionen der Evolution von Sprache – Neurologie und der sprachgeschichtlichen Entwicklung mit einzubeziehen.
Ein Teil der damaligen Fassung ging in den ersten Band meines sprachgeschichtlichen und etymologischen Werks Cûl Tura ein. Doch angesichts der bereits entstandenen Menge an Stoff wollte ich das dortige Werk nicht auch noch mit der hier angesprochenen Thematik befrachten. Insofern entstand der Gedanke, dazu ein eigenes Werk zu erarbeiten.
Allerdings stellte ich hierbei erneut fest, dass es dazu noch viele weiteren Aspekte und Beiträge gibt. So kam ich im Frühjahr 2022 dahin, mich auf den zentralen Bereich dieser Thematik zu konzentrieren und zu beschränken – und hierbei auch etliche Punkte recht kurz zu halten. Theorien zur Sprachphilosophie usw. werden hier nicht explizit diskutiert. Doch werden neuere Einsichten zu Humanevolution, Neurologie und Geschichte aufgenommen, soweit sie hier von Bedeutung sind.
Die Abhandlung des zentralen Bereichs ist, wie man vielleicht selbst sehen wird, genug Aufgabe für sich. Selbst einzelne Punkte hiervon sind für die Zukunft noch eine eigene Aufgabe. Doch dafür werden hier schon mal eine Grundlage und ein Rahmen angelegt.
Ich selbst bin auf jeden Fall der Auffassung, dass die dargestellten Erkenntnisse von einiger Bedeutung sind, die sozial so fatalen Probleme der immer noch bestehenden >babylonischen Sprachverwirrung< zu klären, so dass sie gelöst werden können.
CR
Hinweis
Im Unterschied zu den runden Klammerzeichen (.) sind die eckigen Klammerzeichen […] in Zitaten Ausdruck meiner Bearbeitung [= CR]. Dies schließt auch mitunter eine Bemerkung [kursiv abgesetzt] ein. Dies wird an den Stellen nicht jeweils vermerkt.
Aurignacien, Europa, ca. 40.000 – 30.000 v. Chr.
„Ein Beispiel für die Syntax der […] Jäger in Altamira. Die Gravierungen zeigen eine Assoziation von Bilderschriftzeichen und Psychogrammen aus dem Aurignacien.“ 4
4 Zitat u. Vorlage der Nachzeichnung nach: E. Anati: Höhlenmalerei, S. 28
oben: Spiel mit Schriftzeichen (ohne Inhalt)
Teil I
Zur Evolution von Sprache
„Die Sprache ist in engster Weise mit den allgemeinen kognitiven Fähigkeiten des Menschen verbunden, und die Entstehungsgeschichte der Sprache ist zugleich auch ein Teil der5Entstehungsgeschichte des Menschen.“
Anders als bis in die Wissenschaften hinein noch immer gemeint wird, erklärt sich die Evolution von Sprache nicht eigentlich aus der Entwicklung von Kommunikation und entsprechend nicht aus dem Schritt einer Ausdifferenzierung von Lauten zu Wörtern. Sie steht zunächst vielmehr mit bestimmten neurologischen Gehirn-Entwicklungen in Verbindung.
Dies gilt auch für die beiden unterschiedlichen Dimensionen von Sprache bei uns Homo sapiens. Sie verknüpfen sich mit Verbindungen zu zwei höchst unterschiedlichen Gehirnbereichen, zu denen es in zwei sehr verschiedenen evolutionären Stufen kam.
Da dies mit entscheidenden Konsequenzen für das Verstehen von Kommunikation und dem, was eigentlich Sprache und eine wirkliche Beherrschung von Sprache ist – was bei uns gemeinhin nicht richtig bzw. deutlich im Blick ist –, soll hier zunächst kurz auf die Evolution unseres Gehirns eingegangen werden.
5 Horst M. Müller: Sprache und Evolution, S. 74
1 Zur Evolution des Gehirns
Die Entstehung und Entwicklung von Sprache stehen mit bestimmten Entwicklungen des Gehirns in Verbindung. Hierbei gibt es unterschiedliche Stufen und Ebenen, die in Bezug auf Sprache eine Rolle spielen.
Das Gehirn selbst entstand aus einer evolutionären Weiterentwicklung der Nervenbahnen, die ihrerseits bei der Evolution der Mehrzeller aus der Spezialisierung der Zellen aufkamen. Zu der Entwicklung des Nervensystems lässt sich etwa sagen:
„Die erste Stufe [der Entwicklung des Nervensystems] ist ein einfaches >Nervennetz<. Die bloße Form seines Musters zeigt, dass es hier keine Hierarchie geben kann, sondern nur >Gleichschaltung<. Ein symmetrischer Schaltplan schließt die Möglichkeit von Aktionen aus, die einen unterschiedlichen Einsatz verschiedener Teile des Organismus erfordern. […]
Schon bei den Würmern [Abb. rechts] sieht die Sache anders aus. Das typische >Strickleitersystem< ist in seiner bilateralen Symmetrie und der ständigen Wiederholung der gleichen Schaltelemente zwar auch nicht mehr als die Widerspiegelung des ebenso monotonen Baus seines Trägers, also etwa des Regenwurms. Aber hier gibt es am vorderen Ende doch schon eine kleine Ansammlung von Ganglienzellen: […] die erste, noch knospenartige Andeutung einer übergeordneten Zentrale und damit die erste Chance eines, wenn auch noch primitiven Programms.“ 6
Der evolutionäre Ursprung des Gehirns entstand als eine neue Form in der Koordination des Nervensystems, die sowohl eine komplexere körperliche Anlage als auch eine komplexere Lebensform ermöglichte.
Hierbei wurde das Gehirn selbst zu einem Organ, das in dieser Koordination auch selbst für bestimmte körperliche Aufgaben zuständig wurde.
Eine dieser Aufgaben, die insbesondere beim Menschen und in Hinsicht auf die Evolution von Sprache von Bedeutung werden sollte, ergibt sich aus dem folgenden Zitat:
„Man bringt einem Tier bei, eine ihm gezeigte farbige Karte mit einer bevorstehenden Fütterung zu assoziieren. Erwartungsgemäß hängt die Dauer der Erinnerung mit der Größe des Gehirns zusammen. Wenn zwischen dem Zeigen der Karte und der Fütterung mehr als zehn Sekunden vergehen, vergessen Goldfische die Bedeutung des Signals, während Tauben und Eidechsen sich zwei bis drei Minuten lang erinnern können und Paviane sogar bis zu einer halben Stunde danach noch die Fütterung erwarten.“ 7
6 Ditfurth: Der Geist fiel nicht vom Himmel, S. 77 f. Nachzeichnung ebd.
7 John McCrone: Als der Affe sprechen lernte, S. 96
1.1 Zu der Struktur des menschlichen Gehirns
Im Verlauf der weiteren Evolution bildeten sich verschiedene Strukturen im Gehirn heraus. Hierbei gibt es im menschlichen Gehirn drei Grundstrukturen, von denen zwei in Hinsicht auf Sprache eine besondere Rolle spielen.
Zum Großhirn oder Neokortex (grau markiert)
Frosch
Hund
Schimpanse
Homo sapiens
Nachzeichnung nach: Hoimar v. Ditfurth: Der Geist fiel nicht vom Himmel, 7. Farbblatt nach S. 224
Dieses Buch bietet eine gut lesbare ausführliche Abhandlung über „Die Evolution unseres Bewusstseins“ (so der Untertitel), wenn es auch nicht mehr in allem aktuell ist.
Nach einer interessanten Theorie sind in dem menschlichen Gehirn drei evolutionäre Hauptetappen repräsentiert:
Menschliches Gehirn mit den drei grundlegenden evolutionären Stufen:
1 >unterer Hirnstamm< (schwarz),
2 >Zwischenhirn< (oder „Reptiliengehirn“, dunkelgrau)
3 >Großhirn< oder (Neo-) Kortex (hellgrau)
Nachzeichnung nach: Hoimar v. Ditfurth: Der Geist, S. 18 f., 84 f., 226 f.
Aus der evolutionären Entwicklung zu komplexeren Nervenstrukturen erwächst zunächst der >untere Hirnstamm< (1) als Form der Koordination der Nervenstrukturen. Bis zu dieser Ebene kann das Lebewesen allein auf Reize reagieren, die unmittelbar den Organismus berühren.
In Verbindung mit der evolutionären Entwicklung der höheren Sinnes-Organe wie z.B. der Augen und Ohren kommt es zu einer Weiterentwicklung des >unteren Hirnstamms< zu dem so genannten >Reptiliengehirn<, da diese Gehirnanlage in der Evolution im Besonderen von den Reptilien repräsentiert wird. Aus der menschlichen Perspektive wird hierbei von >Zwischenhirn< gesprochen. Mit ihm können Gerüche und optische und akustische Signale über die evolutionäre Entwicklung von >Nasen<, >Augen< und >Ohren< für Verhaltens-Reaktionen erschlossen werden.
Zu der Ebene des >unteren Hirnstamms< gehören die Empfindungen im Mund und, dass wir nervlich negativ auf Rauchgase, Berührung von Feuer usw. reagieren. Demgegenüber ermöglicht das >Zwischenhirn<, akustische und optische Anhalte auch aus Entfernung zur Erkennung von Erwünschtem wie Nahrung, Geschlechtspartnern oder von Unerwünschtem und Gefahren wie Feinden zu nutzen und mit einem entsprechenden Verhalten darauf zu reagieren. Dies geht evolutionär mit der Entwicklung neuer neurologischer Strukturen im Körper und der entscheidenden >Schaltzentrale< im Gehirn einher.
In der weiteren evolutionären Entwicklung einer jeweiligen Art werden diese als >Zwischenhirn< angelegten Nervenstrukturen als Ausdruck der erfolgreichen Verhaltensformen ganz entsprechend anderer körperlichen Entwicklungen in der genetischen Anlage vererbt. Hiermit verknüpft sich der Schritt von den >Reflexen< auf der Stufe des >unteren Hirnstamms< zu den >Instinkten< als den neurologischen Strukturen im Kontext des Zwischenhirns.
1.2 Das Zwischenhirn – der Ort der Verhaltens-Programme
In der weiteren Evolution des Gehirns kommt es nach dem >Reptiliengehirn< zu der Stufe des „Großhirns“ oder >Neokortex<. In dieser Art ist auch unser menschliches Gehirn angelegt. Diese Entwicklung hat ihre Gründe. Doch ist es eine falsche Annahme, dass diese Weiterentwicklung per se mit einer höheren Intelligenz verbunden wäre.
Tatsächlich kam der große evolutionäre Erfolg lange dem >Reptiliengehirn< mit seiner angeborenen Intelligenz zu, in dem die erfolgreichen Verhaltensformen ganz entsprechend anderer körperlichen Entwicklungen in der genetischen Anlage vererbt wurden.
„Der Vorteil dieser Situation besteht darin, dass allen Anforderungen und Aufgaben mit Verhaltensrezepten begegnet werden kann, die nicht bloß von einem einzelnen, sondern von den unzähligen Mitgliedern Hunderter und Tausender von Generationen der eigenen Art auf ihre Brauchbarkeit durchprobiert worden sind.“ (Ditfurth: Der Geist, S. 191)
Als diese Verhaltensprogramme lassen sich insgesamt „Futter- oder Beutesuche, Körperpflege und Verteidigungsreaktionen, den sexuellen Verhaltensbereich und die Brutpflege“ sowie die >Rekreation< (Ruhen/Schlafen) ausmachen, „wobei bei einzelnen Arten noch spezielle Leistungen – Beispiel: Zugvogelorientierung – hinzukommen mögen.“ (Ditfurth: Der Geist, S. 143). Die Anzahl der eigentlichen >Verhaltensprogramme< ist also durchaus sehr begrenzt.
Die genetisch mit den Nervenstrukturen vererbte >Erfahrung< ersparte dem Nachwuchs lange Sozialisations-Entwicklungen. Denn mit ihr war die große Gefahr verbunden, mangels hinreichender Erfahrung leicht zum Opfer zu werden. Hingegen >weiß< eine frisch aus dem Ei geschlüpfte Wasserschildkröte auf Anhieb ins Meer zu laufen, dort zu schwimmen und sich ernähren. Das Wachstum der Zwischenhirn-Tiere zur Erwachsenen-Stufe ist wesentlich ein rein körperlicher Prozess (Körpergröße) und vollzieht sich von daher erheblich schneller als bei den Großhirn-Wesen.
In den großen Zeiträumen der Geschichte unseres Planeten war bis zu dem Ende der Dinosaurier die Zwischenhirn-Anlage in der Fauna die erfolgreichste Form. Die erheblich aufwendigere Großhirn-Anlage vermochte sich bis dahin lediglich in kleinen Restbeständen der Natur zu behaupten, für die die Zwischenhirn-Gesamtanlage zu unkomplex war.
Evolutionär hatte die Zwischenhirn-Gesamtanlage nur ein einziges grundsätzliches Problem, das vor allem bei den geologischen Umbrüchen von Konsequenz wurde:
„[…] die tödliche Gefahr dieser gleichen Situation ergibt sich daraus, dass diese so überaus sorgfältig getesteten Rezepte [der genetischen Verhaltenssteuerung im Zwischenhirn] in dem gleichen Augenblick wertlos werden, in dem sich die Umweltbedingungen ändern, auf die sie mit solcher Sorgfalt – und dem entsprechenden Zeitaufwand – zugeschnitten worden sind. Für dieses doppelte Gesicht der vom Instinkt bewirkten Einordnung in die Umwelt gibt es eine ganze Reihe zum Teil dramatischer Beispiele. […].“ 8
„Ein Lebewesen, das über das Niveau des reinen Zwischenhirndaseins hinausgelangt und damit des individuellen Sammelns von Erfahrungen fähig geworden ist – wir nennen das gewöhnlich >lernen< -, kann unter Umständen innerhalb von Sekunden aus einer einzigen Erfahrung anpassende Konsequenzen für sein zukünftiges Verhalten ziehen. Die Art dagegen lernt innerhalb von Zeiträumen, die sich nach Jahrzehntausenden bemessen.“ 9
8 Hoimar v. Ditfurth: Der Geist, S. 191
9 Hoimar v. Ditfurth: Der Geist, S. 146
1.3 Der Großhirn-Sektor
Aufgrund dieser Grenzen der Zwischenhirn-Fähigkeiten kam es schon in hohen Zeiten zu einer Erweiterung des Gehirn-Bereichs: dem Neokortex, auch Großhirn genannt. Mit dieser Entwicklung verbindet sich die Sozialisations-Anlage der Lern-Entwicklung. Wir sehen also, dass die Großhirn-Evolution sowohl ihre Gründe als auch ihre höchst bedeutsamen Vorteile hat.
Doch wäre es naiv zu meinen: je mehr Großhirn (und je mehr Sprache), desto schlauer und überlebensfähiger. Dies ist eine Auffassung, die effektiv aus vorwissenschaftlichen Vorstellungen stammt.
Denn mit der Neokortex-Anlage verknüpfen sich eine bedeutsame Verlängerung der Kindheit und damit entsprechend höhere Anforderungen in der Nachwuchs-Aufzucht, und dies umso mehr, je höher der Anteil des Großhirns im Gehirn liegt.
Schon der darin erkennbare Gegensatz zu der Zwischenhirn-Entwicklung deutet darauf, dass die Entwicklung des Neokortex aus evolutionären Krisen entstand, wohl insbesondere in geologischen Umbrüchen. Ging der evolutionäre Trend der Zwischenhirn-Entwicklung dahin, möglichst viel an Erfahrung in der Zwischenhirn- und Nerven-Anlage genetisch zu verankern und also die recht prekäre Phase der kindlichen Entwicklung so kurz wie möglich zu halten, so kehrte die Großhirn-Evolution dies um. Je höher der Anteil des Neokortex im Gehirn liegt, desto länger dauern die Kindheiten zu dem Zwecke eigener Erfahrungen.
Die Großhirn-Anlage bedeutet also gerade nicht, mit mehr Intelligenz geboren zu werden. Das Gegenteil ist gegenüber der Zwischenhirn-Anlage der Fall: die Nervenstrukturen sind zunächst noch unreif und reifen als >Sozialisations-Prägung< verzögert bis zur Geschlechtsreife.
Diese Anlage hat ihre großen Vorteile, aber ebenso ihre großen Anforderungen, Nachteile und Gefahren. Ob diese Anlage zum Vorteil wird, hängt hier, je höher der Neokortex-Anteil im Gehirn liegt, desto stärker an der Qualität der Sozialisations-Verhältnisse.
Auf keinen Fall kann die Großhirn-Evolution per se mit der Entwicklung von Intelligenz gleichgesetzt werden. Sie stellt nicht bloß weniger ererbte Intelligenz als die reine Zwischenhirn-Anlage zur Verfügung. Sie kann bei ungünstigen Sozialverhältnissen sehr wohl auch sehr ungünstige Lern-Entwicklungen zur Folge haben. Auch Dummheit, abstruse Weltbilder, aggressives Konkurrenz-Verhalten bis zu Barbareien können gelernt werden. Tatsächlich sind hier in der Evolution effektive Probleme entstanden, gerade auch in dem Vorfeld der humanevolutionären Entwicklung. Wie wir noch sehen werden, war die Evolution von Sprache und technischer Intelligenz nicht schon an sich die Lösung.
Zunächst aber bedeutet die Großhirn-Evolution nichts anderes, als dass hier Zwischenhirn-Funktionen von angeborenen >Instinkten< in Form von >Prägungen< auf Phasen in der Kindheit verlagert werden. So wurde mit entsprechenden Tier-Experimenten
„eine Art der Verschränkung von Instinkt und Lernfähigkeit nachgewiesen, von der man bis dahin noch nichts gewusst hatte. Den Buchfinken war, anders ließ sich das Resultat nicht deuten, die Fähigkeit angeboren, etwas ganz Bestimmtes lernen zu können. […] Diese sehr erstaunliche angeborene Fähigkeit zu selektivem Lernen ist inzwischen bei vielen verschiedenen Arten in Bezug auf ganz verschiedene Leistungen nachgewiesen und gesichert.“ 10
10 Hoimar v. Ditfurth: Der Geist, S. 198
1.4 Zur Evolution der Primaten
„Das erste Lebewesen, dessen Großhirn alle älteren Hirnteile in der Entwicklung überflügelt hat, ist der Affe.“11
Es waren vor allem die Säugetiere, die auf die Dauer aus ihrer Großhirn-Anlage einen Nutzen zu ziehen verstanden. Mit dem Säugen und einer oft noch weiteren Betreuung in der Kindheit konnte die Lern-Entwicklung in einem guten Maß gesichert werden.
Innerhalb der Säugetiere sind die Primaten im Besonderen mit den Nagetieren verwandt, und die frühen Primaten ähneln ihnen, auch in der Größe. Was zu der Trennung ihrer evolutionären Stränge führte, war ihre jeweilige Überlebens-Strategie. Offenbar entstand der Strang der Primaten (Euprimates) unter besonders extremen Naturverhältnissen, wo Intelligenz zu dem entscheidenden Sachverhalt im Überleben wurde. Es zeigt sich hier mehrfach, dass die Stufen der weiteren Primaten-Evolution aus geologischen Krisen resultierten, wo sich die Großhirn-Anlage und die Länge der Kindheiten jeweils potenzieren. Auch die Entstehung von Sprache scheint dies zum Hintergrund zu haben (s.u.).
Ein Vergleich zwischen der biologischen Strategie der Primaten und der Nagetiere zeigt bei aller ursprünglichen Verwandtschaft, was für ein enormer Unterschied auf die Dauer daraus evolutionär entstand.
Zu den Nagetieren und speziell der Hausmaus:
„Viele Arten [der Nagetiere], etwa die Mäuseverwandten, sind durch eine ausgesprochen hohe Fertilität gekennzeichnet (r-Strategie). Das Weibchen kann mehrmals im Jahr Nachwuchs zur Welt bringen, die Trächtigkeitsdauer ist kurz und die Wurfgröße hoch. Die Neugeborenen sind Nesthocker, oft unbehaart und hilflos, wachsen aber sehr schnell und erreichen binnen Wochen oder Monaten die Geschlechtsreife. So haben manche Hamsterarten mit nur 16 Tagen die kürzeste Tragzeit aller Plazentatiere und sind bereits mit sieben bis acht Wochen geschlechtsreif. Vielzitzenmäuse haben bis zu 24 Zitzen und Nacktmulle können bis zu 27 Neugeborene pro Wurf austragen.“ 12
Die >Hausmaus< „wirft bis zu acht Mal jährlich mit durchschnittlich 3 – 8 Jungen.“ „Die Tragezeit beträgt etwa drei Wochen.“ Etwa ebenso lange werden die Jungen gesäugt, im Alter von sechs Wochen sind sie geschlechtsreif. „Als zuchtreif gelten sie ab der achten Woche.“ 13
Allgemein erfährt die Hausmaus viele Verluste durch Fressfeinde. Ihre Lebenserwartung beträgt durchschnittlich zwei bis drei Jahre.
Merkmale der (Eu-) Primaten (mit über 400 Arten)
„Die Weibchen haben geringe Wurfgrößen. Schwangerschaft und Abstillen dauern länger als bei anderen Säugetieren vergleichbarer Größe.“
„Die Gehirne sind verhältnismäßig größer als bei anderen Säugetieren und weisen einige einzigartige anatomische Merkmale auf.“
„Generell zeichnen sich Primaten durch eine lange Trächtigkeitsdauer, eine lange Entwicklungszeit der Jungen und eine eher hohe Lebenserwartung aus. Die Strategie dieser Tiere liegt darin, viel Zeit in die Aufzucht der Jungtiere zu investieren, dafür ist die Fortpflanzungsrate gering. Die kürzeste Tragzeit haben Katzenmakis mit rund 60 Tagen, bei den meisten Arten liegt sie zwischen 4 und 7 Monaten. Die längste Trächtigkeitsdauer haben der Mensch und die Gorillas mit rund 9 Monaten.
Bei den meisten Arten überwiegen Einzelgeburten, und auch bei den Arten, die üblicherweise Mehrfachgeburten aufweisen (darunter Katzenmakis, Galagos und Krallenaffen), liegt die Wurfgröße selten über zwei oder drei Neugeborenen.“ 14
Doch ist es eher eine Vorstellung des 19. Jahrhunderts, dass sich der evolutionäre Erfolg der Säugetiere und insbesondere der Primaten ihrer Intelligenz verdankt.
Tatsächlich wäre dieser Erfolg gering geblieben, oder sie wären gar dem Aussterben verfallen, wenn ihnen nicht die gigantische Naturkatastrophe vor ca. 66 Mio. Jahren zu Hilfe gekommen wäre. Diese löschte einen Großteil des Lebens auf der Welt aus, insbesondere die größeren Tiere.15 Nun konnte sich nach dem Wegfall der übermächtigen Dinosaurier die Klasse der Säugetiere an die Spitze der Tierwelt setzen.
„Der Beginn des Zeitalters der Säugetiere […] ist gekennzeichnet durch geologische Umwälzungen und klimatische Veränderungen […]. Die kleinen Säugetiere, die fast hundert Millionen Jahre lang ängstlich und furchtsam über den Waldboden schnüffelten und Samen und Insekten suchten, ständig von gefräßigen Reptilien bedroht, hatten nun eine evolutionäre Chance.“ 16
S. dazu bei Bedarf weiter bei Wikipedia: Känozoikum (Erdneuzeit).
Die Linie der Primaten zum >Menschen< ist fett gezeichnet
Überblick Hominoide >> Menschen
nach der in diesem Buch vertretenen Auffassung
11 H. v. Ditfurth: Im Anfang war der Wasserstoff, S. 270, vgl. S. 269 und 323
12 Wikipedia: Nagetiere. Fortpflanzung. 7.1.21, 5:23 Uhr
13 Wikipedia: Hausmaus. Fortpflanzung. 28.04.23, 6:15 Uhr
14 alles nach: Wikipedia: Primaten. 7.1.21, 5:23 Uhr
15 Dass diese Katastrophe auf einen Asteoriden-Einschlag zurückgeht, erscheint nach der neueren Fassung des Wikipedia-Artikels >Kreide-Paläogen-Grenze< (27.4.23, 7:45) als das „derzeit wahrscheinlichste Szenario“.
16 R. E. Leakey & R. Lewin: Wie der Mensch zum Menschen wurde, S. 40
2 Zur evolutionären Entstehung von Sprache
„Eine Sprache verstehen, heißt, eine Technik beherrschen.“Ludwig Wittgenstein17
Die aufkommenden Einsichten in die >ursprüngliche Sprache des Homo sapiens (HS)< nötigten ständig zu einer Auseinandersetzung mit der humanevolutionären Entwicklung und der Evolution von Sprache. Denn sie deuteten darauf, dass die >ursprüngliche Sprache HS< bis zum Ende der Eiszeit entscheidend anders als unsere historischen Sprachen funktioniert hat.
Umgekehrt stellten sich auch grundlegende Zusammenhänge zwischen der historischen Entwicklung und einer substanziell neuartigen Sprachentwicklung am Ende der Eiszeit dar. Auch von hier aus entstanden in rückwärtiger Perspektive wichtige Einsichten, wie ab Kapitel 6 skizziert werden soll.
In diesen Zusammenhängen hatten auch die neueren neurologischen Erkenntnisse Konsequenzen für das Verständnis der humanevolutionären Entwicklung. Es ist hier nicht der Ort, eingehender darauf einzugehen. Doch da sich das Entscheidende mit der Verbindung von Neurologie und Sprache verknüpft, dürften hier die wichtigsten Gründe für das veränderte Modell von Humanevolution deutlich werden.
17 Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, zitiert nach: A.C. Grayling: Wittgenstein, S. 99
2.1 Laute und Wörter
Wörter sind zunächst einmal Lautformen. Sie konnten zu Bestandteilen der neurologischen Funktionslogiken werden, wo eine Befähigung zum Hören und zur Erzeugung von Lauten vorhanden war. Dies begann, wie erwähnt, bereits in Verbindung mit der Evolution des Zwischenhirns.
„Wörter sind nichts anderes als Geräusche, die das Gehirn [evolutionär ursprünglich] auf dieselbe Weise verarbeitet wie alle anderen akustischen Signale. Der Klang eines Wortes trifft auf die Hörrinde des Cortex und wird zu einer bewussten Sinneswahrnehmung wie das Pfeifen des Windes oder das Klingeln eines Telefons. Der Unterschied zwischen alltäglichen Geräuschen und Wörtern besteht darin, dass das Gehirn von Kindheit an dazu erzogen wurde, den Klang bestimmter Wörter mit bestimmten Erinnerungen zu verknüpfen.“ 18
Der Schritt von bloßen Lauten zu Wörtern besteht nun darin, dass die Laute zu einem Code akustischer Symbole entwickelt wurden. Mit diesem zunächst kleinen Schritt wurde jedoch ein völlig neuartiges Potential begründet.
„Die spezifisch menschliche Fähigkeit, das Geschehene zu benennen, macht unsere Wahrnehmung jedoch zu etwas Besonderem, denn sie versetzt uns in die Lage, diesen natürlichen Vorgang zu steuern. Indem wir etwas benennen, heben wir diesen Gegenstand deutlich gegen seinen Hintergrund ab. Wenn wir zum Beispiel unsere Augen wortlos durch einen bekannten Raum schweifen lassen, nehmen wir zwar alles wahr, doch hinterlässt nichts einen besonderen Eindruck auf uns. Ein Tier wird stets ausdruckslos auf die Vertrautheit eines solchen Raumes reagieren und nur dann aufmerksam werden, wenn etwas Ungewöhnliches geschieht, wenn zum Beispiel ein Spielzeug in einer Ecke des Zimmers bewegt würde. Menschen dagegen können sich auf ein Objekt konzentrieren und es benennen, als hätten wir den Gegenstand aus dem Bild ausgeschnitten. Aus seiner Umgebung herausgelöst, ist der Stuhl oder der Vorhang nicht länger irgendein belangloses Merkmal der Szene, sondern eine bestimmte klar umrissene Erinnerung, die sauber zurechtgeschnitten und unabhängig vom ursprünglichen Kontext ist.
Genau diese durch die Sprache geschärfte Wahrnehmung erlaubt es dem Menschen, einen beliebigen Gegenstand in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken und über ihn nachzudenken; dies gilt sogar für etwas so wenig Greifbares wie das eigene Denken.
Den Tieren dagegen wird das, was sie denken, durch ihre Wahrnehmungsfilter aufgezwungen. Ihr Gehirn ist darauf trainiert, stets die wichtigsten Geschehnisse der Umwelt [oder ihrer Innenreize wie Hunger] widerzuspiegeln, weshalb sich ihr Bewusstsein automatisch auf besonders auffällige Merkmale einstellt. Worauf ein Tier seine Aufmerksamkeit konzentriert, wird durch die Umwelt [und die Verhaltensanlage] bestimmt. Es besitzt keine Mechanismen, um dies selbst zu entscheiden. Wir Menschen dagegen können Wörter benutzen, um Teile der Welt wie mit einer Schere auszuschneiden. Wir können unsere Aufmerksamkeit bewusst auf etwas lenken, was den Nervenbahnen in unserem Gehirn – zumindest auf den ersten Blick – langweilig erscheint.“ 19
In Form von >Wörtern< konnten diese lautlichen Symbole verinnerlicht werden, so dass
„[…] die Außenwelt [und die körperlichen Impulse] nicht mehr die alleinige treibende Kraft des Geistes darstellte.“ 20
Durch Sprache entstand die deklarative Dimension der menschlichen Existenz.
„Hirnuntersuchungen lassen vermuten, dass dieses Organ über mindestens zwei Formen des Erinnerns verfügt, die bei den meisten Verhaltensweisen nahtlos ineinander übergehen. Das nicht-deklarative Gedächtnis umfasst Fertigkeiten wie Handschrift oder Autofahren und wird vom Kleinhirn und den Basalganglien getragen. Das deklarative Gedächtnis besteht aus Informationen – einer Adresse, Straßen zu einem Zielort, Worten, Gesichtern und anderem Wissen, das wahrscheinlich in der Großhirnrinde gespeichert wird.“ 21
Das folgende Beispiel zeigt die Bedeutung der deklarativen Ebene:
„Sowohl H.M. als auch ein weiterer Patient mit ähnlichen Gedächtnisausfällen erlernten dieses Geduldspiel genauso leicht wie Kontrollpersonen ohne Gehirnstörung. Und durch Übung verbesserten H.M. und der andere Patient sich schließlich so weit, dass es ihnen gelang, den Turm mit der Mindestzahl von 31 Zügen zu errichten. Sie selbst hatten allerdings immer das Gefühl, sie stünden zum ersten Mal vor dieser Aufgabe. Irgendwie hatten sie die Schritte, die zur Lösung dieser Aufgabe nötig sind, bewältigt, doch fehlte ihnen jegliche bewusste Erinnerung daran, sie erlernt zu haben.“ 22
Das Lernen bestimmter Aufgaben erfordert wohl nicht an sich die deklarative Ebene, aber das Verhalten bleibt reproduktiver Art. Für ein Wiederholen der Aufgaben reicht das, aber nicht für mehr.
Es ist ein höchst bedeutsamer und neurologisch alles andere als selbstverständlicher Sachverhalt, dass sich mit Hilfe von Wörtern Gedanken und Vorstellungen aktiv initiieren lassen. Mangels dessen bleiben bei dem Schimpansen die Techniken und >Mittel< neurologisch effektiv von den Situationen abhängig. In dieser Hinsicht gilt in engster Form >Aus den Augen – aus dem Sinn<.
„Auf dieser Pyramide der Reizverarbeitung liegen die Sprache und die künstlichen Aspekte des menschlichen Geistes wie eine dünne Kruste. Diese dünne Kruste übt jedoch einen gewaltigen Einfluss auf den Menschen aus, da sie in der Lage ist, die Richtung des Verarbeitungsprozesses umzukehren. Tiere leben ausschließlich in der Gegenwart: alle ihre Sinneswahrnehmungen steigen wellenartig bis zur Spitze auf und verwischen dabei die Spuren früherer Wellen. Durch die Sprache ist es jedoch möglich, die Richtung umzulenken und Gedanken zurückzulenken. […] Die dünne Kruste bewirkte also, dass das Gehirn nicht mehr nur einseitig von der Außenwelt angetrieben wurde, sondern dass es auch auf die sprachlich 23 motivierten Gedankenketten in seinem Innern reagierte.“