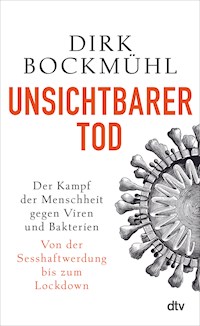
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Das letzte Wort haben die Mikroben.« Louis Pasteur Am Anfang war der Lockdown: Menschen wurden sesshaft, Tiere gesellten sich zu ihnen. Das war praktisch. Aber tödlich. Weil sich unsere Vorfahren das Sterben nicht erklären konnten, suchten sie Antworten bei den Göttern. So entstanden religiöse Hygiene- und Nahrungsvorschriften. Man fand heraus, welchen Wert saubere Straßen, frisches Wasser, gut belüftbare Wohnungen besaßen, man entdeckte die Keime und das Penicillin. Dirk Bockmühl, Professor für Hygiene und Mikrobiologie, nimmt uns mit auf einen faszinierenden Streifzug durch die Geschichte der Zivilisation, der Religionen, der Architektur, der Medizin und der Wissenschaften. Er erzählt eine Geschichte ohne Ende, ein wesentliches Kapitel schreiben wir alle gerade selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Seit dem ersten Lockdown der Menschheit, der Sesshaftwerdung, begleiten uns Krankheitserreger, selbst Seuchen sind, historisch betrachtet, eher die Regel als die Ausnahme. Das Bestreben, sie zu bezwingen, führte zur Erfindung der Tongefäße, zur Bereitstellung von sauberem Trinkwasser und zur Entwicklung von Hygienekonzepten. All dies diente der Infektionsprävention und verbesserte die Lebensbedingungen der Menschen.
Der Kampf gegen Mikroben ist eine Geschichte der Erfolge, aber auch des Scheiterns herausragender Männer und Frauen, die für ihre Überzeugung gestritten und dabei die Menschheit immer ein Stück weitergebracht haben: Louis Pasteur, Robert Koch, Rosalind Franklin und viele andere, deren Namen zu Unrecht in Vergessenheit gerieten, waren beseelt von dem Vorsatz, die komplexen Interaktionen zwischen Mensch und Mikrobe zu verstehen und Infektionskrankheiten zu beherrschen. Heute wissen wir, dass wir mit ihnen leben müssen – aber auch immer besser können.
Dirk Bockmühl lässt uns in seinem so informativen wie kurzweiligen Buch einen Blick in die Zivilisationsgeschichte werfen. Sie beginnt in der Steinzeit und endet, hochaktuell, beim vorläufig letzten Lockdown während der Corona-Pandemie.
Inhalt
Vorwort
1 Steinzeitliche Begegnungen
Was das Immunsystem mit der Sesshaftwerdung der Menschen und der Domestizierung ihrer Haustiere zu tun hat und warum Infektionen ein Spiegel der Mobilität und Vernetzung sind
2 Der Zahnwurm des Assurbanipal
Als man Karies mit Bier und Sesamöl zu Leibe rückte und müttermordende Dämonen für Infektionen verantwortlich machte
3 Leben mit dem Nilfieber
Warum stehende Gewässer ideale Brutstätten für Stechmücken sind und Tutenchamun wohl eines der ersten Opfer der Malaria war
4 Mit allen Wassern gewaschen
Welche Rolle Parasiten spielen, warum das »Maggi der Antike« so beliebt wie gefährlich war und was es mit der Badekultur des alten Rom auf sich hatte
5 Byzanz kämpft: gegen Beulenpest, Barbaren und Blutwurst
Wie Sporen in Lebensmittel gelangen und warum mit der Konservierung Risiken und Nebenwirkungen einhergehen
6 Ex oriente lux
Von der Erkenntnis, dass Krankheiten übertragbar sind und Beobachtung und Beweis schneller zum Ziel führen als Mutmaßung und Mythologie
7 Ausgestoßen
Warum Lepra als Strafe Gottes galt und die Isolation von Aussätzigen als eine frühe Maßnahme zum öffentlichen Infektionsschutz angesehen werden kann
8 Sieh da, das Scheusal und die Pest der Welt
Von der Reinigung der Seele, den Anfängen der organisierten Müllabfuhr und dem aussichtslosen Kampf gegen Ratten und Flöhe
9 Neue Horizonte
Syphilis und die Erfahrung, dass sich der Austausch zwischen den Völkern der Alten und der Neuen Welt nicht allein auf Waren beschränkt
10 Der Schnabeldoktor
Vogelkopfartige Masken, spitze Hauben und andere Schutzkleidung sicherheitsbewusster Pestärzte: die Anfänge der Berufskleidung
11 Der Fluch der Lazarette
Warum genügsame Bakterien und andere wahre Überlebenskünstler unter den Mikroorganismen eine so große Gefahr für offene Wunden darstellen
12 Der große Spallanzani
Wie Leben (nicht) in verschlossene Flaschen kommt und Organismen durch Erhitzung abgetötet werden können: der Beginn der Sterilisation
13 Die mutige Lady Montagu
Die Entdeckung, dass das Impfen vor Neuinfektionen schützen kann, und andere kreative Methoden der Immunisierung
14 Napoleons größte Feinde
Die antibakterielle Wirkung ätherischer Öle, die Geburtsstunde der Konservendose und neue Möglichkeiten der Haltbarmachung von Lebensmitteln
15 Vom Geist des Weines
Inwiefern die Hefe an der alkoholischen Gärung beteiligt ist, warum Bier sauer werden kann und was das mit Infektionen beim Menschen zu tun hat
16 Schlachten auf verfluchten Feldern
Wie eine geniale Färbemethode Bakterien unter dem Mikroskop sichtbar machte und Ochsenaugen die Grundlage für die Reinkultur schufen
17 Mit Karbol und Kittel
Mikroorganismen, die aus der Luft gegriffen sind, und andere Faktoren, die es bei einer Operation zu vermeiden gilt
18 Von Impfungen und Irrwegen
Über die Grenzen hinweg: Rivalität und Konkurrenzkampf bei der Entdeckung des Bakteriums, das die Tuberkulose auslöst
19 Quellensuche
Warum die Cholera eine der am längsten währenden Pandemien ist, und wie ein Stadtplan von London dazu beitrug, ihrer Entstehung auf die Spur zu kommen
20 Ungleiche Partner
Welche Rolle Bakterien in unseren Gedärmen spielen, warum die Darmflora mit Depressionen zusammenhängt und wie die Fresszellen zu ihrem Namen kamen
21 Gesundheit ansteckend machen – Hygiene im Alltag
Von Puder, Parfüm, Seife und Schweiß: Körperhygiene im Spiegel der Zeit
22 Ein Platz an der Sonne
Was es bringt, Mückenmägen zu sezieren, wenn man die Ursache von Tropenkrankheiten herausfinden will
23 Die Spanische Grippe und die Entdeckung der Viren
Warum ehrgeizige Forscher nicht vor riskanten Selbstversuchen zurückschrecken und die Krankheit mit Spanien vermutlich gar nichts zu tun hat
24 Alec gewinnt einen Krieg
Wie eine maßlose Schlamperei zu einer bahnbrechenden Entdeckung führte und das Penicillin in die Welt kam
25 Kidnapping einer Wissenschaft
Die sogenannte Reinheit der sogenannten Rassen oder wie Wissenschaft für politische Zwecke missbraucht wird
26 Das Jahrhundertmolekül
Warum die Gentechnik so umstritten ist und welche Alternativen es zu ihr geben könnte: das Drama um die DNA
27 Moderne Zeiten
Vom Umgang mit neuen Seuchen und Bedrohungen und die Gewissheit, dass wir uns (wieder) an Infektionen werden gewöhnen müssen
28 Und nun?
Warum es die absolute Sicherheit nicht gibt und nationale und wirtschaftliche Interessen einer gerechten Verteilung von Medikamenten häufig im Weg stehen
Quellennachweise und Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Dank
Personenregister
Vorwort
Die Geschichte, die hier erzählt wird, beginnt gewissermaßen mit dem ersten Lockdown der Menschheit – der Sesshaftwerdung. Nachdem unsere Vorfahren das unstete Leben als Jäger und Sammler aufgegeben hatten, boten sich großartige neue Perspektiven: die Verfügbarkeit der eigenen Nahrung direkt am Ort der Siedlung, Möglichkeiten zur Vorratshaltung, eine verbesserte Arbeitsteilung. Doch es drohten auch neue Gefahren aus dem engeren Miteinander der menschlichen Siedler und ihrer Haustiere.
Bis heute begleiten uns Krankheitserreger, die sich in einer wachsenden, mobileren Bevölkerung von Mensch zu Mensch verbreitet haben, vor allem aber immer wieder von Tieren auf Menschen übertragen wurden. Viele Infektionskrankheiten entwickelten sich zu Seuchen, die mitunter die ganze Welt mit Tod und Elend überzogen, doch zu allen Zeiten spornten sie auch einzelne Personen oder Gesellschaften zu Entdeckungen und Entwicklungen an, die das Leben besser und sicherer machten.
Als umso einschneidender empfanden wir die moderne Pandemie, die Europa in Form der Coronakrise in den frühen 20er Jahren des 21. Jahrhunderts heimsuchte. Dabei sind Seuchen in der historischen Betrachtung eher die Regel als die Ausnahme, und tatsächlich haben diese Bedrohungen den menschlichen Forscherdrang immer wieder beflügelt. So wie wir im Jahr 2020 die Entwicklung völlig neuartiger Impfstoffe in Rekordzeit bestaunen durften, so wurden unsere Vorfahren ihrerseits Zeugen von Maßnahmen, mit denen der Kampf gegen Krankheitserreger aufgenommen werden sollte: von der Erfindung der Tongefäße, die Lebensmittel vor Schädlingen bewahrten, über die sichere Versorgung mit sauberem Wasser sowie Hygienekonzepte und Mittel zur Infektionsprävention bis hin zu Konsequenzen aus der Erkenntnis, welche Rolle die Mikroorganismen bei der Entstehung von Krankheiten und deren gezielter medikamentöser Behandlung spielen.
Verbunden mit diesem über zehntausend Jahre alten Kampf gegen Infektionskrankheiten sind die Schicksale vieler herausragender Menschen, die für ihre Überzeugung gestritten, nach Anerkennung gestrebt oder nach einem besseren Leben für sich und andere gesucht – und dabei die Menschheit jedes Mal ein Stück weitergebracht haben. Wenn ihre Geschichten hier erzählt werden, geschieht das ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber mit der Absicht, die treibende Kraft zu beschreiben, die Seuchen von jeher waren. Diese Plagen haben der Welt viel Leid beschert, aber seit jeher bei Menschen aller Kulturen und Religionen enorme Wissens- und Innovationslust freigesetzt. Wir werden Zeugen steinzeitlicher Familientragödien und gehen den Zahnschmerzen der alten Babylonier auf den Grund. Wir betrachten Seuchen als Inspiration für Schriftsteller wie Boccaccio, Dante, Arthur Conan Doyle oder Thomas Mann. Wir blicken durch erste Mikroskope und lernen Alexander Flemings Hang zur Unordnung als segensreiche Untugend kennen. Und vor allem begegnen wir den Menschen, die durch ihre Neugier, ihre Strebsamkeit, aber auch ihre Ängste ein Teil der Historie im Kampf gegen den unsichtbaren Tod geworden sind: leidenschaftliche Wissenschaftler wie Louis Pasteur und Robert Koch, aber auch besorgte und gut informierte Mütter wie Lady Montagu und entschlossene Herrscherinnen wie Maria Theresia.
Wie einerseits Infektionskrankheiten und Epidemien in der Lage waren, Weltreiche in ihren Grundfesten zu erschüttern und Gesellschaften zu verändern, so ergaben sich andererseits durch Maßnahmen zur Kontrolle von mikrobiell verursachten Risiken neue Möglichkeiten, Kriege zu gewinnen und politische Strukturen zu stützen. Vor allem aber erhöhten diese Maßnahmen, insbesondere die Hygiene als vorbeugender Gesundheitsschutz einschließlich präventiver, medizinischer Ansätze wie dem Impfen, die Lebensdauer und -qualität der Menschen massiv. Antibiotika haben als wichtige Therapeutika vielen einstmals tödlichen Krankheiten den Schrecken genommen. Aber wir müssen wachsam bleiben, damit diese Errungenschaften uns auch in Zukunft noch uneingeschränkt zur Verfügung stehen, denn der richtige Umgang mit Hygienemaßnahmen durch uns alle und die Wirksamkeit von Antibiotika sind keine Selbstverständlichkeit.
Kann man aus der Geschichte lernen? Möglicherweise nicht uneingeschränkt, aber wir können die gegenwärtige Situation als Folge historischer Entwicklungen betrachten und versuchen, aus den Erfolgen und dem Scheitern früherer Generationen unsere Schlüsse zu ziehen. Eine Welt ohne Pandemien wird es vermutlich niemals geben, ein Leben ohne Mikroorganismen ganz sicher nicht. Wie wir den Herausforderungen der mikrobiellen Welt begegnen können – nun, die Geschichten, die hier erzählt werden, zeigen uns eindrucksvoll Dos and Don’ts im Zusammenhang mit Seuchen und Krankheitserregern und sollen uns als Inspiration und Warnung dienen.
1 Steinzeitliche Begegnungen
Was das Immunsystem mit der Sesshaftwerdung der Menschen und der Domestizierung ihrer Haustiere zu tun hat und warum Infektionen ein Spiegel der Mobilität und Vernetzung sind
Als sie das, was von den Körpern der jungen Frau und ihrer wohl zwölf Monate alten Tochter über die Jahrtausende übriggeblieben war, im Labor genauer untersuchten, machten die Forscher eine Entdeckung, die sie innehalten ließ. Die Skelette, die das Team um Israel Hershkovitz von der Universität Tel Aviv und seine Kollegin Helen Donoghue vom University College in London unter die Lupe nahm, stammten von einer Fundstelle südlich von Haifa vor der israelischen Küste.1 Die Siedlung Atlit-Yam war irgendwann, lange nachdem das Baby und seine Mutter bestattet worden waren, überflutet worden; das Marschland, auf dem die Menschen von Atlit sich niedergelassen hatten, wurde vom Mittelmeer überspült, so dass die Gräber, die die britisch-israelische Forschergruppe im Jahr 2007 entdeckte, mitsamt den Bestatteten und ihren Grabbeigaben seit wohl neuntausend Jahren unberührt geblieben waren. Der lehmige Boden und die darüberliegende Sandschicht hatten ein nahezu sauerstofffreies Milieu geschaffen, das die menschlichen Überreste ebenso gut konservierte wie die Schilfmatten und hölzernen Gefäße, die ihnen auf dem Weg in die Ewigkeit mitgegeben worden waren.
Vermutlich war der Tod für Mutter und Tochter eine Erlösung gewesen: Das Schädelinnere des kleinen Mädchens war von schlangenförmigen Einkerbungen gekennzeichnet und die langen Röhrenknochen waren an den Schäften geschwollen. Bei ihrer Mutter fanden sich ähnliche Abdrücke, wenn auch nicht so ausgeprägt. Ein erfahrener Mediziner schöpft bei einem solchen Befund augenblicklich Verdacht. Um diesen zu erhärten, wird er sich auf die Suche nach Spuren von DNA machen.
Unsere Erbsubstanz allerdings ist kein besonders stabiles Molekül. Daher ist es schwierig, DNA, die aus lange vergangenen Zeiten stammt, zu isolieren. So reizvoll und spektakulär die Idee auch ist, mithilfe der kompletten Genome von im Eis konservierten Tieren zum Beispiel Mammuts quasi wiederauferstehen zu lassen, so schwierig ist das Unterfangen doch in der Umsetzung. Und das, obwohl dank des sibirischen Permafrostbodens manche Exemplare wirklich fantastisch erhalten sind. Noch weniger aussichtsreich wäre solch ein Experiment, wenn die klimatischen Verhältnisse ungünstiger oder, wie im Fall der Siedlung am Mittelmeer, nur noch Skelette vorhanden sind, auf denen sich bestenfalls Reste von Zellen finden. Unter solchen Bedingungen müssen Biologen mühsam versuchen, den Proben die wenigen DNA-Moleküle abzuringen und sie von anderen organischen Bestandteilen zu befreien, die eine weitere Analyse beeinträchtigen würden. Wegen der vielen störenden Substanzen, die sich sonst noch in einer Probe befinden können, ist es bereits eine Herausforderung, DNA aus einer frischen Bodenprobe zu isolieren – ganz zu schweigen von Tausende Jahre alten Knochen mit spärlichen Resten von Gewebe.
Hershkovitz und Donoghue hatten jedenfalls kein Glück: Menschliche DNA war in den Skeletten der beiden Bestatteten aus Atlit-Yam leider nicht nachweisbar. Was die Forscher aber sehr wohl gefunden haben, war die Erbsubstanz von Bakterien. Da das Erbgut der meisten gängigen Bakterien mittlerweile bekannt und auch recht charakteristisch ist, war es möglich, mit großer Sicherheit jene Art zu ermitteln, die für das Leid von Mutter und Tochter verantwortlich gewesen war.
Bereits 1993 war es den Wissenschaftlern Mark Spigelman und Eshetu Lemma erstmals gelungen, bakterielle DNA aus antiken menschlichen Gebeinen zu isolieren.2 Bei den dreihundert bis tausendvierhundert Jahre alten Skeletten, die sie untersuchten, handelte es sich um Menschen aus Europa, dem asiatischen Teil der Türkei und aus Borneo. Sie alle wiesen ähnliche Symptome auf wie die Skelette aus Atlit-Yam. Steckte also derselbe Erreger dahinter, und litten diese Menschen, die auf unterschiedlichen Kontinenten und in verschiedenen Epochen lebten, an der gleichen Krankheit? Mithilfe seiner DNA fanden Spigelman und Lemma heraus, dass es sich beim Verursacher der Infektion in allen Fällen um die Bakterienart Mycobacterium tuberculosis handelte.
Noch heute sind weltweit etwa 1,5 bis zwei Milliarden Menschen damit infiziert und auch Mutter und Tochter aus der Bucht von Atlit waren zweifelsfrei an Tuberkulose erkrankt, denn auch bei ihnen konnte ebendieser Keim mittels DNA-Analyse nachgewiesen werden. Der neuntausend Jahre alte Fund aus Atlit ist bislang der älteste Nachweis von Tuberkuloseerregern beim Menschen, das heißt aber nicht, dass die Schwindsucht, wie die Krankheit auch genannt wurde, erst zu dieser Zeit aufgetreten ist. In einer Höhle im US-Bundesstaat Wyoming fand man DNA-Spuren dieser Bakterien auf einem Bison, das vor ungefähr siebzehn- bis zwanzigtausend Jahren gelebt hat.3 Und möglicherweise erkrankten Angehörige der ersten aufrecht gehenden Menschen, Homo erectus, tatsächlich schon vor fünfhunderttausend Jahren an Tuberkulose – zumindest legen das Fossilienfunde nahe, die einmal mehr die für die Tuberkulose typischen Knochendeformationen aufweisen.4 Die Funde in Atlit-Yam stammen jedenfalls aus der beginnenden Jungsteinzeit. Und genau zu diesem Zeitpunkt scheinen sich Tuberkulose und andere Infektionen sprunghaft ausgebreitet zu haben.5 Aber wieso?
Zu ebenjener Zeit fingen die Menschen an, die Samen wildwachsender Vorgänger von Weizen und Gerste auf einem freien Stück Erde vor ihren primitiven Behausungen auszustreuen, um fortan diese Pflanzen dort anzubauen, wo sie lebten, und nicht mehr durch die weiten Landschaften ziehen und sie sammeln zu müssen. Auch pferchten sie die ersten Schafe ein, nachdem das Klima in der Region östlich des Mittelmeers immer trockener geworden war und die Gazellenjäger daher immer häufiger ohne Beute heimkehrten. Eine neue Epoche begann, aber selbstverständlich schrieb niemand diesen Wandel für die Nachwelt nieder, der sich weit mehr als zehntausend Jahre vor unserer Zeitrechnung vollzog. Und natürlich ist er auch nicht allein mit dem Ende des rastlosen Umherwanderns auf der Jagd nach Beute und des Sammelns von essbaren Früchten und Pflanzen zu erklären. Die Zeitenwende ging nach und nach vonstatten und hat doch bis heute gravierende Auswirkungen. Und so wird es der Tragweite dieser Veränderung gerecht, wenn wir sie uns als einen Moment vor Augen führen, nach dem für die Menschheit nichts mehr so war wie zuvor für sehr lange Zeit. Immerhin existiert unsere Spezies Homo sapiens in der jetzigen Form mehr oder weniger bereits seit etwa hundertfünfzigtausend Jahren. Und das bedeutet nichts anderes, als dass die Menschheit neunzig Prozent ihrer Geschichte als Jäger und Sammler und eben nicht mit Ackerbau und Viehzucht verbracht hat.
Abgesehen von den soziologischen, kulturellen und technologischen Entwicklungen, die die Sesshaftwerdung nach sich zog, sind es nicht zuletzt die biologischen Rahmenbedingungen, die sich durch die veränderte Ernährung und das Zusammenleben mit den Geschöpfen, die wir als Haustiere bezeichnen, dramatisch wandeln sollten. Der Umbruch, für den der australische Archäologe Vere Gordon Childe in den 1930er Jahren den Begriff »neolithische Revolution« prägte,6 ist kein Aufstand gegen die Obrigkeit, auch wenn der überzeugte Marxist diese Analogie im Sinn gehabt haben mag, als er die drastischen Veränderungen unserer Spezies in der Jungsteinzeit zu beschreiben versuchte. Die Verwandlung vom jagenden Steinzeitmenschen zum mehr oder weniger ortsgebunden lebenden Bauern ist vielmehr eine Reaktion auf das sich ändernde Klima in jener Gegend, die häufig als »Levante« umschrieben wird. Die Ableitung dieses altitalienischen Wortes für das »Emporsteigen« oder »sich Erheben« hat als poetischer Begriff des Morgenlandes für lange Zeit unsere Sicht auf die Länder des östlichen Mittelmeerraumes geprägt. Goethe schreibt im West-östlichen Divan, seinem großen Morgenland-Epos: »Und so lang du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.«7
Sterben und Werden – im Neolithikum kämpften nicht nur Mutter und Tochter aus Atlit-Yam als trübe Gäste auf der dunklen Erde gegen den Hunger, seitdem die Tierherden ausblieben, die ihnen bislang als Nahrungsgrundlage gedient hatten. Es zog also mitnichten ein neuer, hoffnungsvollerer Tag aus dem Osten herauf, nun, da die Menschen sich nicht mehr damit begnügten, die Ähren wild wachsender Getreidesorten zu sammeln, sondern sie selbst anbauten. Die Erkenntnisse, die wir über diese Zeit haben, legen in der Tat nahe, dass sich die Welt um sie eher verdunkelte, denn wie die in Atlit-Yam entdeckten Skelette zeugen die meisten Funde aus den ersten Jahrtausenden nach der Sesshaftwerdung keineswegs von gesunden und kräftigen Menschen. Vielmehr weisen die zum Teil deformierten knöchernen Überreste vielfach klare Zeichen für Mangelernährung, Infektionen und chronische Entzündungen auf. Doch warum litt Homo sapiens unter der neuen Lebensweise, statt buchstäblich an den Früchten seiner Arbeit zu gedeihen? Die Evolution, die diese Menschen über Zehntausende von Jahren erschuf, hatte lange schlicht andere Maßstäbe an das menschliche Individuum angelegt. Die darauf beruhenden genetischen Voraussetzungen hatten den Menschen besonders »fit« für die damaligen Umweltbedingungen gemacht. Insbesondere die physiologischen Gegebenheiten, die perfekt auf die Ernährungsweise der Jäger und Sammler ausgerichtet waren, konnten nicht einfach mit einem Handstreich, dem Ernten und Melken, verändert werden. Und so darf es als sicher gelten, dass sich unsere Spezies in der Jungsteinzeit (oder sollte man besser sagen: seit der Jungsteinzeit) falsch ernährte. Unser Körper ist auf eine bestimmte Diät eingestellt, die vorwiegend der eines Tiere jagenden Wesens entspricht und daher sehr reich an Proteinen, vielleicht auch an Fetten, aber vor allem arm an Kohlenhydraten ist. Letztere ergänzten den Speiseplan der sehr frühen Menschen nur sporadisch in Form von gesammelten Früchten und Samen.
Unser 21. Jahrhundert scheint die Welt nicht mehr nur in Arm und Reich, Jung und Alt, Ost und West zu spalten, sondern – speziell in den wohlhabenden Nationen – auch in Fleischkonsumenten, Vegetarier und Veganer. Eine Variante der unterschiedlichen Ernährungsphilosophien nennt sich Paläo-Diät, der zufolge wir uns wie unsere frühesten Vorfahren ernähren sollen: also im Wesentlichen proteinreich und kohlenhydratarm. Die Idee ist nicht gänzlich absurd, denn die bei den frühen Bauern (und auch bei den meisten Bewohnern der modernen Industrienationen) verbreitete, stark getreidebasierte Ernährung bringt viele Nachteile mit sich. Abgesehen von den bereits angedeuteten Mangelerscheinungen durch die geringere Aufnahme von Proteinen, Vitaminen und Eisen aus tierischer Kost litten viele Menschen der späten Steinzeit nun plötzlich auch an Karies – eine Erkrankung, die bei den umherziehenden Jägern offenbar weitgehend unbekannt war.
Zahnfäule stellte aber bei Weitem nicht die schlimmste Bedrohung dar, der sich die vorzeitlichen Siedler im fruchtbaren Halbmond ausgesetzt sahen. Die weitaus größere Gefahr ging von den domestizierten Tieren aus, die nun in enger Gemeinschaft mit ihren menschlichen Mitgeschöpfen lebten. Viele Beispiele belegen inzwischen Fälle, in denen Mikroorganismen, die eigentlich auf einen tierischen Wirt spezialisiert sind, auf den Menschen übertragen werden. Genau so kam es wohl auch zur Entstehung der dramatischen Coronavirus-Pandemie, die vermutlich im Herbst 2019 auf einem Markt im chinesischen Wuhan ihren Ausgang nahm.
Die mit Mycobacterium tuberculosis verwandte Bakterienart Mycobacterium bovis befällt vor allem Rinder und scheint sich offenbar erst im Zuge der Domestizierung entwickelt zu haben.8 Es ist eher die Regel als die Ausnahme, dass Infektionserreger, die sich zunächst auf eine bestimmte Art von Wirtsorganismus konzentrieren, irgendwann auch auf andere Tiere oder den Menschen überspringen. Das ist naheliegender, als es zunächst scheint. Ein Bakterium muss gewisse Eigenschaften haben, um seinen bevorzugten Wirt zu infizieren, vielleicht kann es an eine bestimmte Oberflächenstruktur auf den Zellen der oberen Atemwege besonders gut andocken und sich dort etablieren. Nun sind die Oberflächen dieser Zellen bei – sagen wir – Kühen und Menschen zwar unterschiedlich beschaffen, weichen aber nicht unbedingt komplett voneinander ab. Wenn es nun bei ständigem Kontakt zwischen Mensch und Haustier auch zu einem mehr oder weniger regelmäßigen Austausch von Bakterien kommt, sind bei der Vielzahl der Mikroorganismen, die beispielsweise ein Rind abgibt, eben auch solche dabei, die sich zufällig sogar leichter an die menschliche Zelloberfläche anheften können als an die tierische. Genau diese Bakterien sind dann in der Folge besser an den neuen Wirt angepasst, vermehren sich dementsprechend schneller und geben dabei die genetische Information zum Andocken an ihre Nachkommen weiter. Dieser Effekt, der praktisch lehrbuchhaft die Darwin’sche Evolutionstheorie widerspiegelt, hat jedoch eine dramatische Konsequenz für den neuen, menschlichen Wirtsorganismus, denn ein neuer Infektionserreger kann – heute wie vor zehntausend Jahren – von den schärfsten Waffen des Immunsystems nicht abgewehrt werden. Es ist nicht ganz klar, ob zunächst der Mensch »seine« Kühe mit Tuberkulose infiziert hat, oder ob es genau umgekehrt war (vieles spricht allerdings für den ersten Fall, da das menschliche Tuberkulosebakterium entwicklungsgeschichtlich älter ist als der Erreger der Rindertuberkulose). Unstrittig ist, dass die Tuberkulose erst durch das neuartige Zusammenleben von Tieren und Menschen nach der neolithischen Revolution zu der massenhaften Seuche geworden ist, die sie seitdem darstellt.
Krieg der Welten
Dass wir Infektionserregern nicht schutzlos ausgeliefert sind, verdanken wir unserem Immunsystem, das sich in zwei Verteidigungslinien formiert hat: Die erste Abwehrlinie bilden spezialisierte Blutzellen, etwa die Lymphozyten, die durch natürlich vorkommende, antimikrobielle Substanzen unterstützt werden. Diese Immunantwort ist angeboren und dient im Wesentlichen dazu, als körperfremd erkannte Zellen und Substanzen (Mikroorganismen, aber auch Tumorzellen oder Proteine) zu inaktivieren beziehungsweise zu entfernen. Man kann davon ausgehen, dass auf diese Weise bereits neunzig Prozent aller Infektionen buchstäblich »im Keim erstickt« werden.9 Die restlichen zehn Prozent übernehmen dann die Komponenten des erworbenen Immunsystems. Das zentrale Element dieser zweiten Verteidigungslinie sind Antikörper, die nach dem Erstkontakt mit einem Infektionserreger gebildet werden und dort an Oberflächenstrukturen andocken können. Einmal auf diese Weise »markiert«, werden Mikroben beispielsweise von Fresszellen eliminiert. Andere Antikörper verhindern, dass Keime ihre Zielzellen erkennen, oder lassen sie einfach verklumpen, weil sie mehr als eine Andockstelle für die mikrobielle Zelle besitzen. Nicht immer können Krankheitserreger sicher erkannt werden, denn viele Keime haben Mechanismen entwickelt, um das Immunsystem auszutricksen. Der Tuberkuloseerreger etwa geht dabei besonders perfide vor: Er versteckt sich ausgerechnet in den Fresszellen, die ihn eigentlich ausschalten sollen. Dadurch bleibt er für das Immunsystem so lange unsichtbar,10 bis ein günstiger Zeitpunkt gekommen ist zuzuschlagen.
Die steinzeitlichen Jäger und Sammler hatten, anders als ihre sesshaften Nachfahren – nur sporadisch Kontakt mit ihrer Beute, zu kurz jedenfalls für den intensiven Austausch von Mikroorganismen und deren Anpassung an den Menschen. In den späteren Siedlungen wie Atlit-Yam sah das schon ganz anders aus: Die Siedler dort hatten ihre Hütten aneinandergebaut, verbrachten viel Zeit miteinander und natürlich auch in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihren Haustieren. Allerdings waren diese Dörfer nicht nur Orte für Menschen und Tiere, sondern auch für deren Fäkalien- und Abfallgruben. Und diese wiederum entwickelten sich zu wahren Brutstätten für Keime und Infektionsherde.
Die Dörfer wuchsen und wuchsen. Die umherziehenden Ahnen der Siedler hatten noch sicherstellen müssen, dass ihre Kinder in der Lage waren, ihnen auf der Wanderschaft zu folgen, was schlicht bedeutete, dass eine Frau erst dann wieder ein Baby bekam, wenn das Geschwisterchen bereits selbst laufen konnte. Bei den frühen Bauern aber verdoppelte sich nun die Geburtenfrequenz: Statt alle vier Jahre ein Kind zu bekommen, wurden die Frauen der Jungsteinzeit etwa alle zwei Jahre erneut schwanger, mit der Konsequenz, dass erstmals deutlich mehr Menschen geboren wurden als starben. Menschen, die natürlich Siedlungsraum beanspruchten, ernährt werden mussten – und ihren Unrat hinterließen.11
Dabei scheinen die jungsteinzeitlichen Siedler keineswegs unhygienisch gewesen zu sein. Vieles deutet darauf hin, dass die Bewohner der primitiven Behausungen des Neolithikums ihren Dreck mit Reisigbesen vor die Tür kehrten und den Dachüberstand draußen als Toilette wählten. In der schottischen Siedlung Skara Brae auf den Orkney Inseln, deren Steinhäuser vor etwa fünftausend Jahren von vielleicht fünfzig Menschen bewohnt waren, hatte sehr wahrscheinlich sogar jedes Haus seine eigene Toilette. Es ist faszinierend, dass die Bauernhäuser auf den Hebriden noch bis ins 20. Jahrhundert nach dem gleichen Muster eingerichtet wurden: Um eine zentrale Feuerstelle gruppierten sich zwei von mehreren Familienmitgliedern gemeinsam genutzte Betten, es gab einen Schrank mit Regalfächern, und ein in den Boden eingelassenes Becken hielt vermutlich den Fang der Woche lebendig und frisch. Sogar eine zentrale Abwasserentsorgung in Form einer Drainage scheinen die Menschen von Skara Brae angelegt zu haben.12
Die Toilette en suite war zur damaligen Zeit allerdings kein schottisches Privileg. Auch in einzelnen Häusern im türkischen Catal Hüyük, einer anatolischen Siedlung, die um 7000 v. Chr. ihre Blütezeit erlebte, fanden Archäologen »Örtchen«, die am ehesten als Latrine zu deuten sind. Offensichtlich entsorgten die Bewohner die menschlichen Exkremente von dort auch regelmäßig, allerdings auf eine eher zweifelhafte Art und Weise: Sie schütteten daraus Abfallhaufen auf, in deren Mitte nicht selten neue Hütten errichtet wurden – womöglich aus Gründen der Isolation und Stabilität.13 Es scheint also, als hätten unsere jungsteinzeitlichen Vorfahren sehr wohl über eine Art rudimentäres Hygieneverständnis verfügt, es jedoch aus Unwissenheit nicht immer zielführend umgesetzt. So sorgten sie etwa nicht für eine strikte Trennung von ihren Ausscheidungen, die wiederum über den Kontakt mit Trinkwasser oder Nahrung ein erhebliches Infektionsrisiko in den Siedlungen darstellten.
Als schließlich die ersten Städte gegründet wurden, erwiesen sich die Umstände für die massenhafte Ausbreitung von Seuchen als noch günstiger. Und es bildeten sich bald wahre Metropolen: Die Stadt Uruk in Mesopotamien beherbergte um 3000 v. Chr. bereits mehr als zwanzigtausend, vielleicht sogar vierzigtausend Menschen. Die Einwohner dort und anderswo lebten auf engstem Raum zusammen, es wurden Zisternen und Brunnen für die Trinkwasserversorgung angelegt, die jedoch in keiner Weise vor dem Kontakt mit den Abwässern geschützt waren.14 Auf diesem Weg gelangten mit der Gülle der Haustiere und den menschlichen Exkrementen viele Infektionserreger ins Trinkwasser, etwa Band- und Spulwürmer, Bakterien, die Typhus oder Cholera brachten, und Viren. Zudem bildeten die Wasserreservoirs eine Brutstätte für Mückenarten, die Malaria, aber auch virale Erreger übertrugen – und selbstverständlich breiteten sich diese Infektionen rasant aus. Schließlich muss noch eine weitere Gruppe von »Stadtbewohnern« erwähnt werden: die Mäuse und Ratten, die sich in den neugegründeten Städten vermutlich millionenfach tummelten. Die Ratte sollte bei den Pestepidemien der folgenden Jahrtausende eine besonders unheilvolle Rolle spielen. Sie gelangte später über Handelsrouten in der gleichen Geschwindigkeit in weit entfernte Regionen und Orte wie die Güter, mit denen sie unbeabsichtigt transportiert wurde.
Die Tuberkulose ist also bei Weitem nicht die einzige mikrobielle Gefahr, die die Menschheit seit dem Neolithikum bedroht. Nachdem Robert Koch im 19. Jahrhundert den »Tuberkelbazillus« als Erreger der Krankheit identifiziert und damit überhaupt Mikroorganismen als Ursache vieler Seuchen und Krankheiten entlarvt hatte (Pocken, Pest und Cholera kosteten weit mehr Menschen das Leben als alle Kriege zusammen), erkannte man auch die Bedeutung von Desinfektion und Sterilisation, und bereits ein halbes Jahrhundert später wurde mit dem Penicillin die Wunderwaffe gegen Infektionen schlechthin entdeckt. Überhaupt wurden bei der Bekämpfung der Seuchen im 19. und 20. Jahrhundert Siege in einer Geschwindigkeit errungen, von der die Menschen der Jungsteinzeit nur hatten träumen können. Denn da über Keime, Infektionswege und Hygiene so gut wie nichts bekannt war, blieb ihnen nichts anderes übrig, als auf die natürlichen Abwehrmechanismen zu vertrauen.
Seit Beginn des Lebens auf der Erde tobt der Kampf zwischen den Organismen. Die Strategien in diesem Gegeneinander aber sind so vielfältig wie die Evolution selbst. Das Immunsystem der Tiere etwa stellt eine Strategie dar, die sich gewissermaßen auf zwei Verteidigungslinien stützt. Recht früh in der Stammesgeschichte entwickelten sich Mechanismen der angeborenen Immunität. Dazu gehören Barrieren wie die Haut und die Schleimhäute, die mehr oder weniger rein physikalisch das Eindringen von Krankheitserregern in tiefere Gewebe und Organe verhindern sollen. Daneben gibt es ungezielte Mechanismen in Form von antimikrobiellen Molekülen, die zum Beispiel in unseren Hautzellen gebildet werden, oder allgemeine Entzündungsreaktionen, in deren Verlauf bestimmte Typen von weißen Blutkörperchen Mikroorganismen über die Phagozytose, eine Art von zellulärem Fressvorgang, aus dem Weg räumen. Diese Art der Immunantwort ist sehr schnell (sie beginnt innerhalb weniger Minuten nach einem mikrobiellen »Angriff«), aber nicht anpassungsfähig und selektiv. Einmal angelegt, ist die angeborene Immunabwehr nicht in der Lage, sich auf neue Gefahren einzustellen, die mit den vorhandenen Gegenmaßnahmen unter Umständen nicht beseitigt werden können. Glücklicherweise kommt mit der Entwicklung der Wirbeltiere die zweite Verteidigungslinie ins Spiel, die als adaptive Immunabwehr bezeichnet wird. Wie der Name schon sagt, findet hier eine Anpassung an neue Herausforderungen statt, und es wird zudem möglich, bereits bekannten Gefahren schneller, effektiver und gezielter zu begegnen. Obwohl nun die generelle »Erfindung« der adaptiven Immunantwort entwicklungsgeschichtlich ebenfalls lange zurückliegt, geht man heute davon aus, dass das menschliche Immunsystem maßgeblich durch die dramatischen Wendungen der neolithischen Revolution geprägt ist. In einem Dorf wie Atlit-Yam mussten die Jüngsten ganz selbstverständlich auch mit anpacken, und eine typische Aufgabe für die Kinder der frühen Siedler war das Hüten der Ziegenherden, was ihnen einen regelmäßigen und intensiven Kontakt zu den Tieren verschaffte. Vor allem aber ihre jüngeren Geschwister, die bei den Müttern in den Hütten blieben, atmeten praktisch mit dem ersten Tag ihres Lebens weniger die frische Luft des Mittelmeers als vielmehr den Staub der Kühe ein, die aufgrund der Wärme, die sie abgaben, gleich nebenan untergebracht waren. Nicht umsonst sind die meisten einfachen Behausungen bis in die Neuzeit so angelegt, dass sich Stall und Wohnräume unter einem Dach befinden.
Das intensive Zusammensein mit ihren Haustieren stellte die Menschen der Jungsteinzeit vor die große Herausforderung, mit neuen Krankheiten umzugehen, bescherte ihnen aber auch die bahnbrechende Chance, sie zu besiegen – mithilfe ihrer ureigenen, biologischen Ausstattung. Schließlich ist das Immunsystem der höheren Lebewesen in der Lage zu lernen, und so nutzte es den Kontakt mit Keimen, die von den Rindern in den Stallmist und in den Staub der Hütten gelangten, um Fresszellen und Antikörper zu bilden, die die Gefahr durch die neuen Infektionserreger abwehren sollten. Glücklicherweise sind ja nicht alle Mikroben so gefährlich wie die Tuberkulose. Viele Arten von Mykobakterien, die zum Beispiel in der Rohmilch von Kühen zu finden sind, lösen keine ernsten Krankheiten aus, sind aber dennoch ihren todbringenden Verwandten so ähnlich, dass das lernende Immunsystem an ihnen trainieren kann und es so im besten Fall in die Lage versetzt wird, auch gefährlichere Gegner auszuschalten. Tatsächlich waren es wohl in erster Linie die Mikroorganismen der Haustiere, die sich das menschliche Immunsystem im Neolithikum als Trainingspartner erwählt hat. Noch heute ist der Kontakt zu Tieren in der frühen Kindheit offenbar wichtig, um ein vernünftig funktionierendes Immunsystem entwickeln zu können.
Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Immunentwicklung von Homo sapiens kam allerdings aus einer völlig anderen Richtung: dem Neandertaler. Es ist mittlerweile unumstritten, dass beide Menschenarten eine ganze Weile nebeneinander existierten und sich auch miteinander fortpflanzten. Nachweislich stammen etwa 1,5 bis zwei Prozent des Genoms eines modernen eurasischen Menschen von Vorfahren der Spezies Homo neanderthalensis ab. Überraschenderweise jedoch findet sich bei den Genen des angeborenen Immunsystems ein deutlich höherer Anteil vom Erbe des Neandertalers. Im Lichte der Evolution gibt es dafür eine einfache Erklärung: Offenbar besaßen Menschen, die diese Gene in sich trugen, einen Vorteil im Kampf gegen die in der Jungsteinzeit wütenden Infektionen wie die Tuberkulose – und gaben diese genetische Information dann auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an ihre Nachkommen weiter.15
Das Immunsystem, das uns bis heute schützt, hat also seinen Ursprung in der Zeit der Sesshaftwerdung der Menschen und der Domestizierung unserer heutigen Haustiere. Dank dieser Anpassung ist die Menschheit bisher trotz aller Seuchen, die über sie gekommen sind, nicht ausgestorben. Tragischerweise aber waren und sind wir häufig dennoch nicht in der Lage, uns nur mithilfe der eigenen Immunantwort gegen Seuchenerreger zu wehren, und so ist unsere Geschichte immer wieder geprägt von großen Epidemien, die die betroffene Bevölkerung oft dramatisch dezimieren, aber auch in anderer Weise die Zivilisationsentwicklung beeinflussen.
Einem Team von Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte ist in diesem Zusammenhang ein ähnlicher Durchbruch gelungen wie zuvor Hershkovitz und Donoghue in Atlit-Yam: Sie isolierten bakterielle DNA aus mehr als fünfhundert Proben menschlicher Knochen und Zähne der späten Jungsteinzeit und Bronzezeit, die bei Ausgrabungen in Russland, im Baltikum, im Balkanraum und in Deutschland gefunden worden waren.16 Diesmal galt die Suche allerdings nicht der DNA von Tuberkuloseerregern, sondern der des Pestbakteriums Yersinia pestis. Dieses ist weit weniger widerstandsfähig und daher seltener in archäologischen Funden nachzuweisen – und dennoch war das Aufspüren dieser Infektionen, die etwa viertausend Jahre vor den großen Pestepidemien des Mittelalters auftraten, nicht die eigentliche Überraschung. Vielmehr fanden die Max-Planck-Forscher durch vergleichende Untersuchungen der Pestbakterien-DNA heraus, wie diese Krankheit sich im Europa der frühen Bronzezeit ausgebreitet haben muss. Im Kontext der ebenfalls herangezogenen humangenetischen Daten erscheint es am wahrscheinlichsten, dass die Pest vor etwa viertausendachthundert Jahren aus der kaspischen Steppe nach Europa kam – zusammen mit einem Strom menschlicher Einwanderer. Möglicherweise müssen viele Wanderungsbewegungen seit der Jungsteinzeit auch als Flucht vor den immer stärker wütenden Epidemien gedeutet werden. Die Menschen nahmen also vermutlich wahr, dass die Seuchen keine unabwendbare Strafe darstellten, sondern wollten sich ihnen durchaus entgegenstellen, wenngleich das einzig wirksame Mittel mit zumindest aufschiebender Funktion die Flucht gewesen zu sein scheint.
Ob die Menschen nun vor den Seuchen flohen oder die Seuchen mit den Wanderungsbewegungen mitgetragen wurden – bis heute ist die Ausbreitung von Infektionen ein Spiegel der menschlichen Mobilität und Vernetzung. Die Mutter aus Atlit-Yam und ihre Tochter konnten ihrem Schicksal nicht durch Flucht entkommen. Allerdings zeigt uns ihr Schicksal eindrücklich, dass der Kampf mit den Mikroben unter anderen Voraussetzungen und mit anderem Wissen bis heute andauert.
2 Der Zahnwurm des Assurbanipal
Als man Karies mit Bier und Sesamöl zu Leibe rückte und müttermordende Dämonen für Infektionen verantwortlich machte
Der Wurm kam weinend zum Sonnengott Samas und sprach: »Was gibst du mir zu essen, was gibst du mir, das ich vernichten kann?« Samas antwortete: »Ich werde dir getrocknete Feigen und Aprikosen geben.« Der Wurm erwiderte: »Was sind schon diese getrockneten Feigen für mich, oder Aprikosen? Setze mich zwischen die Zähne und lasse mich im Zahnfleisch wohnen, damit ich das Blut der Zähne zerstöre und das Mark des Zahnfleischs kaue.« Samas aber sprach: »Da du dies gesagt hast, o Wurm, möge dich der Wassergott Ea mit seiner mächtigen Faust schlagen!«1
Dieser bizarre Streit zwischen dem babylonischen Sonnengott und dem zahnzerstörenden Wurm ist festgehalten auf einer fast viertausend Jahre alten Keilschrifttafel aus der Bibliothek des Assyrerkönigs Assurbanipal. Und sie ist nichts weniger als die Niederschrift der ersten historisch verbürgten Annahme, dass Krankheiten durch so etwas wie Lebewesen verursacht werden können. Wir dürfen sogar weiter annehmen, dass auch die Babylonier davon ausgegangen sind, dass es sich um einen sehr kleinen Wurm gehandelt haben muss, auch wenn er im Text selbstbewusst mit Samas, dem Sonnengott, zu sprechen scheint. Schließlich dürfte auch damals niemand den »Zahnwurm« tatsächlich zu Gesicht bekommen haben. Umso erstaunlicher ist es, dass der Glaube, ein Wurm sei die Ursache für Zahnfäule, sich in vielen Regionen der Welt verbreitet und bis ins 19. Jahrhundert gehalten hat.2
Der unbestreitbar fiktiven göttlichen Auseinandersetzung zwischen Samas und dem Wurm lag vermutlich einmal mehr ein sehr reales menschliches Schicksal zugrunde. Wenn man der Zahnärztin Liselotte Buchheim glaubt, die 1964 einen vielbeachteten Artikel über die babylonische Interpretation der Kariesentstehung schrieb, handelte es sich bei dem zahnschmerzgeplagten Patienten um einen vornehmen und reichen Mann und bei dem Verfasser des Textes um einen heilkundigen Priester.3 Dieser hatte sogar eine Medizin parat: Mit Bier aus der damals sehr gebräuchlichen, dem Weizen verwandten Getreideart Emmer, geschrotetem Malz und Sesamöl sollte der Zahn beträufelt werden, um den Kranken von seiner Pein zu befreien, dazu wurde eine Beschwörungsformel gesprochen. Letzteres versprach in Kombination mit der eingesetzten Medikation göttlichen Beistand in Form der Faust des Wassergottes und damit möglicherweise einen zusätzlichen Placeboeffekt. Ob die medizinische Behandlung tatsächlich Erfolg brachte, ist allerdings nicht keilschriftlich überliefert.
Die Bibliothek des Königs Assurbanipal, aus der der Text über Entstehung und Heilung der Zahnschmerzen stammt, befand sich in der Stadt Ninive im heutigen Irak. Zur Zeit seiner Herrschaft, im 7. Jahrhundert vor Christus, war diese Beschreibung also bereits Tausende von Jahre alt und die Babylonier hatten bereits bedeutende Innovationen vorangetrieben, die bis heute ihre Gültigkeit haben. Sie erfanden die Schrift und das Zehnersystem auf Basis der zehn Finger, begannen das Jahr im Rhythmus der Mondphasen einzuteilen und benannten die Tage einer Woche nach den ihnen bekannten Planeten, der Sonne und dem Mond. Der siebte Tag war schon damals der Ruhetag, denn die Menschen in Mesopotamien betrachteten die Sieben als Unglückszahl und gingen daher an diesem Tag weder einer Arbeit nach noch fällten sie irgendwelche wichtigen Entscheidungen. Neben den kulturellen Errungenschaften, von denen hier nur einige genannt wurden, machten sich die Babylonier aber auch um Technik und Naturwissenschaft verdient, letztlich auch aus Sorge um die Gesundheit. Ein langes Leben wurde im Land zwischen Euphrat und Tigris nicht nur als Privileg, sondern auch als Indiz für einen vorbildlichen Lebenswandel angesehen. Starb jemand in jungen Jahren infolge eines Unfalls, einer Krankheit oder einer Hinrichtung, so galt dies als Strafe für seine Sünden. Während die letztgenannte Todesart zumindest auf ein gewisses Fehlverhalten des Delinquenten schließen lässt, müssen die assyrischen Gelehrten das eine oder andere Mal in tiefen Zweifel verfallen sein, wenn ein untadeliger Mann oder eine bestens beleumundete Frau vor der Zeit aus dem Leben gerissen wurde.
Eine gewisse Mitschuld konnte man immerhin den Göttern zuschreiben, zum Beispiel der besonders unsympathischen Dämonin Lamaštu, die dem babylonischen Glauben zufolge auf die Erde kam, nachdem sie – kaum verwunderlich – von den Göttern verstoßen worden war. Man darf sie sich als behaartes Mischwesen mit menschlichen und tierischen Attributen vorstellen. Auf einer im Louvre ausgestellten assyrischen Schutztafel besitzt die Gestalt einen weiblichen Oberkörper, an dessen hängenden Brüsten ein Schwein oder ein Hund saugt. Eine weitere alte Beschreibung ist nicht schmeichelhafter: »Sie ist wütend, wild und gefährlich, sie verbreitet Schrecken. Ihre Hände sind unrein, ihr Haar ist wirr, ihr Lendenschurz zerrissen, ihre Hände triefen von Fleischfetzen und Blut. Kriechend wie eine Schlange kommt sie zum Fenster herein. Sie kommt und geht in ein Haus, wie es ihr passt.«4
Insbesondere wurde Lamaštu mit Säuglingssterblichkeit und Kindbettfieber in Verbindung gebracht, aber auch mit Fieber im Allgemeinen. Die »Tilgerin«, wie sie im Atrahasis-Epos genannt wurde, weil ihre Aufgabe auch darin bestand, die ungehemmte Vermehrung der Menschheit einzudämmen, gelangte diesen Erzählungen nach häufig über die Abwasserrohre ins Haus einer Schwangeren, versteckte sich bis zur Geburt, um sich sodann als falsche Amme auszugeben, der Mutter das Kind zu entreißen und den Säugling durch ihr Gift zu töten. In einer anderen Überlieferung verseucht die Dämonin Mutter und Kind mit ihrem Atem.5
Interessanterweise brachten die Babylonier die Wirkungsstätte der Lamaštu mit Exkrementen und Unrat in Verbindung. Dies wiederum spricht dafür, dass damals bereits eine gewisse Vorstellung davon existiert haben dürfte, worin die Ursachen bestimmter Erkrankungen lagen. Erstaunlicherweise wurde aber gerade das Kindbettfieber noch im 19. Jahrhundert eher dem Wirken einer überirdischen Macht zugerechnet. Erst der Wiener Arzt Ignaz Semmelweis gelangte 1848 zu der Erkenntnis, dass es auf unhygienische Zustände bei der Versorgung der Wöchnerinnen zurückzuführen war. Nicht nur die Babylonier hatten hierin keinen Zusammenhang gesehen, auch Semmelweis’ Medizinerkollegen lehnten die Theorie, fehlende Handhygiene von Ärzten und Klinikpersonal sei verantwortlich für das Kindbettfieber, strikt ab.
Der Semmelweis-Reflex
Die hohe Sterblichkeit bei Frauen kurz nach der Entbindung wurde über Jahrtausende hinweg als unabänderliche Tatsache hingenommen. Lange Zeit schrieb man sie auch bösen Dämoninnen und anderen unheilbringenden Einflüssen zu. Im 19. Jahrhundert fand Ignaz Semmelweis allerdings eine einfache Erklärung für dieses vermeintlich unabwendbare Schicksal, indem er unhygienische Umstände bei der Niederkunft und bei der Versorgung der Wöchnerinnen als Ursache des Kindbettfiebers ausmachte und empfahl, vor der Untersuchung der Mütter die Hände mit Chlorkalk zu waschen.
Wie aber war er zu dieser Einsicht gelangt? 1840 hatte man in seiner Wiener Klinik die Hebammen- von der Ärzteausbildung getrennt. Semmelweis registrierte in der Folgezeit, dass auf den Stationen, auf denen die Ärzte geschult wurden, dreimal mehr Frauen im Kindbett starben als auf den Hebammenstationen. Bald machte er die unsauberen Hände der Mediziner dafür verantwortlich, die im Gegensatz zu den Hebammenschülerinnen regelmäßig Leichen untersuchten. Leider gelang es ihm nicht, die Kollegen von seiner These zu überzeugen: »An diesem Massaker sind Sie, Herr Professor, beteiligt«, schrieb er in einem seiner »offenen Briefe«, die er an zahlreiche Kollegen verschickte. »Das Morden muss aufhören, und damit das Morden aufhöre, werde ich Wache halten.«6 Ob es nur an dem rüden Ton lag, dass er keine Unterstützer fand, ist fraglich. Schließlich sieht sich niemand gerne im Unrecht (schon gar kein Experte). Dieser Umstand führt noch heute dazu, dass Innovationen in der Wissenschaftscommunity eher bestraft als belohnt werden – der sogenannte »Semmelweis-Reflex«.
Wie vernünftig mit Trinkwasser umzugehen sei, beschäftigte die Menschen aus dem Zweistromland dagegen sehr wohl. Eindrucksvoll kann man dies an den Ruinen der antiken Metropole Dur-Untasch bestaunen, die im heutigen Iran südöstlich der Stadt Susa zu finden sind. Das von einer Mauer geschützte, etwa hundert Hektar große Stadtgebiet wird noch immer von dem fünfundzwanzig Meter hohen Zikkurat, dem pyramidenartigen Turm in der zentralen Tempelanlage, überragt, der früher allerdings doppelt so hoch war. Die Gründung der Stadt Dur-Untasch war die bedeutendste überlieferte Tat des Königs Untasch-Napirischa, der die Region von 1275 bis 1240 vor unserer Zeitrechnung regierte.
Geologen entdeckten Dur-Untasch, das heute Tschoga-Zanbil heißt, als sie in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts in der Gegend nach Öl suchten. In den Jahren und Jahrzehnten danach wurden mehrere archäologische Expeditionen dorthin unternommen, die zwischen 1999 und 2005 in einer umfangreichen Forschungsarbeit im Auftrag der Unesco gipfelten. Das heutige Unesco-Weltkulturerbe Tschoga-Zanbil gab dabei zahllose Schätze preis, darunter Stiere und Greifen, modelliert aus Ton in halber Lebensgröße, oder eine silberne Kultaxt, verziert mit Löwenköpfen.7
Die bei Weitem wichtigste Entdeckung war jedoch der Fund eines Kanals, der in einem noch heute sichtbaren Auffangbecken endet. Dur-Untasch war zwar neben dem Fluss Dez errichtet worden, jedoch ist sein Flussbett tief eingeschnitten und der Grundwasserspiegel liegt für damalige Zeiten unerreichbare fünfzig Meter unter dem Erdboden. Somit bot der Kanal die beste Möglichkeit, die Einwohner der Stadt mit frischem Wasser zu versorgen. Aber damit nicht genug: Das Auffangbecken der Wasserzuführung war mit mehreren kleineren Becken verbunden, die das kostbare Nass anschließend in einem fein verzweigten System in die einzelnen Häuser führten. Auch wenn die genaue Funktion der verschiedenen Becken nach über dreitausend Jahren schwer zu deuten ist – diese Konstruktion gilt seither als die älteste Wasseraufbereitungsanlage der Welt.
Schwieriger noch als die Arbeitsweise dieser Anlage zu entschlüsseln ist es herauszufinden, was die Menschen zu einer solch ausgeklügelten Konstruktion motiviert haben könnte. Es ist zwar bekannt, dass in Mesopotamien schon lange zuvor die Bewässerung der Felder durch Kanäle und Deiche eine enorm große Rolle spielte und von Mitgliedern einer Priesterelite geplant, durchgeführt und überwacht wurde, aber die Trinkwasserversorgung einer Stadtbevölkerung ist nicht vergleichbar mit den Ansprüchen der Landwirtschaft. Während es bei Letzterer hauptsächlich auf die richtige Quantität ankommt, dürfte auch Herrschern wie Untasch-Napirischa bewusst gewesen sein, dass entscheidend für die Gesundheit der Bewohner die Qualität des Trinkwassers ist. Anders jedenfalls ist der Aufwand, mit dem die Wasserversorgung in Städten wie Dur-Untasch betrieben wurde, nicht zu erklären.
Wir können natürlich nicht annehmen, dass die damals als gebildet geltenden Schichten über die Ursachen von Krankheiten umfassend Bescheid wussten. Allerdings haben Menschen zu allen Zeiten gut beobachtet, experimentiert und sich eine Häufung positiver Ergebnisse fortan zunutze gemacht – das dürfte für Saatversuche der ersten Bauern ebenso gelten wie für die babylonischen Ärzte. Um 1500 vor unserer Zeit verfügten die Assyrer bereits über eine umfangreiche Sammlung von Heilmitteln für verschiedenste Erkrankungen.8 Insbesondere Durchfall und Darmprobleme schienen an der Tagesordnung zu sein: Die Heilkundigen in Mesopotamien verabreichten offenbar in nicht geringen Mengen Rizinusöl als Abführmittel, erhöhten mit Salzlösungen den Wassergehalt im Darm oder verordneten Kleie. Dem umfangreichen Einsatz von Drogen pflanzlichen und tierischen Ursprungs oder von Mineralien gemischt mit Öl, Bier, Wein, Milch oder Wasser, verabreicht als Pille, Salbe, Pflaster, Verband, Klistier oder in Form von Räucherungen und Dampfbädern, wurde in der Regel durch eine Beschwörung der Götter ergänzt, die für Ursache oder Heilung verantwortlich waren.
Darüber hinaus haben die Babylonier aber auch Hygiene im Sinne von Sauberkeit vorangetrieben: Auf einer viertausendfünfhundert Jahre alten sumerischen Tontafel ist das erste Rezept für Seife verewigt. Der Anleitung zufolge sollte Pottasche aus verbrannten Pflanzen genutzt werden, die zusammen mit Ölen zu einem Gemisch gekocht wurde. Bis ins 20. Jahrhundert, als man begann, synthetische Tenside herzustellen, blieb die Seifenherstellung vom Prinzip her fast unverändert. Die aus dem Kochvorgang entstehende Lauge war in der Lage, Fette in Wasser zu lösen und dadurch Oberflächen, aber auch die menschliche Haut effektiv zu reinigen – in diesem Fall ganz ohne göttliches Eingreifen.
Ob der religiöse Überbau von missgünstigen Göttern und kinderstehlenden Dämoninnen bei der Behandlung von Kranken hauptsächlich der Aufrechterhaltung einer staatlichen Ordnung durch Bereitstellung simpler Erklärungen für das einfache Volk diente oder auch dem Glauben der herrschenden Elite entsprach, kann heute nicht mehr beantwortet werden. Klar ist aber, dass die Beschäftigung mit Symptomatik und Interventionen bei Krankheiten und Seuchen recht bald nach der Sesshaftwerdung des Menschen zu erheblichen Fortschritten geführt und mit Sicherheit zur Blüte des Zweistromlandes im Altertum beigetragen hat.
3 Leben mit dem Nilfieber
Warum stehende Gewässer ideale Brutstätten für Stechmücken sind und Tutenchamun wohl eines der ersten Opfer der Malaria war
»Im Winter 1872–73 hielt ich mich mehrere Monate mit meinem Freunde Stern in Theben auf«, schrieb der Ägyptologe und Schriftsteller Georg Moritz Ebers zwei Jahre später nieder und berichtete vom wahrscheinlich wichtigsten Kauf seines Lebens: »Nachdem wir längere Zeit in einem der Gräber von Abd el Qurnah gewohnt und unsere Mappen mit Copieen und Abdrücken zum Theil von hohem Werthe gefüllt hatten, zogen wir wieder in unsere Dahabiah1 ein und verkehrten von dort aus vielfach mit den arabischen and koptischen Bewohnern von Luqsor. Ein wohlhabender Bürger dieses Fleckens zeigte mir häufig die Alterthümer, welche er nach und nach von den Fellah2 am anderen Nilufer erworben hatte. Eines Tages presentirte er mir einen von jenen funerären3 Texten, welche unter dem Namen des ›sai en sensen‹ bekannt sind, und eine Osiris-Statuette von Holz, in welcher ein Papyros wohlverborgen ruhte. Da er das zerbrechliche Manuscript sich nicht aufzurollen getraute, so berücksichtigte ich nur das ›sai en sensen‹ und machte den einen hohen Preis fordernden Besitzer darauf aufmerksam, dass mehrere ähnliche Texte bekannt wären. Uebrigens bemerkte ich, dass, wenn ich auch auf diesen Papyros nicht reflectiren könne, ich doch, wenn er mir nur etwas wirklich Schönes und Seltenes anzubieten habe, eine beträchtliche Summe auszugeben keineswegs scheue.«4
Die »beträchtliche Summe«, die Ebers sich nicht scheute auszugeben, dürfte umgerechnet etwa fünfundzwanzigtausend Euro betragen haben und war doch sicherlich gut angelegt. Das Schriftstück ist seither als »Papyrus Ebers« bekannt. Es handelt sich um eine über achtzehn Meter lange Rolle, die mit roter und schwarzer Tusche in einer den Hieroglyphen verwandten Schrift beschrieben war. Mindestens so bedeutend wie die Schönheit dieses dreitausendfünfhundert Jahre alten Manuskripts ist aber ohne jeden Zweifel sein Inhalt, denn Ebers hielt mit ihm die bis heute einzig komplett überlieferte Buchrolle zur Heilkunde Altägyptens in Händen.5
Der Papyrus Ebers enthält rund neunhundert verschiedene Rezepturen zur Heilung verschiedenster Erkrankungen und belegt eindrucksvoll den Sachverstand der alten Ägypter in Sachen Medizin. Viele der gesundheitlichen Probleme beschäftigen uns noch immer, seien es Magen- und Herzleiden, Krebserkrankungen (die einen erstaunlich weiten Raum einnehmen) oder der profane Schnupfen. Hinsichtlich Letzterem rät der Papyrus, Dattelsaft und Minze in die Nase zu träufeln oder auch folgende Beschwörungsformel anzuwenden:
»Fließe aus, Schnupfen, Sohn des Schnupfens, der die Knochen zerbricht, der den Schädel zerstört, der im Knochenmark hackt, der die sieben Höhlen schmerzen lässt im Kopf. Siehe, ich habe das gegen dich gerichtete Heilmittel gebracht, das gegen dich gerichtete Schutzmittel: Milch einer Frau, die einen Knaben geboren hat; Duftharz. Es wird dich beseitigen, es wird dich entfernen – und umgekehrt.«6
Immerhin: Dattelsaft und Minze zeugen von einer großen Affinität zu pflanzlichen Heilmitteln, von denen zahlreiche Varianten in verschiedenen medizinischen Schriften beschrieben werden. Bis heute sind viele der Pflanzen, die in den ägyptischen Papyrustexten erwähnt oder in botanischen Abbildungen dargestellt werden, aber auch die Reste von Pflanzenteilen, die als Grabbeigaben gefunden wurden, weder einer bekannten Art zuzuordnen noch kann die ihnen zugeschriebene Wirkung eindeutig belegt werden. Eine ganze Reihe von Heilpflanzen jedoch sind auch uns noch vertraut, und angeblich pflegen und bewahren einige Apotheken im modernen Kairo die jahrtausendealte Tradition der ägyptischen Phytomedizin weiterhin.
Allein der Papyrus Ebers präsentiert zahlreiche pflanzliche Heilmittel, die uns auch im heutigen Mitteleuropa bekannt vorkommen – oder denen wir zumindest zutrauen, mehr als nur magische Wirkung zu entfalten. Ob es sich nun um Akazienblätter gegen Würmer handelt oder um Zwiebeln, mit denen Entzündungen der Kampf angesagt wurde – hier scheint die altägyptische Medizin doch mehr als einen Placeboeffekt bewirkt zu haben.
Vereinzelt ist es sogar möglich, einen unzweifelhaften und pharmakologisch belegbaren Nutzen der Heilmittel aufgrund ihrer mittlerweile identifizierten Inhaltsstoffe und einer Dosis-Wirkungs-Beziehung festzumachen. Wenn beispielsweise Kreuzkümmel im antiken Ägypten verabreicht wurde, dann durchaus in einer Gabe, die heutigen Ansprüchen gerecht werden kann. Kreuzkümmel enthält verschiedene arzneilich wirksame Substanzen wie Cuminaldehyd, aber auch ätherische Öle oder Salicylate. Diese Inhaltsstoffe wirken antimikrobiell und schmerzlindernd. Die Ägyptologin und Pharmazeutin Tanja Pommerening hat einmal sehr anschaulich in einem ihrer Fachartikel nachgewiesen, dass die damals verabreichte Menge an Kreuzkümmel, die etwa einer Tagesdosis von sechshundert Milligramm entsprach, auch nach heutigen Maßstäben sinnvoll erscheint, und zwar sowohl hinsichtlich der erwünschten Wirkung als auch im Hinblick auf mögliche Nebenwirkungen oder toxische Effekte, die selbstverständlich auch und gerade in der pflanzlichen Naturheilkunde nicht vernachlässigt werden dürfen. Sie nimmt dieses und andere Beispiele als Beleg für das enorme Wissen der altägyptischen Ärzte.7
Auch wenn es den Anschein hat, als seien die Menschen des Alten Ägypten somit relativ gut gewappnet gewesen gegen Krankheiten und Infektionen, so war ihr Alltag doch bedroht von wiederkehrenden Gefahren, die ironischerweise genau mit dem verbunden waren, was das Leben dort im Grunde überhaupt erst möglich gemacht hat: dem Wasser. Ohne den Nil und seine Nutzung zur Bewässerung der Felder wären weite Teile des stolzen Pharaonenreichs Wüste geblieben und hätten keiner Hochkultur je die Grundlage zur Entfaltung geboten. Allerdings erwies sich der Fluss nicht nur als lebenswichtige Ader, es ging auch eine unheilvolle Bedrohung von ihm aus. Bereits in der Antike trat der Nil jedes Jahr über seine Ufer und bescherte dem Land die gefürchtete Seuche, die – offenkundig im Wissen um ihre Herkunft – auch Nilfieber genannt wurde.
Die Auswirkungen dieser Jahresseuche müssen wahrlich dramatisch gewesen sein. Der Gelehrte Ipuwer klagte vor etwa dreitausendsiebenhundert Jahren: »Die Seuche ist im Land. Blut ist überall. Es gibt keinen Mangel an Tod. Die zahlreichen Toten werden im Fluss begraben.«Beinahe zweitausend Jahre später schrieb der heilige Cyprian, Bischof von Karthago, über die auch zu seiner Zeit grassierende Seuche und schildert, wie ständiger Durchfall die Körperkräfte verzehrte, dass »das tief im Inneren lodernde Feuer immer weiter wütet und den wunden Schlund ergreift, dass fortwährendes Erbrechen die Eingeweide erschüttert, dass die Augen durch den Blutandrang sich entzünden, dass bei manchen die Füße oder andere Körperteile von zerstörender Fäulnis ergriffen und abgefressen werden, dass infolge der schweren Schädigung des Körpers durch die eintretende Ermattung der Gang gelähmt wird«. So zitiert Tanja Pommerening aus seinem Werk Über die Sterblichkeit8 und stellt natürlich die naheliegende Frage, was die Ursache für derartig verheerende Epidemien gewesen sein mag, die die Ägypter über Jahrtausende begleiteten und zu massenhaftem Sterben führten.
Vermutlich kamen mehrere Faktoren zusammen. Die mit dem Nil verbundenen Kanäle und Seen, die als stehende Gewässer bereits in der Antike überall in Ägypten zu finden waren, boten sich vielen Parasiten als Brutstätte an. In den Papyri ist von zahllosen Wurmerkrankungen, aber auch von Malaria die Rede. Das ist keine Überraschung, denn die Ursache dieser Infektion ist ein Einzeller namens Plasmodium, der einen recht komplexen Entwicklungszyklus durchläuft, an dessen Ende die Anopheles-Mücke steht. Nachdem sich nach einem Stich die Geschlechtszellen des Malariaerregers gepaart haben, werden sie durch einen weiteren Stich in das nächste Opfer injiziert. Weil die Mücke zum einen stehende Gewässer braucht, um ihre Eier abzulegen, und zum anderen eine bestimmte Temperatur, um den Winter zu überleben, kann man die Verhältnisse im jährlich überfluteten Nildelta durchaus als ideal für die Ausbreitung der Malaria bezeichnen. Unter ihren Opfern befand sich offenbar auch der Pharao Tutanchamun, über dessen frühen Tod man lange gerätselt hat. Im Jahr 2010 aber konnte ein Team von Wissenschaftlern des Supreme Council of Antiquities in Kairo bei der Untersuchung der Mumie des Königs das Erbgut verschiedener Krankheitserreger isolieren – darunter auch das von Plasmodium. Im Zusammenhang mit anderen Erkenntnissen aus dieser Untersuchung schlossen die Forscher, dass Tutanchamun wohl an den Folgen einer Malariainfektion gestorben sein muss.
Auch bei vielen anderen ägyptischen Mumien wurde die DNA des Malariaerregers nachgewiesen, sie legen die ältesten Zeugnisse dieser Infektion ab, die wir kennen.9 Wie Tutanchamun waren diese Menschen jung gestorben – vermutlich im Alter zwischen zwanzig und dreißig Jahren – und hatten wie dieser der Oberschicht angehört: ein beeindruckender Beleg dafür, dass keineswegs nur Arme und Alte von der Plage heimgesucht wurden. Erstaunlicherweise scheinen damals viele wohlhabende junge Menschen alles andere als gesund gewesen zu sein. Über die Ursache lässt sich nur spekulieren, es liegt aber nahe, dass die Ernährung im antiken Ägypten nicht vollwertig und vor allem der Genuss verunreinigten Trinkwassers weit verbreitet war – mit entsprechenden Folgen in Form von Magen-Darm-Erkrankungen, die, wenn man den medizinischen Papyri Glauben schenken darf, die Patienten wohl in großer Zahl zu Heilern trieb. Warum das hochentwickelte Reich am Nil so viel weniger sorgsam mit seiner Wasserversorgung umging als die Nachbarn an Euphrat und Tigris, bleibt ebenso unklar wie die dortige Technologie der Wasseraufbereitung im Einzelnen. Das bedeutet jedoch nicht, dass es in Ägypten keine Strategien gegen diese Bedrohungen gab. Natürlich durchdrangen die Ägypter die Ursachen des Nilfiebers und die Erkrankung an sich nicht umfassend, aber die Gefahr, die von unsauberem Wasser ausging, war ihnen sicher bewusst.
Dicke Luft
Das Wort Malaria kommt aus dem Italienischen. »Mala aria« bedeutet so viel wie »schlechte Luft« und wurde im 19. Jahrhundert von dem britischen Geologen John MacCullogh eingeführt.10 Zuvor wurde die Krankheit meist als »Sumpffieber« charakterisiert, weil schon in der Antike klar war, dass stehende Gewässer der Ursprung der Erkrankung waren. Bereits damals wusste man auch um das allgegenwärtige Übel der Stechmücken (nicht umsonst eine der biblischen Plagen), allerdings gerieten frühe Deutungen eines Zusammenhangs mit der Ausbreitung der Krankheit in Vergessenheit.
Die komplette Aufklärung des Phänomens – Mücken übertragen durch ihren Stich einen parasitären Erreger, der wiederum die periodisch auftretenden Fieberschübe auslöst – gelang in der Tat erst um 1900. Bis dahin harrten die Menschen in einer ungewissen Furcht vor wabernden Sümpfen und den Überschwemmungen »ihrer« Flüsse aus. Im antiken Rom war die Verwünschung »Quartana te tenea – das Fieber soll dich holen« einer der übelsten Flüche, die man aussprechen konnte.11 Auf die Idee, dass das fieberbringende Unheil in Form von Mückenlarven auch aus den Wasserbecken der kühlen Atrien im Zentrum der römischen Häuser emporstieg, kam offenbar niemand.
Was aber tun, wenn es gefährlich ist, Wasser zu trinken? In Analogie zu Marie Antoinettes Ausruf: »Wenn sie kein Brot haben, sollen sie Kuchen essen!« könnte man ergänzen: »Und wenn sie kein sauberes Wasser haben, sollen sie Bier trinken!« Nun ist das Bier vermutlich keine ägyptische Erfindung, sondern eher der langen Liste babylonischer Errungenschaften hinzuzufügen. Gerade die alten Ägypter aber huldigten, wie in zahllosen Abbildungen dargestellt, nicht nur dem Brot, das wohl als die unverzichtbare Basis ihrer Ernährung betrachtet werden muss, sondern auch dem vergorenen Getränk auf Getreidebasis.
Selbstverständlich ist uns der Gedanke nicht neu, Getreide mittels Gärung zu veredeln, sei es, um das mit Wasser vermischte Mehl über die sich bildende Kohlensäure in einen lockeren Teig zu verwandeln, sei es, um das gleichzeitig von der Hefe produzierte Ethanol zur Haltbarmachung der Würze zu nutzen. Bemerkenswert ist, dass einmal mehr von Mikroorganismen hervorgerufene Probleme die Ursache für eine menschliche Bemühung sind, Lebensmittel haltbarer zu machen. Angefangen hat es vermutlich damit, dass die jungsteinzeitlichen Bauern vor der Herausforderung standen, die neuerdings erzeugten – statt gesammelten – Lebensmittel sicher vor Schädlingen zu lagern. Bei der Anfertigung getöpferter Gefäße, die sich hierfür besonders gut eigneten, entwickelten sie eine hohe Kunstfertigkeit. Die Töpferscheibe – übrigens noch so eine entscheidende Erfindung der Mesopotamier.
Konservierung wird in der Regel definiert als die Verlängerung der Haltbarkeit von Produkten durch die Verzögerung von biologischen und chemischen Umsetzungsprozessen. Anders als es die wörtliche Übersetzung aus dem Lateinischen suggeriert, ging es den Menschen aber nicht nur um den reinen Erhalt des Status quo, sondern auch um einen Schutz vor äußeren, und das bedeutet vielfach: biologischen Einflüssen. Die sichtbare und unsichtbare Bedrohung durch Parasiten und Krankheitserreger muss seit jeher eine zentrale Triebfeder für die Entwicklung von Maßnahmen zur Konservierung von Lebensmitteln gewesen sein. Welch ein Segen, wenn die Milch in Form von Joghurt oder Käse über einen ungleich längeren Zeitraum verzehrt werden kann, wenn nicht modriges Wasser, sondern frisches Bier den Durst zu löschen vermag und wenn die Gemüseernte nicht nach wenigen Tagen verfault, sondern durch Vergärung angesäuert auch noch im Winter satt macht und Vitamine liefert! Selbst wenn der Schutz vor Verderbnis in der Regel nicht als Schutz vor Infektionen oder Lebensmittelvergiftung verstanden wurde, so werden doch – wie auch in der Medizin – Beobachtung und Empirie dazu geführt haben, dass im Laufe der Jahrtausende bis hinein in die Hochkulturen des Zweistromlandes und des ägyptischen Reiches die Bedeutung dieser Verfahren für das Überleben mehr und mehr in das Bewusstsein der Menschen drang.





























