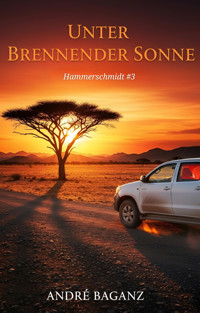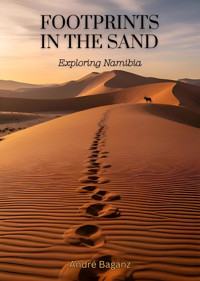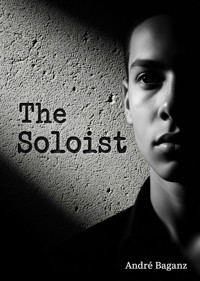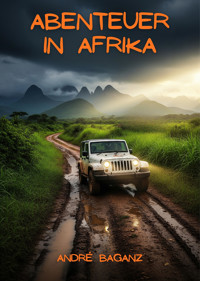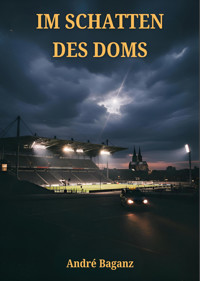Unter Brennender Sonne
Hammerschmidt #3
André Baganz
Copyright © 2025 André Baganz
Alle Rechte vorbehalten.Covergestaltung mit: Canva
Impressum
André Baganz c/o autorenglück.de
Franz-Mehring-Str. 15
01237 Dresden
Die Hochzeit
DIE BASTEI WAR in ein warmes, goldenes Licht getaucht. Die Sonne ging langsam unter und warf ihre letzten Strahlen auf den Rhein, der glitzerte wie ein mit Diamanten besetzter Teppich. Das Gebäude war festlich geschmückt: Überall hingen weiße und goldene Girlanden, und die Tische waren mit eleganten Blumenarrangements dekoriert, die einen zarten Duft verströmten. Die Atmosphäre war magisch, fast wie in einem Märchen.
Die Gäste wurden von sanftem Klavierspiel begrüßt. Frauen in eleganten Abendkleidern und Männer in ihren besten Anzügen erfüllten den Raum. Die Vorfreude und Aufregung auf das Brautpaar waren fast greifbar.
Thomas Ammerung, der Vater der Braut, stand am Eingang und begrüßte jeden Gast persönlich. Er war ein stattlicher Mann in den Fünfzigern, dessen graumeliertes Haar und maßgeschneiderter Anzug ihm eine Aura von Autorität verliehen. Neben ihm stand seine Frau, elegant in einem smaragdgrünen Kleid, das ihre schlanke Figur betonte. Beide lächelten warm und einladend. »Willkommen, schön, dass Sie da sind«, sagte er immer wieder, während er Hände schüttelte und Umarmungen austauschte.
Ich stand mit Guido in einer Ecke des Raumes. Von dort aus beobachteten wir das Treiben. Später gesellte sich Thomas Ammerung zu uns. »Schön, dass Ihr es einrichten konntet«, sagte er und schüttelte unsere Hände. Seine Augen funkelten vor Freude, aber man konnte auch eine Spur von Erschöpfung darin erkennen.
»Danke für die Einladung«, sagte Guido mit breitem Lächeln, während ich zustimmend nickte. »So eine Feier lässt man sich doch nicht entgehen.«
»Es ist eine wunderbare Feier«, sagte ich. »Da haben Sie ganz schön was auf die Beine gestellt.«
Thomas Ammerung seufzte und nahm einen Schluck aus seinem Sektglas. »Was macht man nicht alles für seine einzige Tochter. Ich muss aber sagen, dass ich froh bin, wenn dieser ganze Stress endlich vorbei ist.«
Ich nickte verständnisvoll. »Ich kann mir vorstellen, dass das alles eine Menge Arbeit war. Aber es hat sich gelohnt. Schauen Sie sich nur an, wie glücklich alle sind.«
In diesem Moment öffneten sich die großen Flügeltüren, und das Brautpaar trat ein. Tabea, die Braut, in einem atemberaubenden weißen Kleid mit einer langen Schleppe, strahlte vor Glück. Ihr langes, blondes Haar war zu einer eleganten Hochsteckfrisur gebunden, und ihr Lächeln ließ den Raum noch heller erscheinen. Finn, der Bräutigam, trug einen klassischen schwarzen Anzug. Er hielt Tabeas Hand fest und lächelte ebenfalls. Man konnte die Liebe und das Glück in ihren Augen sehen.
»Da sind sie ja«, sagte Thomas Ammerung und hob sein Glas. »Auf das Brautpaar!« Ihm war anzusehen, wie stolz er auf seine Tochter war.
Die Gäste stimmten in den Toast ein, und ein lautes »Prost!« erfüllte den Raum.
Tabea und Finn gingen von Tisch zu Tisch, um ihre Gäste persönlich zu begrüßen und sich für ihr Kommen zu bedanken. »Es ist so schön, dass ihr alle hier seid«, sagten die beiden, schüttelten Hände und tauschten Umarmungen aus.
Die Feier begann, und die Gäste genossen das exquisite Buffet, das aus einer Vielzahl von internationalen Gerichten bestand. Es gab alles von Sushi über italienische Antipasti bis hin zu traditionellen deutschen Spezialitäten. Die Desserttische waren mit kunstvoll dekorierten Torten, Pralinen und Obstarrangements bestückt, die wie kleine Kunstwerke aussahen.
Später, als die Musik lauter wurde und sich die Tanzfläche füllte, hatte ich Gelegenheit, ein paar Worte mit Tabea zu wechseln. Sie war eine außergewöhnlich schöne Frau. Ich hatte viel über sie gehört und kannte sie vom Sehen. Wirklich unterhalten hatten wir uns aber noch nie. »Mein Name ist Max Hammerschmidt«, stellte ich mich vor.
»Ich weiß«, sagte Tabea. »Mein Vater hat mir von Ihnen erzählt. Sie sind der Privatdetektiv. Das hört sich spannend an. Ich könnte mir vorstellen, dass das manchmal auch ziemlich gefährlich ist. Ist es das?« Sie zog ihre perfekt gezupften Augenbrauen hoch und blickte mich fragend an.
»Manche Aufträge sind totlangweilig«, sagte ich. »Da heißt es viel Warten und auf der Lauer liegen. Andere Aufträge sind interessant und einige beinhalten auch Action. Und die ist manchmal nicht ganz ungefährlich, da haben Sie recht.«
»Das interessiert mich«, sagte Tabea. Mir gefiel ihre natürliche Art. Sie war ein Mensch, der einem sofort vertraut war. Sie überlegte einen Moment, dann sagte sie: »Erzählen Sie mir von Ihrem letzten Fall.«
Ich musste schmunzeln ob ihrer fast kindlichen Wissbegierde, die ich jedoch gern befriedigte. »Meinen letzten Fall habe ich innerhalb von ein paar Stunden abgeschlossen. Am Morgen erhielt ich einen Anruf von einer Frau, die ihren Mann der Untreue verdächtigte. Ich wohne mit meiner Tochter seit geraumer Zeit in Eupen. Zufälligerweise rief die Frau aus Aachen an. Ich bin direkt dorthin gefahren und habe die Ermittlungen aufgenommen. Zugegeben, es war auch etwas Glück dabei. Ich hatte noch nicht lange vor dem Arbeitsplatz des Mannes auf der Lauer gelegen, als er das Gebäude verließ. Ich folgte ihm und er führte mich direkt zu seiner Geliebten. Ich machte Fotos und übergab sie am späten Nachmittag an meine Auftraggeberin. Das war’s.«
»Hört sich einfach an«, sagte Tabea und verzog ihren hübschen Mund. »Die Frau tut mir leid. Ich hoffe, dass ich Sie deswegen nicht irgendwann anheuern muss.« Sie schmunzelte als Zeichen, dass die Aussage nicht ganz ernst gemeint war.
»Und was machen Sie?«, fragte ich.
»Oh, ich habe meinen Bachelor in Sportwissenschaften und meinen Master in Sportjournalismus an der Deutschen Sporthochschule hier in Köln gemacht. Jetzt bin ich freie Mitarbeiterin bei verschiedenen Sportmagazinen.«
»Hört sich interessant an«, sagte ich.
»Das ist es auch. Die Arbeit macht mir riesigen Spaß. Es ist das, was ich immer tun wollte.«
»Es ist schön, wenn man seine Träume verwirklichen kann«, sagte ich. »Und wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt?«
»Bei einer Veranstaltung der Sporthochschule«, sagte Tabea. »Die Firma, für die Finn arbeitet, war fürs Catering verantwortlich.«
In diesem Moment trat der Bräutigam an uns heran. »Finn, das ist Max Hammerschmidt«, stellte Tabea mich vor. »Er ist Privatdetektiv.«
Finn reichte mir die Hand. Es war offensichtlich, dass er kein großes Interesse an meiner Person hatte, was ich ihm in Anbetracht der Umstände aber nicht übel nahm. »Komm, Schatz! Wir müssen noch ein paar Gäste begrüßen«, sagte er und zog Tabea mit sich.
Für mich persönlich entschied ich, dass die beiden vom Optischen her ein eigenartiges Paar waren. Man stellte sich automatisch die Frage, was die wunderschöne Tabea an dem relativ kleinen, zur Dicklichkeit neigenden Finn fand. Ich verbat mir selbst allerdings jegliche Wertung, denn Menschen können auch von innen her schön sein. Und vielleicht traf ja das auf Finn zu.
Später, als der Alkohol die Zungen gelöst hatte, gesellte sich Thomas Ammerung erneut zu Guido und mir auf die Terrasse. Die Luft war kühl und frisch, und man hatte beim Sprechen weiße Wolken vor dem Mund. »Ich muss mit dir reden, Guido«, sagte Thomas Ammerung ernst, während er auf den Fluss hinausschaute. Dabei schien es ihn nicht zu stören, dass ich anwesend war. Obwohl Guido sein Angestellter war, hatten die beiden eine spezielle Beziehung.
Guido blickte ihn neugierig an. »Natürlich, Thomas Ammerung. Was gibt’s?«
Thomas Ammerung stieß einen tiefen Seufzer aus und fuhr sich mit der Hand durch das graumelierte Haar. »Es geht um Finn. Ich will ihm nichts unterstellen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er Tabea nicht nur aus Liebe, sondern auch aus finanziellen Gründen geheiratet hat.«
Guido blickte seinen Boss erstaunt an. »Wie kommst du denn darauf?«
Thomas Ammerung zuckte mit den Schultern. »Es ist ein Gefühl, eine Ahnung. Ich kann’s gar nicht so genau erklären. Er macht manchmal so komische Andeutungen. Ich weiß nicht. Und warum musste er ihren Namen annehmen, als ob er sich für seinen eigenen schämt…« Er starrte einen langen Moment schweigend auf die Wasseroberfläche. Dann fügte er hinzu: »Tabea ist unser Ein und Alles, und der Gedanke daran, dass sie verletzt werden könnte, ist für meine Frau und mich unerträglich.«
Guido nickte verständnisvoll. »Ich bin bei dir, Thomas Ammerung. Du bist ihr Vater und machst dir Sorgen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Aber ich bin mir sicher, dass du mit Finn als Schwiegersohn einen Volltreffer gelandet hast. Ich kenne ihn nicht, aber er macht einen sympathischen Eindruck. Das mit dem Namen würde ich nicht überbewerten. Es ist heutzutage nicht selten, dass ein Mann den Namen von seiner Frau annimmt. Dafür gibt’s verschiedene Gründe … Wie lange sind die beiden jetzt zusammen?«
»Nur ein halbes Jahr«, sagte Thomas Ammerung. »Das ist auch ein Punkt, der mir Sorgen bereitet. In sechs Monaten lernst du eine andere Person nicht wirklich kennen.«
»Es gibt sowas wie Liebe auf den ersten Blick«, sagte Guido, offensichtlich bemüht, die Bedenken seines Chefs zu zerstreuen. »Zwei Menschen finden sich, die für einander gemacht sind. Die brauchen sich nicht groß kennenzulernen.«
Thomas Ammerung starrte einen langen Moment vor sich hin und winkte schließlich ab. »Vielleicht hast du recht. Wahrscheinlich bilde ich mir das alles nur ein oder bin nur ein überfürsorglicher Vater.« Er schmunzelte.
»So wird’s sein«, sagte Guido ebenfalls schmunzelnd. Dann wechselte er das Thema. »Wohin geht die Hochzeitsreise?«
»Nach Südafrika«, sagte Thomas Ammerung. »Oder besser gesagt ins südliche Afrika.«
»Hui!« Guido stieß einen anerkennenden Pfiff aus. »Das wird bestimmt ein Erlebnis.« Er deutete auf mich. »Max hier war lange in Afrika.«
Ich nickte. »Allerdings nicht im südlichen Afrika, sondern in West- und Zentralafrika.«
Thomas Ammerung schaute zu mir herüber. »Waren Sie geschäftlich da?«
»Kann man sagen«, sagte ich. »Ich war ein paar Jährchen bei der Fremdenlegion.«
»Wow!« Thomas Ammerung stutzte. »Hab’ ich gar nicht gewusst. Das interessiert mich. Wir zwei müssen uns irgendwann mal richtig unterhalten.«
Ich nickte. »Gerne.«
»Wie sind die beiden auf Südafrika gekommen?«, fragte Guido.
»Hat ihnen ihr gemeinsamer Freund, Hendrik, empfohlen«, sagte Thomas Ammerung.
»Der Trauzeuge?«, fragte Guido.
Thomas Ammerung nickte. »Ja. Er kommt aus Südafrika. Das Weingut seiner Familie ist der Hauptlieferant von der Cateringfirma, für die Finn arbeitet. Er hat die Reise geplant und organisiert. Die beiden besuchen das Weingut seiner Familie in der Nähe von Kapstadt und fahren dann mit einem Mietwagen zuerst durch Südafrika, dann rüber nach Namibia und von dort nach Botswana. Insgesamt sind sie acht Wochen unterwegs.«
»Da ist er ja«, sagte Guido und blickte auf die große Glasscheibe hinter uns.
Wir schauten alle in den Saal und sahen, wie Hendrik, ein junger Mann von Anfang 30 mit blonden Strähnchen in der stylischen Frisur, gerade mit Tabea vorbeitanzte. Mein Blick blieb an ihm hängen. Er lachte – aber es war kein warmes Lachen, kein echtes Strahlen. Sein Blick blieb starr, wie poliertes Glas, als würde etwas Kaltes, Berechnendes direkt hinter der Oberfläche lauern. Als Tabea sich wegdrehte, erlosch das Lächeln abrupt. Für einen Sekundenbruchteil blitzte etwas in seinen Augen auf – nicht Wut, nicht Gier, sondern diese Art von leerer Präzision, mit der ein Schachspieler den nächsten Zug plant. Zumindest hatte ich diesen Eindruck. Doch ich schüttelte die Gedanken ab. Was wusste ich schon über ihn? Ein Fremder, ein Freund des Brautpaares – nichts weiter.
Wir standen noch eine Weile schweigend da und schauten auf den glitzernden Rhein, während drinnen die Feier weiterging und das Lachen und die Musik die Nacht erfüllten. Eine Kölschband hatte die Bühne betreten und spielte fröhliche Lieder, die die Gäste zum Mitsingen animierten.
»Mir wird langsam kalt hier draußen«, sagte Guido irgendwann und legte seine Hände gleichzeitig auf Thomas Ammerung’ und meine Schulter. »Lasst uns wieder reingehen.«
Wir gingen gemeinsam zurück in den Saal. Guidos Worte hatten Thomas Ammerung die Sorgen in Bezug auf seinen Schwiegersohn vergessen lassen, und er gab sich dem Zauber des Abends hin. Wir beobachteten das Brautpaar. Ihre Gesichter strahlten vor Freude, und es war offensichtlich, dass sie den Moment in vollen Zügen genossen.
»Schaut euch die beiden an«, sagte Guido. »Ein Traumpaar. Ich wette, es wird alles gut.«
Thomas Ammerung nickte.
Die Lodge
DIE SONNE SANK blutrot über die endlose Savanne. Ihr letztes Licht warf lange Schatten über den rostroten Staub der Schotterpiste. In der Ferne kreisten Geier in trägen Kreisen, als würden sie etwas erwarten – oder jemanden. Ein schwarzer SUV mit getönten Scheiben rollte langsam auf das schmiedeeiserne Tor der abgelegenen Lodge zu, dessen Stachelranken im Abendlicht wie Krallen wirkten. Rostige Flecken an den Eisenstäben zeugten davon, dass hier schon länger niemand mehr nach Schönheit, sondern nur nach Funktion strebte.
Vor dem Tor stand ein bewaffneter Wächter, das Gewehr lässig über der Schulter, die Augen hinter einer Sonnenbrille verborgen. Sein Hemd, khakifarben, war an den Achseln dunkel von Schweiß durchtränkt. Als das Fahrerfenster herunterfuhr, beugte er sich in den Wagen – ein kurzer, prüfender Blick, dann ein langsames, wissendes Lächeln, als er den Mann auf dem Rücksitz erkannte. Ohne ein Wort drehte er sich um und hob die Hand. Ein surrendes Geräusch, dann öffnete sich das Tor mit einem dumpfen Klick, als würde sich das Maul eines Raubtiers auftun.
Der SUV glitt die lange, von Kameldornbäumen gesäumte Auffahrt entlang, vorbei an versteckten Kameras und einem zweiten, unsichtbaren Posten, der aus dem Schatten eines Akazienbaums beobachtete. Das Knacken eines Zweigs verriet seine Anwesenheit, doch als der Fahrer dorthin blickte, war nur noch das leise Rascheln der Blätter zu hören. Vor dem Hauptgebäude reihten sich Luxusgeländewagen, ihre Chromleisten glänzten fahl im letzten Licht des Tages. Der Parkwächter, eine schweigsame Gestalt mit eisigem Blick, dirigierte den Wagen mit präzisen Handbewegungen – wie ein Schachspieler, der seine Figuren positioniert.
Der Motor verstummte, der Fahrer stieg aus und öffnete die Tür für den Mann auf dem Rücksitz: schwarz wie Ebenholz, korpulent, in einem maßgeschneiderten Anzug, der zu teuer wirkte für diese Einöde. Sein Gesicht war glattrasiert, die Hände schwer von goldenen Ringen, aber sein Lächeln war kalkuliert, nicht warm. Bevor er die Treppe zum Eingang hinaufstieg, warf er einen Blick zurück – nicht aus Nervosität, sondern als würde er prüfen, ob alles unter Kontrolle war. Irgendwo in der Ferne heulte ein Schakal, ein einsames, durchdringendes Geräusch, das im selben Moment erstarb, als hätte es sich selbst zum Schweigen gebracht.
Am Eingang wartete ein Türsteher mit bulligem Nacken und verschränkten Armen. Sein linkes Ohrläppchen war durchtrennt, eine alte Narbe, die von Kämpfen erzählte, über die niemand sprach. Als er den Mann sah, nickte er kaum merklich. Kein Wort, nur ein kurzes Sie werden erwartet, das im Raum stand, bevor sich die schwere Holztür lautlos hinter ihm schloss.
Der Raum war in gedämpftes, gelbliches Licht getaucht, das von einer schweren bronzenen Stehlampe ausging. Die Wände, mit dunklem Mahagoni verkleidet, schienen jeden Laut zu schlucken. Der Geruch von Zigarrenrauch und altem Leder hing in der Luft, durchsetzt mit einem säuerlichen Unterton – wie verdorbener Wein oder Schweiß.
Am anderen Ende des Zimmers saß ein hagerer, alter, weißer Mann mit scharf geschnittenem Profil hinter einem massiven Schreibtisch aus afrikanischem Ebenholz. Seine Haut war sonnengegerbt. Sein pechschwarz gefärbtes Haar wirkte wie eine schlecht sitzende Maske. Die Ärmel seines weißen Leinenhemds waren bis zu den Ellbogen hochgekrempelt, darunter zeichneten sich bläuliche Tätowierungen ab – verblasste Symbole aus einer anderen Zeit, einem anderen Leben. Eines davon glich einer Schlange, die sich um sein Handgelenk wand, als würde sie es zuschnüren. »Ah, mein Freund.« Seine Stimme war rau, als hätte sie zu viele Jahre Whiskey geschluckt. Er erhob sich nicht, sondern lehnte sich nur zurück, die Finger zu einem Dach gefaltet. »Ich dachte schon, du hättest dich verirrt.« Ein Lächeln, das keine Wärme trug, eher die Andeutung einer Drohung.
Hinter dem Mann erstreckte sich eine riesige Einwegspiegelscheibe, die den Blick auf die große Bar freigab. Dort bewegten sich blutjunge afrikanische Mädchen an Tanzstangen zur Musik, die stark gedämpft auch in dem Büro zu hören war, während sich ausnahmslos weiße Männer jeden Alters, Alkohol trinkend und rauchend, amüsierten. Ganz im Gegensatz zu den Mädchen, deren Blicke ausdruckslos waren. Sie funktionierten einfach und wirkten wie leere Hüllen, als hätte man ihnen etwas genommen, das nie zurückkehren würde.
Der Schwarze warf einen kurzen Blick dorthin, dann wieder zurück zu seinem Gastgeber. »Verirren?« Seine Stimme war tief, fast belustigt. »Auf deinem Grundstück? Das wäre unklug.«
Der Alte griff nach einem Kristallglas, schenkte zwei Fingerbreit Amber-Flüssigkeit ein – kein Angebot, nur eine Geste der Macht. »Unklug, ja.«
Plötzlich durchbrach ein schriller Schrei die gedämpfte Musik, die aus der Bar in das Büro drang. Beide Männer wandten ihre Köpfe gleichzeitig in Richtung des Einwegspiegels, wo sich eine tumultartige Szene abspielte. Ein Gast, offensichtlich betrunken und mit rot angelaufenem Gesicht, packte eines der Mädchen und schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Schlag hallte durch den Raum, gefolgt von einem Aufschrei des Mädchens, das versuchte, sich zu befreien. Ihre Augen waren weit aufgerissen, eine Mischung aus Angst und Schmerz, als würde sie begreifen, dass es keinen Ausweg gab.
Sofort stürmte ein bulliger Sicherheitsmann herbei. Mit groben Griffen packte er das Mädchen am Arm und zerrte es von dem Gast weg. Das Mädchen wehrte sich, schrie und versuchte, sich loszureißen, aber der Sicherheitsmann war zu stark. Er zog sie rücksichtslos durch die Menge, die sich teilweise umdrehte, um das Spektakel zu beobachten, aber niemand griff ein. Die anderen Mädchen an den Tanzstangen bewegten sich weiter mit ausdruckslosen Gesichtern, als wäre dies ein alltägliches Ritual, das sie längst verinnerlicht hatten.
Der alte Mann beobachtete die Szene mit einem kühlen, fast gleichgültigen Blick. Er lehnte sich zurück und nahm einen Schluck aus seinem Glas. Dann sagte er: »Dieses Mädchen hat schon öfter Schwierigkeiten gemacht. Immer wieder weigert sie sich, die Anweisungen zu befolgen. Jetzt ist das Maß voll. Vor Jahren hatte ich mal eine. Die war mit Abstand mein bestes Pferd im Stall. Aber sie war aufmüpfig, und ich musste mich leider von ihr trennen. Die hier sieht nicht mal halb so gut aus.« Er machte eine resignierende Geste. »Sie ist ohnehin zu alt – fast achtzehn.«
Der Schwarze hob eine Augenbraue und grinste schief. »Was passiert jetzt mit ihr?«
Der Alte zögerte, als ob er überlegte, wie viel er preisgeben sollte. Dann sagte er in einem kalten Ton: »Das willst du nicht wissen. Aber so viel kann ich dir verraten: Sie wird entsorgt. Wir haben immer ein paar Mädchen in Reserve. Eine von denen wird ihren Platz einnehmen. Jünger, fügsamer.«
Der Schwarze nickte langsam, als ob er die Logik dahinter verstand. Er ließ sich langsam in den Ledersessel vor dem Schreibtisch sinken, ohne eingeladen worden zu sein. »Dann lass uns reden«, sagte er.
Der Alte musterte ihn, dann lächelte er – diesmal mit allen Zähnen. »Du kommst immer direkt zum Geschäft. Genau deshalb mag ich dich.« Seine Hand verschwand unter dem Schreibtisch. Ein kaum hörbares Summen und der Spiegel verdunkelte sich zu einer undurchdringlichen Wand.
»Wann willst du die zweite Lodge eröffnen?«, fragte der Schwarze.
Der Alte dachte kurz nach. »Die Arbeiten sind so gut wie abgeschlossen. Ich schätze, Ende des Monats wird es so weit sein. Sie wird dann unter dem Management meines Neffen stehen. Das ist zumindest der Plan. Er kommt in zwei Wochen aus Deutschland zurück.«
»Mhm.« Der Schwarze nickte, als Zeichen, dass er aufmerksam zuhört. »Hast du genug Mädchen?«
Der Alte schüttelte leicht verärgert den Kopf. »Leider nicht, aber wir arbeiten daran. Das Problem ist, dass wir vorsichtig sein müssen. Wenn ab und zu mal ein Mädchen verschwindet, fällt das nicht groß auf. Aber wenn sich so etwas häuft, wird zu viel Staub aufgewirbelt. Und das können wir nicht gebrauchen. Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren in diesem Geschäft, und ich habe jedes Risiko gemieden. Damit bin ich immer gut gefahren.«
»Dein Risiko ist auch mein Risiko«, sagte der Schwarze, dessen Schädel im Licht der Stehlampe glänzte. »Wegen der Mädchen brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Die Sache habe ich voll im Griff. Es gibt zwar inzwischen eine Sonderkommission, die sich nur mit den Entführungsfällen beschäftigt – ich musste sie einrichten, das ließ sich nicht vermeiden – aber sie wird von einer Person geleitet, die so gut wie keine Erfahrung hat.«
Der Alte nickte zufrieden.
»Einziger Schwachpunkt der ganzen Operation sind meiner Ansicht nach die Gäste«, sagte der Schwarze. »Hast du keine Bedenken, dass irgendwann mal jemand von denen zu viel redet?«
Der alte Mann lachte leise – ein Geräusch, das eher einem Zischen glich. »Unsere Gäste sind handverlesen. Jeder, der hier ist, ist absolut vertrauenswürdig. Diese Lodge existiert offiziell nicht – unsere Website findet nur, wer weiß, wo er suchen muss. Abgesehen davon haben wir uns persönlich von der, nennen wir es Perversität der Gäste, überzeugt. Wir haben belastendes Material gegen jeden einzelnen in der Hand … falls es mal Komplikationen geben sollte. Dahingehend mache ich mir überhaupt keine Sorgen.«
»Dann bin ich ja beruhigt«, sagte der Schwarze.
»Es versteht sich von selbst, dass sich unsere Geschäftskonditionen ändern, sobald ich die neue Lodge eröffnet habe«, sagte der Alte mit einem aufgesetzten Lächeln. Er hielt plötzlich einen Briefumschlag in der Hand, den er über die glatte Oberfläche des Schreibtischs hinüber zur anderen Seite schob.
Die dunklen Augen seines Gastes verweilten einen Moment auf dem Umschlag. Schließlich streckte er den Arm aus und nahm ihn an sich. Er öffnete ihn und warf einen Blick hinein.
»Das ist ein kleiner Vorgeschmack«, sagte der Alte. »Ich hoffe, du bist damit zufrieden.«
Der Schwarze nickte kaum merklich. »Das ist okay«, sagte er und ließ den Umschlag in die Innentasche seines Jacketts gleiten.
Der Alte griff nach einem leeren Glas und füllte es mit der gleichen Amber-Flüssigkeit, die bereits in seinem Glas war. Dann schob er das Glas über den Tisch und salutierte. »Auf unsere Zusammenarbeit!«
Der Schwarze nahm das Glas und salutierte ebenfalls.
Beide Tranken.
Der Alte bediente wieder die Fernbedienung, und der Einwegspiegel wurde erneut durchsichtig. »Da das Geschäftliche erledigt ist, können wir jetzt zum gemütlichen Teil des Abends übergehen«, sagte er. »Ich habe etwas ganz Besonderes für dich.« Er nahm sein Handy zur Hand und wählte. »Jetzt«, war das einzige Wort, das er sagte.
Einen Moment später wurde ein Mädchen von einer älteren Dame zur Bar geführt. Als einer der Gäste sie ansprechen wollte, machte die Dame ihm mit einer Geste verständlich: jetzt nicht.
Der Alte blickte seinen Gast fragend an. »Was hältst du von ihr? Sie ist mein neuestes Pferd im Stall. Und wenn du willst, kannst du es quasi einreiten. Ein spezielles Geschenk für dich.«
Der Schwarze schaute. Es war offensichtlich, dass das Mädchen nicht älter als 14 war. Sie war eine ausgesprochene Schönheit, mit großen, dunklen Augen, die jedoch leer wirkten, als wäre sie schon lange nicht mehr wirklich da. Ihr Haar war zu kunstvollen Zöpfen geflochten, aber an ihrem Handgelenk blitzte ein dünnes Metallarmband auf – kein Schmuck, sondern etwas, das wie eine Markierung wirkte.
Der Schwarze fuhr sich mit der Zunge über die wulstigen Lippen, während er sie lüstern musterte. »Ein Geschenk«, murmelte er. »Das ist wirklich großzügig von dir.«
Ankunft in Kapstadt
NACH FAST 12-stündiger Flugzeit stiegen Finn und Tabea am späten Nachmittag aus dem Flugzeug und atmeten tief die warme Luft von Kapstadt ein. Es duftete nach Meer und wildem Strandgras. Die beiden waren voller Vorfreude, ihre müden Glieder streckend, während die südafrikanische Sonne sie mit wohliger Wärme umfing. Nachdem sie die Einreiseformalitäten erledigt und ihr Gepäck vom Förderband geholt hatten, gingen sie zum Ausgang, wo bereits das Stimmengewirr dutzender Reisender und wartender Angehöriger auf sie einströmte.
Tabea erblickte ihn als Erste: einen großen, dunkelhäutigen Mann. Sein Lächeln war so warm wie das Klima, und er hielt ein handbeschriebenes Schild mit ihrem Namen in die Höhe. »Willkommen in Kapstadt!«, rief er mit einer tiefen, melodischen Stimme, als die beiden auf ihn zutraten. »Und ich wünsche Ihnen natürlich ein Frohes und Gesundes Neues Jahr.«
»Vielen Dank, das wünschen wir Ihnen auch«, sagte Tabea und spürte, wie ihre Müdigkeit langsam der Aufregung wich. »Wir freuen uns so sehr, hier zu sein.«
»Ich bin Johannes«, stellte sich der Mann vor und rückte seine Baseballkappe zurecht. »Ich arbeite für den Shuttle-Service Ihres Hotels.« Er streckte seine kräftige Hand aus und schüttelte erst Tabeas, dann Finns Hand mit einem festen, aber freundlichen Griff. »Wie war der Flug?«
»Lang und ermüdend«, gestand Tabea mit einem kleinen Lachen, während sie ihre Schultern kreisen ließ. »Aber wir sind so aufgeregt, endlich hier zu sein. Das ist unsere Hochzeitsreise.«
Johannes’ Augen leuchteten. »Das ist ja wunderbar. Herzlichen Glückwunsch!«, rief er und klatschte sogar einmal in die Hände. »Kapstadt ist ein fantastischer Ort für eine Hochzeitsreise. Habt Ihr schon Pläne, was Ihr alles sehen wollt?«
»Wir haben vor, eine Rundreise in einem Geländewagen durch Südafrika, Namibia und Botswana zu machen«, erklärte Tabea, während Johannes ihr Gepäck mit routinierten Bewegungen in den Kofferraum des silbernen Vans lud. »Aber als Erstes werden wir ein Weingut besuchen. Das ist hier ganz in der Nähe.«
»Hört sich fantastisch an«, sagte Johannes und schloss die Heckklappe mit einem befriedigenden Klick. »Ich beneide euch. Die Weingüter hier sind etwas ganz Besonderes – und die Sonnenuntergänge zwischen den Reben sind magisch.«
Im Auto setzte sich die kontaktfreudige Tabea auf den Beifahrersitz, während Finn sich hinten breitmachte und die Beine ausstreckte. Kaum waren sie losgefahren, da setzte Tabea die Unterhaltung mit Johannes auch schon fort. »Wie lange arbeitest du schon als Fahrer für das Hotel?«
»Seit etwa drei Jahren«, antwortete Johannes und warf ihr einen kurzen Blick zu, bevor er sich wieder auf den Verkehr konzentrierte. »Es ist ein toller Job, ich treffe viele interessante Menschen aus der ganzen Welt – und höre die verrücktesten Geschichten.«
»Hast du Familie, Johannes?«
»Ja, eine wundervolle Frau und zwei kleine Energiebündel«, sagte Johannes stolz und zückte sein Handy, um ihr schnell ein Foto zu zeigen. »Meine Tochter ist sieben und mein Sohn fünf. Die beiden halten meine Frau und mich ganz schön auf Trab.«
Tabea betrachtete das Bild der lachenden Kinder und spürte ein warmes Gefühl in ihrer Brust. »Wir hoffen auch, eines Tages Kinder zu haben.«
Johannes nickte verständnisvoll. »Kinder sind wirklich ein Segen … Wart Ihr schon mal in Südafrika?«
Tabea schüttelte den Kopf. »Nein, es ist das erste Mal. Wir sind so gespannt. Hast du einen Lieblingsort in Kapstadt, den du uns empfehlen könntest?«
Johannes überlegte kurz, während er an einer Ampel hielt. »Oh, da gibt’s einige. Der Tafelberg ist natürlich ein Muss, und die V&A Waterfront ist auch sehr schön – besonders abends, wenn die Lichter angehen. Aber mein persönlicher Favorit ist der Kirstenbosch National Botanical Garden. Der ist einfach atemberaubend, besonders wenn die Proteas blühen.«
»Wir werden auf jeden Fall versuchen, dorthin zu gehen«, versprach Tabea. »Und was machst du in deiner Freizeit, Johannes?«
»Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie und gehe gerne wandern«, antwortete er, während er wieder anfuhr. »Die Natur hier in Südafrika ist einfach unglaublich. Letztes Wochenende waren wir am Lion’s Head – der Blick von dort oben bei Sonnenaufgang ist unbeschreiblich.«
»Das kann ich mir vorstellen«, sagte Tabea. »Wir freuen uns schon sehr darauf, dein Land zu erkunden.«
»Ich kann garantieren, dass es ein unvergessliches Abenteuer wird«, sagte Johannes und fügte mit ernsterer Stimme hinzu: »Seid nur vorsichtig und haltet euch an die Sicherheitsvorschriften, besonders in den Nationalparks. Die Tiere sind wild – kein Selfie mit den Löwen, ja?«
Tabea lachte. »Oh, ja, das werden wir auf jeden Fall tun. Vielen Dank für den Tipp, Johannes.«
Während sich die beiden auf den Vordersitzen weiter angeregt unterhielten, lehnte sich Finn entspannt zurück und genoss die Aussicht auf die vorbeiziehende Stadt. Die Straßen von Kapstadt waren lebendig und bunt: Straßenkünstler spielten Trommeln, Händler boten frisches Obst an, und über allem lag das fröhliche Stimmengewirr der Einheimischen. Die majestätische Silhouette des Tafelbergs erhob sich im Hintergrund und verlieh der Stadt eine fast surreal schöne Kulisse.
Als sie am Hotel ankamen, half Johannes ihnen, das Gepäck aus dem Auto zu holen. »Ich wünsche euch einen wunderschönen Aufenthalt und eine unvergessliche Reise«, sagte er zum Abschied und drückte Finn noch einmal kräftig die Hand.
»Vielen Dank, Johannes«, sagte Tabea und gab ihm ein Trinkgeld von 10 Euro. »Wir werden deine Empfehlungen auf jeden Fall berücksichtigen.«
Voller Vorfreude auf die kommenden Abenteuer betraten die beiden das Hotel. Die Lobby war elegant eingerichtet, mit hohen Decken, kunstvollen Kronleuchtern und einem riesigen Blumenarrangement in der Mitte des Raumes. Eine hübsche Frau an der Rezeption begrüßte sie mit einem strahlenden Lächeln. »Willkommen im Cape Grace Hotel. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise«, sagte sie, während sie die Reservierung überprüfte. »Ihr Zimmer ist bereit. Es befindet sich im fünften Stock, mit einem herrlichen Blick auf den Hafen.« Dann überreichte sie ihnen die Schlüsselkarte. »Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns anzusprechen.«
Tabea und Finn fuhren mit dem Aufzug in den fünften Stock und betraten ihr Zimmer, das luxuriös und komfortabel eingerichtet war. Große Fenster boten in der Tat einen atemberaubenden Blick auf den Hafen, wo die Segelboote im Wind tanzten, und den Tafelberg im Hintergrund, der jetzt im goldenen Licht der untergehenden Sonne erstrahlte. Auf dem Tisch stand ein Willkommensgruß in Form einer Flasche Champagner und einer Schale mit frischem Obst – Mangos, Trauben und eine exotische Frucht, die sie nicht gleich erkannten.
»Das ist einfach perfekt«, seufzte Tabea, während sie die Aussicht genoss. »Ich kann es kaum erwarten, unsere Fahrt mit dem Geländewagen zu beginnen.«
»Ich auch«, stimmte Finn zu und trat hinter sie, um sie zu umarmen. »Auf den Besuch des Weinguts freue ich mich ganz besonders.« Er drehte sie sanft zu sich und zog sie in eine liebevolle Umarmung. Sie küssten sich leidenschaftlich, während draußen die ersten Lichter der Stadt aufblinkten. Dann öffnete er die Champagnerflasche mit einem befriedigenden Pop und füllte zwei Gläser. »Auf uns und die Abenteuer, die vor uns liegen!«
Sie stießen an und genossen den Moment der Ruhe und des Glücks, bevor sie sich aufmachten, die Stadt zu erkunden – bereit für alles, was kommen würde.
Der Enkeltrick
WIE JEDEN MORGEN seit der Wiedervereinigung mit meiner Tochter erwachte ich mit Vorfreude auf den kommenden Tag. Das vertraute Geräusch von Anne-Maries Schritten im Flur war der beste Wecker. Während ich in der Küche unser Frühstück zubereitete, duftete es nach frischem Kaffee und Toast, und von nebenan drangen die Geräusche aus dem Badezimmer – Wasserrauschen, Schränkeklappen – herüber.
»Papa, hast du meine Lieblingsmarmelade gefunden?«, rief Anne-Marie, als sie mit noch feuchten Haaren aus dem Bad in die Küche trat und sich auf ihren Stuhl fallen ließ.
»Natürlich, mein Schatz! Sie steht schon auf dem Tisch«, sagte ich und stellte ihren dampfenden Kakao, frisch aus der Mikrowelle, vor sie hin. Das süße Aroma mischte sich mit dem des Kaffees.
»Danke, Papa. Du bist der Beste.« Ein warmes Lächeln huschte über ihr Gesicht, während sie ihr Brot mit der dunkelroten Erdbeermarmelade bestrich.
Ich blickte zu ihr hinüber, und ein vertrauter Schwall Zufriedenheit durchflutete mich. Das war es. Mein Leben war perfekt. Meine Arbeit als Privatdetektiv erfüllte mich nach wie vor, doch ich hatte mir eine unerschütterliche Maxime auferlegt: »Du nimmst keinen Auftrag an, bei dem du am Abend nicht wieder zu Hause bei deiner Tochter bist.«
Alle Fälle, die ich seit dem Umzug von Köln nach Eupen angenommen hatte, waren mehr oder weniger Routineangelegenheiten – vermisste Personen, Ehebruch, Diebstahl, gelegentlich ein kleiner Betrug. Damit war ich ausgelastet und, solange ich pünktlich zum Abendessen da war, vollkommen zufrieden.
Nachdem Anne-Marie das Haus verlassen hatte, um zur Schule zu gehen, bereitete ich mich auf den Tag vor. Die Routine war beruhigend, doch ein leichter Druck lastete auf mir: Momentan arbeitete ich an einem Fall, der anfing, mir Kopfschmerzen zu bereiten – der Fall Peeters.
Drei Tage zuvor hatte ich den Anruf erhalten.
»Detektei Hammerschmidt, was kann ich für Sie tun?«, meldete ich mich wie üblich.
»Guten Tag, Herr Hammerschmidt, mein Name ist Charlotte Peeters. Ich... ich bräuchte dringend Ihre Hilfe«, sagte eine angespannte, leicht zitternde Frauenstimme auf Französisch.
»Natürlich. Worum geht’s, Frau Peeters?« Ich schaltete auf Lautsprecher und griff instinktiv nach Stift und Notizblock.
»Es geht um meinen Mann«, presste sie hervor, und ihre Stimme sank zu einem Flüstern herab: »Ich glaube … er betrügt mich.«
»Das ist leider ein häufiger Grund für einen Anruf hier«, sagte ich mitfühlend, während ich den Namen notierte. »Wie kommen Sie darauf? Können Sie mir konkrete Anhaltspunkte nennen?«
»Mein Mann hat eine Werkstatt bei uns im Keller. Sein Reich. Normalerweise gehe ich dort nicht hin, aber vor kurzem musste ich runter, eine defekte Glühbirne in der Waschküche wechseln... und da habe ich ein zweites Handy entdeckt. Versteckt hinter Werkzeugkisten.«
»Das muss nicht unbedingt ein Indiz für eine Affäre sein«, gab ich zu bedenken. »Haben Sie ihn nach dem Handy gefragt?«
»Nein, das traue ich mich nicht!« Ihre Stimme klang gehetzt. »Dann wüsste er, dass ich unten in seinem Heiligtum war … und das mag er überhaupt nicht. Aber das mit dem Handy ist nicht alles, Herr Hammerschmidt. Er benimmt sich in letzter Zeit so seltsam. Verschlossen. Als ob er mir etwas Schwerwiegendes verheimlichen will. Wir hatten schon mal eine Ehekrise, vor Jahren. Damals war mein Mann spielsüchtig. Er hat uns fast in den finanziellen Ruin getrieben. Wir haben das überstanden, aber... so etwas könnte ich nicht noch einmal durchstehen. Ich würde daran zerbrechen. Deshalb... ich muss wissen, woran ich bin. Können Sie meinen Mann beobachten? Beschatten? Das machen Sie doch, oder?«
»Genau davon lebe ich, Frau Peeters«, bestätigte ich. »Wenn Sie es wünschen, kann ich Ihren Mann observieren. Von wo aus rufen Sie an?«
»Aus Lüttich.«
»Okay«, sagte ich entschlossen. »Dann schlage ich vor, wir treffen uns persönlich und besprechen alles Weitere im Detail. Heute noch?«
Eine Stunde später saßen wir in einem Café in einem Lütticher Vorort, fernab vom touristischen Trubel. Charlotte Peeters entsprach der nervösen Stimme am Telefon: eine attraktive Frau in den Vierzigern mit elegant geschnittenen Haaren, doch ihre Augen waren gerötet und geschwollen, als hätte sie die ganze Nacht geweint. Sie umklammerte ihre Kaffeetasse wie einen Rettungsring.
»Bitte, Herr Hammerschmidt«, sagte sie mit erstickter Stimme und schob mir ein Foto über den klebrigen Tisch. »Ich muss die Wahrheit wissen. Ich halte diese Ungewissheit nicht mehr aus.«
Auf dem Bild war ein unscheinbarer Mann mit vollem, nach hinten gekämmtem Haar zu sehen, Mitte fünfzig, mit einem Blick, der wenig preisgab.
»Keine Sorge, Frau Peeters«, versuchte ich, sie zu beruhigen, während ich das Foto einsteckte. »Ich werde herausfinden, was Sache ist. Vielleicht gibt es eine harmlose Erklärung für alles. Geben Sie mir bitte eine Liste der Orte, die Ihr Mann regelmäßig aufsucht, und seine genauen Arbeitszeiten. Alles, was hilft.«
Nachdem sie mir mit zittriger Hand Adressen und Zeiten notiert hatte, verließ sie das Café, ihre Schultern von Sorge gebeugt. Ich wartete einen Moment, trank meinen Kaffee aus und machte mich dann direkt auf den Weg zum Arbeitsplatz ihres Mannes. Es war ein tristes, graues Bürogebäude in einem heruntergekommenen Industriegebiet am Stadtrand. Ich parkte mein Auto mit guter Sicht auf den Haupteingang und schaltete das Radio ein. Die Wartezeit begann.
Stunden später, kurz vor Feierabend, tauchte er endlich auf. Jacques Peeters, vom Foto gut wiederzuerkennen, wenn auch der dunkle Anzug ihn etwas besser kleidete als erwartet. Er wirkte wie ein Mann, der einfach nur nach Hause wollte. Ohne einen Blick nach links oder rechts zu werfen, stieg er in seinen silbergrauen Renault und fuhr zügig davon. Ich folgte ihm in angemessenem Abstand durch den abendlichen Berufsverkehr bis zu einem ordentlichen Einfamilienhaus in einem ruhigen Vorort. Er verschwand im Haus.
Ich rief seine Frau an. »Er ist gerade heimgekommen, Herr Hammerschmidt«, meldete sie sich leise. »Und ist gleich wieder in den Keller verschwunden. Ich glaube nicht, dass er heute noch rauskommt.« Damit war mein erster Observationstag beendet. Auch die nächsten beiden Tage verliefen unspektakulär wie ein Uhrwerk: Morgens zur Arbeit, abends direkt nach Hause, kein Abstecher, kein verdächtiges Treffen.
Am dritten Tag verließ ich das Haus mit der vagen Hoffnung, dass sich endlich etwas bewegen würde. Wieder parkte ich gegenüber von Peeters' Arbeitsstätte. Diesmal wurde ich nicht enttäuscht. Schon deutlich früher als sonst verließ er das Gebäude, hastigen Schrittes. Er stieg in seinen Wagen und fuhr los – nicht in Richtung seines Vororts, sondern hinein ins pulsierende Stadtzentrum von Lüttich. Mein Puls beschleunigte sich leicht. Er fuhr in ein mehrstöckiges Parkhaus. Ich folgte ihm im Abstand eines Fahrzeugs hinein und parkte zwei Ebenen höher. Dann ging ich zu Fuß, die Betonrampen hinab, immer darauf bedacht, ihn im Blick zu behalten.
Peeters schlenderte scheinbar entspannt, aber mit klarem Ziel durch die belebten Gassen, bis er ein kleines, unscheinbares Café betrat. Dort steuerte er zielstrebig auf einen Tisch im hinteren Bereich zu, an dem bereits eine Frau saß. Sie war schlank, trug Jeans und ein helles Top, ihre langen dunklen Haare waren zu einem praktischen Pferdeschwanz gebunden. Sie wirkte deutlich jünger als er, schätzungsweise um die dreißig.
Die beiden begrüßten sich mit einer Umarmung – nicht innig, aber auch nicht distanziert. Aus der Geste allein ließ sich keine Affäre ablesen. Vielleicht Kollegen? Verwandte?
Ich setzte mich rasch an den Nebentisch, getrennt nur durch einen schmalen Gang und eine hohe Pflanzenbank, und bestellte einen Kaffee. Ich schlug eine Zeitung auf, doch meine ganze Aufmerksamkeit galt dem leisen Gespräch nebenan, das auf Französisch geführt wurde.
»Du kannst dir nicht vorstellen, wie sie von ihrer Enkeltochter schwärmt«, sagte die Frau mit einer leichten Unbekümmertheit in der Stimme. »Für die Kleine würde sie durchs Feuer gehen, davon bin ich überzeugt. Sie hatte gestern ihre Fahrprüfung, und nächste Woche will sie ihr ein Auto schenken! Das Geld dafür hat sie zu Hause, in einem Safe im Schlafzimmer. Eine Viertelmillion, mindestens. Sie hat kürzlich fast ihr ganzes Geld abgehoben, weil sie den Banken nicht mehr traut.« Sie nippte an ihrem Espresso.
Peeters überlegte einen Moment, sein Blick glitt prüfend durch das Café. Dann nickte er knapp. »Gut. Wir machen es morgen. Und du bist dir absolut sicher, dass du die Stimme der Enkelin imitieren kannst?«
»Absolut«, sagte die Frau selbstbewusst. Dann wechselte sie mühelos in einen hohen, mädchenhaften Tonfall: »Omi? Omi, ich bin’s... ich brauche deine Hilfe, ganz dringend! Du musst mir helfen, bitte!«
Ein kurzes, kühles Kichern folgte von beiden.
»Wir werden diesmal richtig absahnen«, sagte die Frau und legte ihre Hand für einen Moment auf Peeters' Arm. »Und dann nichts wie weg hier. Endlich.«
Peeters nickte erneut, ein flüchtiges, gieriges Funkeln in seinen Augen. »Wenn alles glatt läuft... ja.«
»Was soll schon schiefgehen?«, erwiderte die Frau lässig und leerte ihren Espresso.
Am nächsten Tag verließ Peeters sein Büro erneut viel zu früh. Die Spannung in mir stieg. Ich folgte seinem silbergrauen Renault durch die Nachmittagssonne, diesmal in ein ruhiges, von alten Bäumen gesäumtes Wohnviertel. Er parkte vor einem gut gepflegten Einfamilienhaus mit rosafarbenen Rosen vor dem Eingang.
Kurz darauf ging die Haustür auf, und dieselbe schlanke Frau mit dem Pferdeschwanz trat heraus. Sie trug eine einfache Jeansjacke und warf einen schnellen Blick die Straße hinauf und hinunter, bevor sie zu Peeters in den Wagen stieg. Doch statt sofort loszufahren, blieben sie sitzen.
Was planen sie jetzt? Ich wartete, die Hände fest um das Lenkrad geklammert, die Augen abwechselnd auf das Haus und den Renault gerichtet.
Nach etwa zwanzig Minuten öffnete sich die Fahrertür. Peeters stieg aus, eine schlichte schwarze Aktentasche in der Hand. Er ging mit entschlossenen Schritten auf das Haus zu und klingelte.
Die Tür öffnete sich einen Spalt, dann weiter. Ich konnte nur eine Silhouette erkennen. Ein kurzer Wortwechsel, dann trat Peeters ein. Die Tür schloss sich hinter ihm.
Fünf lange Minuten, in denen nichts geschah. Dann öffnete sich die Tür wieder, und Peeters trat heraus. Er hatte die Aktentasche noch immer in der Hand, doch sie schien jetzt voller, schwerer. Als er die Treppe hinabstieg, breitete sich ein zufriedenes, fast triumphierendes Lächeln auf seinem Gesicht aus. Die letzten Schritte zum Auto ging er sichtlich zügiger, fast eilig, als wollte er den Ort so schnell wie möglich hinter sich lassen.
Eine eisige Ahnung durchfuhr mich.
Kaum war der Renault um die Ecke verschwunden, stieg ich aus und ging zügig auf das Haus zu. Auf dem blankpolierten Messingschild neben der Tür stand: Dubois.
Ich klingelte.
Kurz darauf öffnete eine ältere Dame, vielleicht Mitte siebzig, mit freundlichen Augen. »Ja, bitte?«
»Guten Tag, Frau Dubois«, sagte ich so ruhig und freundlich wie möglich und zeigte meinen Detektivausweis. »Mein Name ist Hammerschmidt, ich bin Privatdetektiv. Darf ich fragen, was der Herr, der gerade bei Ihnen war, von Ihnen wollte?«
Die Dame zögerte einen Moment, schien meine Seriosität abzuwägen, und antwortete dann: »Das war ein Herr von der Polizei.«
»Von der Polizei?«, wiederholte ich mit betonter Überraschung.
»Ja, genau«, bestätigte sie. »Er hat die Kaution für meine Enkeltochter abgeholt. Sie hat leider einen Verkehrsunfall verursacht, und die Beamten brauchten die Sicherheit in bar. Er war sehr korrekt, hat mir sogar eine Quittung gegeben.« Sie wirkte erleichtert, dass die Sache erledigt war.
Jetzt fügten sich die Puzzleteile zusammen. Ein eiskalter Schauer lief mir den Rücken hinab. »Frau Dubois«, sagte ich vorsichtig, aber deutlich. »Ich fürchte, ich muss Ihnen eine schlechte Nachricht überbringen. Sie sind Opfer eines Betrugs geworden. Dieser Mann war kein Polizist.«
Frau Dubois' Augen weiteten sich schockartig. »Wwwas? Aber… das kann doch nicht sein!« Ihre Hand flog an die Brust. »Der wusste doch alles! Den Namen meiner Enkelin, wo sie wohnt, dass sie gerade erst ihre Fahrprüfung hatte! Und ich habe doch selbst mit meiner Enkeltochter am Telefon gesprochen! Sie hat mir ausdrücklich gesagt, ich soll ihm das Geld geben, damit sie nicht ins Gefängnis muss!« Ihre Stimme wurde schrill vor Empörung und aufkeimender Panik.
»Das ist der Trick, Frau Dubois«, erklärte ich geduldig. »Der sogenannte Enkeltrick. Die Frau, die Sie am Telefon für Ihre Enkelin hielten? Das war mit Sicherheit eine Komplizin, die ihre Stimme täuschend echt nachgemacht hat. – Rufen Sie Ihre Enkelin jetzt bitte an. Sofort. Ich wette, sie wird Ihnen sagen, dass bei ihr alles in bester Ordnung ist und sie von diesem Vorfall nichts weiß.«
Frau Dubois starrte mich an, die Farbe wich aus ihrem Gesicht. Dann verschwand sie im Haus, wobei sie die Tür schloss.
Ich wartete. Die Rosen dufteten plötzlich beklemmend süß. Nach etwa drei Minuten, die sich wie eine Ewigkeit anfühlten, ging die Tür wieder auf. Frau Dubois stand da, leichenblass. Ihre Lippen zitterten so stark, dass sie Mühe hatte, die Worte hervorzubringen: »Sie... Sie haben recht. Sie... sie ist wohlauf.« Tränen schossen ihr in die Augen, und ein ersticktes Schluchzen entrang sich ihrer Kehle. Sie sackte gegen den Türrahmen. »Das... das waren 270.000 Euro«, stammelte sie zwischen den Tränen. »Mein ganzes Erspartes... alles, was ich hatte... für den Pflegeplatz...« Ihre Beine gaben nach.
Schnell trat ich näher und fing sie stützend auf. »Fassen Sie sich, Frau Dubois. So schlimm es ist, Sie haben Glück im Unglück.« Ich half ihr vorsichtig auf einen Stuhl im Flur. »Ich kenne den Namen dieses Mannes und weiß, wo er wohnt. Sie werden Ihr Geld zurückbekommen. Das verspreche ich Ihnen. Ich werde jetzt direkt die nötigen Schritte einleiten.«
Sie blickte mich mit tränenverschleierten Augen an, in denen sich ein winziger Funke Hoffnung regte. »Wirklich? Sie können das?«
Ich nickte entschlossen. »Ja. Setzen Sie sich irgendwo hin. Trinken Sie etwas. Ich komme so bald wie möglich zurück. Mit Ihrem Geld.«
Ein erleichterter, zitternder Seufzer entwich ihr. Ich drehte mich zum Gehen, hielt aber nach ein paar Schritten noch einmal inne. »Eine Frage noch, Frau Dubois. Wer war die Frau, die vorhin aus Ihrem Haus kam? Die jüngere mit dem Pferdeschwanz.«
»Äh … welche Frau?«, fragte sie verwirrt, dann fiel es ihr ein. »Oh! Sie meinen Monique? Das ist meine Pflegekraft. Sie kommt dreimal die Woche, hilft mir im Haushalt.«
»Und haben Sie Monique viel von sich erzählt? Von Ihrer Familie? Ihren Plänen? Ihren Ersparnissen?«
Frau Dubois dachte kurz nach, dann nickte sie langsam, und ein neues Entsetzen malte sich auf ihrem Gesicht. »Ja... ja, natürlich. Wir haben oft geplaudert. Sie war immer so nett und interessiert...«
»Die beiden arbeiten zusammen«, stellte ich klar. »Monique hat ihrem Komplizen alles über Sie erzählt. Deshalb wusste er so genau Bescheid. Deshalb klappte der Trick.« Ein letztes verständnisvolles Nicken, dann verließ ich das Haus und ging schnell zu meinem Wagen.
Nur wenige Minuten später stand ich vor der Haustür der Peeters. Der silbergraue Renault stand in der Einfahrt. Ich klingelte energisch.
Herr Peeters öffnete. Sein Lächeln vom Nachmittag war verschwunden, ersetzt durch leichtes Stirnrunzeln. »Ja?«
»Ich bin Privatdetektiv Hammerschmidt«, sagte ich mit fester Stimme und zeigte erneut meinen Ausweis. »Und Ihre Frau, Herr Peeters, hat mich engagiert.«
Mein Gegenüber schaute mich völlig verständnislos an. »Meine Frau? Engagiert? Wofür?«
»Eigentlich, weil sie Sie verdächtigte, eine Affäre zu haben«, erklärte ich knapp. »Ob diese Befürchtung zutrifft, kann ich nicht mit letzter Sicherheit sagen. Das ist etwas, das Sie Ihrer Frau selbst beichten sollten.« Ich fixierte ihn. »Für mich ist das allerdings inzwischen zweitrangig geworden. Angesichts dessen, was ich gerade gesehen habe.«
Peeters schluckte sichtlich. Seine Hand umklammerte den Türrahmen. »Was... was haben Sie denn gesehen?«
»Ich habe gesehen, wie Sie eine alte Dame namens Dubois um ihr gesamtes Erspartes gebracht haben. 270.000 Euro. Den sogenannten Enkeltrick. Sehr geschickt inszeniert, muss ich sagen. Zusammen mit Ihrer Komplizin Monique.«
Peeters erbleichte. Er stammelte etwas von einem Missverständnis, von Polizeiarbeit, aber ich fuhr ihn scharf an: »Sparen Sie sich die billigen Ausreden. Das Spiel ist aus.«
In diesem Moment kam Charlotte Peeters neugierig aus dem Wohnzimmer zur Tür. Sie erstarrte, als sie mich sah. »Herr Hammerschmidt? Was... was geht hier vor sich? Jacques?« Ihr Blick wanderte ängstlich zwischen mir und ihrem Mann hin und her.
»Ob Ihr Mann eine Affäre hat oder nicht, wird er Ihnen hoffentlich selbst erzählen«, sagte ich zu ihr, ohne Peeters aus den Augen zu lassen. »Leider ist er in etwas verwickelt, das viel schlimmer ist als ein Seitensprung.«
Frau Peeters' Augen weiteten sich. »Wovon redet er, Jacques?«
Peeters biss sich nervös auf die Unterlippe, der Schweiß stand ihm auf der Stirn. Er schwieg.
»Geben Sie mir das Geld. Jetzt«, forderte ich ihn unmissverständlich auf. »Den Rest regeln Sie dann mit Ihrer Frau. Und mit der Polizei.«
Peeters starrte mich an, ein innerer Kampf war in seinem Gesicht zu lesen. Dann, mit einem resignierenden, fast unhörbaren Seufzer, nickte er. Er machte kehrt und ging die wenigen Schritte zur geschlossenen Kellertür. Einen Schlüsselbund aus der Tasche ziehend, öffnete er sie und verschwand in der Dunkelheit.
»Was hat er getan, Herr Hammerschmidt?«, fragte Charlotte Peeters mit bebender Stimme. Ihre Hände umklammerten sich gegenseitig.
»Ihr Mann ist ein Betrüger«, sagte ich kühl. »Ein Trickbetrüger. Er hat heute Nachmittag eine hilfsbereite alte Dame um ihr gesamtes Erspartes gebracht. Um eine Viertelmillion Euro.«
»Was?« Charlotte Peeters blickte mich entsetzt an, als hätte ich ihr einen Schlag versetzt. »Ich dachte... ich dachte wirklich nur, er betrügt mich...«, flüsterte sie fassungslos. Ihre Beine schienen sie kaum noch zu tragen.
In diesem Moment kam Jacques Peeters aus dem Keller. Er trug einen schwarzen, unauffälligen Kunststoffkoffer. Wortlos hielt er ihn mir hin. Sein Blick war zu Boden gerichtet. »Es... es ist alles drin. Unberührt.«
---ENDE DER LESEPROBE---