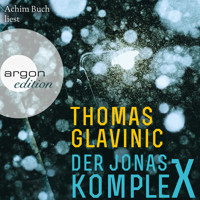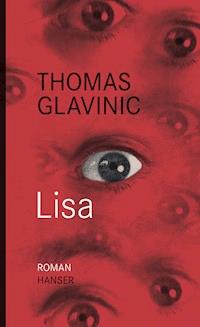Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Die Pilgerfahrt auf den Balkan soll eigentlich zur Erleuchtung führen. Doch die bleibt aus. Thomas Glavinic und der Fotograf Ingo stehen kurz vor dem Nervenzusammenbruch: Die vierzehnstündige Busfahrt nach Bosnien mit den kauzigen Mitreisenden war schlimm genug. Im Pilgerort Medjugorje landen die beiden in einer perfekten Abfertigungsmaschinerie für gläubige Touristen. Zermürbt von den endlosen Gebeten der Religionsanhänger, versuchen sie zu fliehen, doch schon bald wünschen sie sich, sie wären bei den Predigern geblieben. Mit seinem neuen, brillanten Buch beweist Glavinic: Er ist böse - vor allem sich selbst gegenüber.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Hanser eBook
Thomas Glavinic
Unterwegs im Namen des Herrn
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-23837-4
© 2011 Carl Hanser Verlag München
Alle Rechte vorbehalten
Vorsatzgestaltung: Angela Kirschbaum, München
Satz: Greiner & Reichel, Köln
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
www.thomas-glavinic.de
1. Kapitel
Der erste Eindruck – Schüchtern im Reisebus – Äpfel und Postkarten – Aussteigen oder bleiben – Der Reiseleiter – Ingo wird laut – »Klo? – Einen halben Euro!«
Sechs Uhr früh ist eine Uhrzeit, die ich sonst nur von der anderen Seite her kenne. Dabei genieße ich es zu erleben, wie die Stadt aufwacht. Die Vögel singen, der Verkehr schwillt langsam an, die Luft ist nachtklar, es sind wenige Menschen auf der Straße. Aber im Moment bin ich für diese Idylle nicht so empfänglich wie sonst. Gerade habe ich mich am Westbahnhof abgehetzt, um eine für vierzehn Stunden Fahrt ausreichende Menge an Proviant aufzutreiben, nun sitze ich inmitten verschlafener Menschen in einem nicht mehr ganz neuen Reisebus, der mich und die anderen Pilger von Wien nach Medjugorje bringen wird, wo täglich die Muttergottes erscheint, an die ich leider nicht glaube.
Eigentlich wollte ich nach Lourdes fahren, aber da dauern sowohl Fahrt als auch Aufenthalt noch länger, und man muss es ja nicht übertreiben. Medjugorje ist vielleicht nicht so überfüllt, das war mein Gedanke, und – die Reise kostet inklusive Unterkunft und Verpflegung nur 260 Euro, Lourdes indes mehr als das Doppelte.
Ich sitze in der zweiten Reihe. Mit einigen Mitpilgern habe ich bereits auf dem Parkplatz ein paar Sätze wechseln können, und ganz geheuer sind sie mir noch nicht. Ein Umstand, dem ich keine große Bedeutung beimesse, weil es ihnen vermutlich umgekehrt nicht viel anders gehen wird und ich überdies ein schüchterner Mensch bin, was mir allerdings niemand glaubt. Mit verschränkten Armen werfe ich also diskrete Blicke auf die Leute, die sich grußlos an mir vorbei nach hinten schieben.
Da wäre zum Beispiel der Kappenmann. Er ist etwa achtzig. Scheint kein gebürtiger Österreicher zu sein, eher irgendwoher aus dem Osten zu stammen. Er hat einen stechenden Blick und murmelt vor sich hin. Hinter ihm tapst ein Mensch einher, der wie ein rustikaler Postangestellter aussieht. Es folgt ein Mann mit langen blauschwarzen Haaren wie sie Indianer tragen, zumindest habe ich mir Winnetous Vater Intschu-Tschuna immer so vorgestellt. Er isst eine Wurstsemmel und macht kein Geheimnis daraus. Dann ein Liliputaner mit einem Silberkreuz um den Hals, das fast seinen ganzen Oberkörper bedeckt. Oder ist es ein Zwerg und kein Liliputaner? Worin lag noch einmal der Unterschied?
Nach dem Liliputaner kommt eine stark gehbehinderte alte Frau, die Zentimeter für Zentimeter von einer dunkelhaarigen, sehr stämmigen Dame nach hinten geführt wird. Hinter ihnen bildet sich ein Stau. Vier Frauen blicken zu Boden, allem Anschein nach eine Mutter mit ihren Töchtern. Die Mutter ist Mitte sechzig, die Töchter um die dreißig, sie setzen sich in die Reihen neben Ingos und meiner. Ich nicke ihnen zu. Sie schauen schnell weg.
Eine entsetzlich schielende Frau mit dicker Brille gibt mir eine Postkarte aus Mariazell und einen Apfel. Sie teilt Äpfel und Ansichtskarten an alle Mitpilger aus, und ich beobachte, wie sie anschließend ihren leeren Rucksack umständlich verstaut und sich in die letzte Reihe setzt.
Ingo starrt die Karte an.
»Stimmt etwas nicht?«, frage ich.
»Das Foto habe ich gemacht!«
»Ja und?«
»Ich habe nie Tantiemen dafür gekriegt!«
»Wann warst du in Mariazell?«
»Bitte erinnere mich nicht daran.« Er beißt in den Apfel. »Schmeckt gut.«
»Du ISST den?«
»Na, wieso denn nicht?«
»Du weißt doch gar nicht, was die damit vorher gemacht hat!«
»Nichts Besonderes wohl. Isst du nie Äpfel?«
»Eigentlich nicht. Den hier jedenfalls nicht.«
Ingo schüttelt den Kopf und beißt noch mal krachend in den Apfel. Er hat einen Kampfkiefer, der jedem Nussknacker Ehre machen würde, es spritzt, kleine Stücke fliegen herum, es ist wie eine Mini-Detonation, die die vier Frauen auf der anderen Seite des Ganges noch starrer geradeaus blicken lässt.
Dass ich heute hier sein werde, weiß ich seit Wochen. Ich will sehen, welche Menschen Pilgerreisen unternehmen, und ich will erfahren, wie es auf einer solchen Reise zugeht. Ich will Menschen in ihrem Glauben erleben, vielleicht auch, weil ich sie irgendwo tief in mir darum beneide. Ich bin nicht gläubig, bin es nie gewesen, doch der Trost, den Menschen aus ihrem Glauben ziehen, fasziniert mich und nötigt mir manchmal die Frage auf, wieso er mir versagt bleibt.
Eine Pilgerreise zu unternehmen klang in der Theorie sehr aufregend, aber nun fürchte ich mich ein wenig. Ich hole eine Zeitung heraus und lege sie gleich wieder weg. Ich schiebe mir einen Travelgum in den Mund, damit mir nicht schlecht wird. Ich kontrolliere alle paar Sekunden, ob mein Handy noch da ist, ich suche zum dritten Mal meinen Reisepass, ich überlege, ob ich irgendetwas Wichtiges vergessen habe.
Ingo scheint meine Gedanken lesen zu können, er sagt schmatzend: »Noch können wir aussteigen.«
»Wir steigen nicht aus«, sage ich.
»Ich könnte mit dem eigenen Auto fahren. Ich könnte hinter euch herfahren. Dann könnte ich Musik hören und rauchen.«
Kurzes Schweigen, eine greise Frau schleicht an uns vorbei, ländlich gekleidet, hochgestecktes Haar, ihr Gesicht ist auffallend schön, eine alte Bäuerin auf dem Kirchgang.
»Weißt du, was mein schlimmster Alptraum ist?«, sagt Ingo. »Ich male mir das seit Wochen aus. Du hast Drogen dabei –«
»Ich habe keine Drogen dabei!«
»– du hast Drogen dabei, und sie fischen dich an der bosnischen Grenze raus. Ich versuche tagelang, dich freizubekommen, aber dann ruft Tanja an, es geht los, und um rechtzeitig im Kreißsaal zu sein, besorge ich mir ein Taxi, das mich direkt nach Wien bringt.«
»Das kostet 2000 Euro.«
»Du hast sicher keine Drogen dabei?«, fragt er.
»Sag mal, wie kommst du überhaupt auf so etwas?«
Ingo steckt sich die Kopfhörer seines iPods in die Ohren, schließt hinter der Sonnenbrille die Augen und lehnt sich zurück, als wolle er schlafen. Das würde ich auch gern, aber ich weiß, ich kann nicht, also mustere ich lieber unauffällig die Menschen, die weiterhin an mir vorbei nach hinten gehen.
Ich könnte mich täuschen, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass die mich komisch ansehen. Besonders ein älterer Mann, dessen Akzent seine amerikanische Herkunft verrät, mustert mich eindringlich. Schon während des Wartens an der Haltestelle hatte ich den Eindruck, ihm aufzufallen. Er nimmt einige Reihen hinter mir Platz und stellt sich jemandem, den ich nicht sehe, als Jim vor.
Der Fahrer lässt den Motor an. Ich drehe mich um und werfe einen Blick auf die Versammlung meiner Mitpilger. Rasch bringt mich das Schlingern des Busses wieder in die korrekte Sitzposition. Ich mache mir eine Dose Kaffee auf und versuche geradeaus zu schauen, damit mir nicht schlecht wird. Mir ist schon als Kind im Bus immer schlecht geworden.
Die nächste Stunde sitze ich da und bringe es fertig, nur einen einzigen klaren Gedanken zu fassen, und der dreht sich um die Frage, ob Gott, wenn er existiert, jederzeit meine Gedanken liest. Ansonsten sitze ich einfach da, schaue auf die Straße und bin so schlau wie Gemüse. Kurz nach Zöbern bricht totale Ermattung über mich herein, und ich erwache gerade, als wir auf dem Parkplatz der Raststation Dokl in der Oststeiermark halten. Immerhin habe ich eine Dreiviertelstunde geschlafen.
Hier lernen wir unseren Reiseleiter kennen, der gleichzeitig Chef des Reisebüros ist. Auf den war ich gespannt, denn wenn man den Reiseunterlagen glauben darf, ist dies seine sechshundertfünfunddreißigste Fahrt nach Medjugorje. Dazu kommen zahllose Fahrten nach Lourdes und in andere Wallfahrtsorte, was in mir die Frage aufwirft, womit der Mann ansonsten seine Zeit verbringt.
Eine Weile beobachte ich ihn aus einigen Metern Entfernung, wie er die anderen Pilger begrüßt, ein wenig huldvoll, aber nicht unfreundlich. Alt ist er und groß, und wenn er geht, wackelt sein ganzer Körper ein wenig. Er hat ein wetterrotes Gesicht und eine knollige Nase, er ist hager und trägt eine Fischerjacke, in deren ungefähr zwanzig Taschen offenbar nicht das Geringste steckt.
Wir warten ab, bis die Menge um ihn kleiner wird, dann stellen wir uns vor. Während er Ingo und mir die Hand schüttelt, schaut er zur Seite, ich habe einen Moment lang das Gefühl, er sei unangenehm berührt. Aber wir sehen ja tatsächlich anders aus als die Pilger, die er normalerweise begleitet. Ingo ist fast zwei Meter groß und ziemlich breit, und er hat einen schwarzen Vollbart, der leider das nervöse Zucken unter seinem Auge nicht verbergen kann. Mit diesem Tick lebt er schon viele Jahre. Wenn man ihn nicht kennt, ist der Anblick durchaus irritierend. Daneben sieht der Reiseleiter mich, und einen viel besseren Eindruck mache ich offenbar auch nicht.
»Gehts alle aufs Klo!«, ruft der Reiseleiter. »Hier kostet es nichts, im Grazer Hauptbahnhof kostets einen halben Euro!«
Folgsam marschieren einige Pilger Richtung Raststation. Ich muss nicht aufs Klo, ob es nun gratis ist oder nicht, also drücke ich mich in der Nähe des Busses herum und kämpfe mit meiner Schüchternheit. Ingo schießt Fotos, auch er scheint nicht recht zu wissen, was er mit sich anfangen soll.
Nach und nach trudeln die Klogänger ein. Der Reiseleiter stößt einen schrillen Pfiff aus, und alles begibt sich zum Bus. Die Gehbehinderte hat natürlich erhebliche Schwierigkeiten, die hohen Stufen zu erklimmen, und ihre Begleiterin wirkt besorgt.
»Kann ich helfen?«, fragt Ingo.
»Na!« faucht ihn die Begleiterin an.
Ingo starrt vor sich hin, dann schreit er in meine Richtung los: »Die werde ich gleich packen und aus dem Bus schmeißen!«
»Vielleicht solltest du leiser sprechen«, raune ich ihm zu.
»Ich bin ja leise!«, ruft er.
Seltsamerweise scheint niemand etwas von dem Zwischenfall mitbekommen zu haben, und wir fahren weiter. Ich würde gern eine Runde schlafen, doch der Reiseleiter spricht zu uns, und das ist bestimmt wichtig und interessant. Außerdem geht von ihm etwas Lauerndes aus, etwas, was man als negative Ausstrahlung bezeichnen könnte, eine Art unterdrückte Aggression, und neben solchen Menschen kann ich mich schlecht entspannen. Aber vielleicht ist er auch nur müde oder hat andere Sorgen.
Über Lautsprecher stellt sich der Fahrer, ein gemütlich wirkender Endvierziger mit Schnauzbart, als Rudi vor: »I werd eich in die fünf Tag herumfahren.«
Der Reiseleiter nimmt ihm das Mikrophon weg und fragt: »Wer war noch nie in Medjugorje?«
Ich hebe die Hand.
»Sieben – zehn – zwölf«, sagt der Reiseleiter. »Ah, doch so viele.«
Bald darauf sind wir in Graz. Wir fahren über eine Brücke, dann halten wir in einer Nebenstraße, wo Rudi eine Weile manövrieren muss, um den Bus in eine schmale Toreinfahrt zu bekommen. Ich frage mich, was wir hier wollen.
Rudi und der Reiseleiter steigen kommentarlos aus und verschwinden in einem Haus. Es vergehen fünf Minuten, zehn Minuten, ich trinke meinen Kaffee und werfe die leere Dose vorne in den Abfalleimer. Ich kann Ingos Augen hinter der Sonnenbrille nicht gut erkennen, aber er wirkt apathisch. Jim der Amerikaner scheint mit jemandem in eine theologische Debatte verstrickt zu sein. Nachdem ich mich wieder hingesetzt habe, höre ich ihn sagen:
»It’s Adam and Eve, not Adam and Steve!«
Wir warten weitere fünf Minuten. Als die ersten Pilger zu überlegen beginnen, ob sie aussteigen dürfen, schleppen Fahrer und Reiseleiter riesige Säcke herbei, die sie in den Kofferraum heben. Sie steigen ein, als wäre nichts gewesen, und wir fahren weiter.
Ich hüte mich, eine Frage zu stellen. Vielleicht sind es Leichen, die sie da unten entsorgen wollen? Raffiniert wäre das schon. Wer sucht schon im Pilgerbus nach zerstückelten Mordopfern?
Am Grazer Hauptbahnhof machen wir wieder halt, um weitere Pilger abzuholen. Der Reiseleiter deutet in Richtung Toilette, weist uns jedoch mit brüchiger Greisenstimme darauf hin, dass es hier einen halben Euro kostet. Jetzt müsste ich, aber ich bin zu kaputt, um mich aus dem Sitz zu erheben. Ich achte kaum darauf, wer einsteigt, wie die Leute aussehen, was sie reden, zuweilen dringen Satzfetzen zu mir durch.
Eine Erinnerung aus meiner Kindheit steht plötzlich vor mir, nicht klar, nicht detailreich. Ich gehe mit meiner Großmutter spazieren, und sie erzählt mir die Jesusgeschichte. So nannten wir sie: die Jesusgeschichte. Ich weiß nicht mehr, was genau der Inhalt war, ich weiß nur, dass ich sie immer wieder hören wollte, jeden Nachmittag, während wir über verschneite Feldwege gingen, ich da und dort trockene Zweige abriss oder Schneebälle formte, um sie auf ein beliebiges Ziel zu werfen. Sie erzählte mir jeden Tag diese Geschichte von einem bemerkenswerten Mann, und sie erzählte sie mit einer Wärme und Gewichtigkeit, die ich heute noch nachempfinden kann, wenn ich daran denke. Ich erinnere mich nicht, sie oft von Gott sprechen gehört zu haben, doch die Jesusgeschichte hörte ich regelmäßig, bis meine Großmutter starb. Danach las ich von Gott und Jesus nur noch in Zeitschriften und Büchern.
2. Kapitel
Die Pilgerpässe – Botschaft der Gospa – Ingo stellt sich schlafend – Erweckungserlebnisse – Der Rosenkranz – Es gibt Würstel!
In Leibnitz, etwa zwanzig Kilometer vor der slowenischen Grenze, steigen weitere Pilger zu, und damit sind wir vollständig. Der Reiseleiter nimmt sich wieder das Mikrophon.
»Ich werde jetzt die Pilgerpässe und eine Botschaft der Gospa verteilen. Ich sag die Namen, der Besitzer meldet sich, dann bring ich ihm die Sachen. Die Pilgerpässe hängts euch bitte um, damit man den Namen sieht. Vorher noch eine Kleinigkeit: Während der Pilgerreise wollen wir uns als Brüder und Schwestern im Glauben begegnen und uns duzen. Und dann muss in Slowenien Rosenkranz gebetet werden, da brauchen wir einen Vorbeter oder eine Vorbeterin. Könnts euch schon überlegen, wer von euch will.«
Wir wollen was? Rosenkranz? Vorbeter? Botschaft von wem? Ich schaue zu Ingo zurück, der nickt nur, und unter seinem Auge zuckt es.
Ich denke darüber nach, dass der Reiseleiter nie von beten spricht, er sagt immer »betten«. »Vorbetten«. »Vorbetter«. »Es muss Rosenkranz gebettet werden.« Das gefällt mir sehr.
Lange dauert es nicht, da höre ich meinen Namen. Der Reiseleiter schaut über mich hinweg, als er mir den Pilgerpass und einen losen Zettel reicht.
Der Pilgerpass ist eine Art Visitenkarte, an die eine Schnur befestigt ist. Neben einem Bild der Jungfrau Maria steht mein Name. Auf dem Zettel ist links das Logo des Reisebüros, rechts ebenfalls das Bild der Jungfrau zu sehen, und über dem Bild der Muttergottes findet man kleingedruckt die genaue Anschrift des Reisebüros. Unter der Überschrift »Botschaft der Königin des Friedens in Medjugorje« steht:
Lieber Thomas,
Von neuem rufe ich dich auf, mir mit Freude zu folgen. Ich möchte euch alle zu meinem Sohn und eurem Erlöser führen. Bist du dir nicht bewusst, dass du ohne Ihn weder Freude noch Frieden und keine Zukunft, sowie kein ewiges Leben hast. Deshalb, mein lieber Thomas, nutze diese Zeit des frohen Gebetes und der Hingabe.
Danke, lieber Thomas, dass du meinem Ruf gefolgt bist.
Darunter, kleiner gedruckt:
BOTSCHAFT DER GOSPA AN MIRJANA, AM 2. AUGUST 2010
Liebe Kinder!
Heute lade ich euch ein gemeinsam, mit mir, zu beginnen, das Himmelreich in euren Herzen zu errichten, zu vergessen, was für euch persönlich ist und, durch das Beispiel meines Sohnes geleitet, an das zu denken, was Gottes ist. Was erwartet er von euch? Erlaubt Satan nicht, euch die Wege des irdischen Wohlergehens zu öffnen, die Wege ohne meinen Sohn. Meine Kinder, sie sind trügerisch und von kurzer Dauer. Denn mein Sohn existiert. Ich biete euch ewiges Glück und den Frieden, die Einheit mit meinem Sohn, mit Gott. Ich biete euch das Reich Gottes. Ich danke euch.
Am österreichischen Grenzübergang gibt es keinen längeren Aufenthalt. Als wir kurz hinter einem anderen Bus zu stehen kommen, klebt Rudi ein riesiges Muttergottesbild vorn auf die Windschutzscheibe. Hinter mir sind seltsame Geräusche zu hören, es klingt, als hätte sich jemand verschluckt.
Im Niemandsland zwischen Österreich und Slowenien machen wir Toilettenpause. Der Reiseleiter treibt uns bald wieder mit einem schrillen Pfiff zusammen und fragt schon in kleiner Runde an der Tür, wer sich zum Vorbetten meldet. Alle steigen stumm und mit gesenktem Kopf ein.
Während wir im Bus auf Nachzügler warten, greift der Reiseleiter zum Mikrophon.
»An dieser Grenze ist es gewesen, da hat eine Pilgerin einmal eine Erweckung gehabt. Genau da drüben war es. Sie war eine Zweifelnde und Suchende. Sie ist neben mir gestanden. Plötzlich packt sie mich am Arm und sagt: ›Du, ich spüre etwas, und ich möchte wissen, spürst du es auch?‹ Na, ich hab nichts gespürt und ihr das auch gesagt. Sie ist fünf Minuten dagestanden, dann ist sie in Tränen ausgebrochen. Einen Monat später war sie Ordensschwester.«
»Jööööh«, sagt die schöne alte Bäuerin verzückt.
»Wow«, ruft Jim der Amerikaner und klatscht.
»Sie hat zu mir gesagt: ›Eigentlich muss ich nicht mehr mitfahren, denn ich weiß alles, was ich wissen wollte. Aber aus Dankbarkeit fahre ich mit.‹ Schwester Antonia heißt sie jetzt. Vergangenes Jahr war sie zum fünfundzwanzigsten Mal unten.«
Der alte Kappenmann steigt ein und versucht mit dem Reiseleiter ein persönliches Gespräch zu beginnen, wird von diesem jedoch schroff nach hinten gescheucht.
Wir rollen auf den slowenischen Grenzposten zu. Ein vollbärtiger Beamter winkt uns durch. Rudi steuert den Bus wieder auf die Autobahn, und der Reiseleiter gibt über Mikrophon bekannt, dass in Slowenien immer der Rosenkranz gebettet werden muss, weswegen wir jetzt sofort den Vorbetter brauchen.
Schweigen. Auch die vier Frauen neben mir schauen aus dem Fenster.
»Einen brauchen wir. Herr Thomalla! Ach so, Entschuldigung, Domweber. Nicht? Frau Josefa? Bitte, Frau Josefa!«
Schweigen. Der Reiseleiter steht im Gang und wirft durchdringende Blicke auf die Pilger.
»Herr Ludwig? Ach so, Leo, Entschuldigung. Herr Leo, doch! Kommen Sie! Nein? Herr Jim? No?«
Stille. Der Reiseleiter starrt nach hinten.
»Gar niemand? Einer muss doch. Frau Andrea, Sie können das. Aber sicher! Ach so, Anna! Am Anfang hab ich immer die Namen noch nicht so intus.«
Stille. Der Reiseleiter starrt nach hinten.
»Herr Stefan? Resi? Die Resi vielleicht diesmal? Ach so, Rosi, meiner Seel.«
Zwei, drei, vier Minuten unerträgliche Stille. Die Szene wird immer bizarrer. Seit fünf, seit sechs, seit sieben Minuten steht der Reiseleiter vor uns, der Bus wackelt, der Reiseleiter wackelt, der alte Reiseleiterkopf wackelt bekräftigend auf und ab, die dürren Hände krümmen sich zu einem flehenden Bittebitte um das Mikrophon. Wieder und wieder machen diese greisen Hände bitte-bitte. Bitte-bitte, bitte-bitte, bitte-bitte. Und der Kopf nickt: Ja! Ja! Ja! Oja! Und mir fällt plötzlich auf, dass er sich nur zwei Namen problemlos gemerkt hat: Thomas und Ingo.
Nachdem eine weitere lange Minute vergangen ist, verändert sich etwas an seiner Miene. Er fixiert jemanden, das merke ich. Er sagt nichts, schaut aber eine Person im hinteren Teil des Busses unverwandt an. Dabei geht der Kopf begütigend auf und ab, ja, oja, bitte-bitte. Es sieht so grotesk aus, dass ich nicht einmal einen Schluck Wasser nehmen kann, weil ich am Wackelgesicht des Reiseleiters hänge, dessen Blick irgendjemanden hinter mir gnadenlos durchbohrt. Wenn ich seinen Ausdruck beschreiben müsste, würde ich sagen, er will dieses Gebet trinken, er muss es haben, unbedingt, sonst verhungert oder verdurstet er auf der Stelle.
»Ja, kommen Sie! Erwin. Sehr gut. Aber jetzt schnell!«
An mir vorbei taumelt der Postangestellte nach vorne, in der Hand einen Rosenkranz. Er bekommt das Mikrophon und muss sich in die erste Reihe setzen. Er und der Reiseleiter wechseln ein paar Worte, der Postangestellte fragt etwas, der Reiseleiter sagt: »Wie du willst.«
Ringsum werden Rosenkränze gezückt, und der Postmann beginnt, in das Mikrophon zu beten. Die übrigen Pilger wiederholen den Refrain. Es klingt wie ein Hexenchor. Ich drücke mich in meinen Sitz, so tief ich kann.
Der Vorbeter betet wie ein ungebildeter Mensch, der laut und holprig aus der Zeitung vorliest. Er spricht die Worte überkorrekt aus, »Frauen« sind bei ihm »Frau-een«, »Erden« ist »Erd-een«, »Bösen« ist »Böö-seen«. Ich versuche wegzuhören, was natürlich unmöglich ist, weil das Gemurmel fortwährend an mich heranschwappt.
Ich fühle mich exponiert und ertappt. Ich weiß nicht einmal, was diese Kette, die die Pilger in der Hand halten, darstellen soll. Ich weiß, dass sie Rosenkranz genannt wird und dass es ein gleichnamiges Gebet gibt, aber den Hintergrund kenne ich nicht. So früh wollte ich eigentlich nicht negativ auffallen. Ich kann nur hoffen, dass niemand durch den Bus marschiert und die Enthüllung meiner Glaubensferne wenigstens einstweilen den eisig blickenden Frauen neben mir vorbehalten bleibt.
Eine Viertelstunde vergeht, eine halbe Stunde vergeht. Eine Stunde vergeht, eineinhalb Stunden vergehen. Der Bus schaukelt uns über die slowenische Autobahn, und die Leute hören nicht auf zu beten. Ich drehe mich zu Ingo um. Er wirft mir einen ratlosen Blick zu.
Es wird bis zur slowenisch-kroatischen Grenze gebetet. Der Reiseleiter meinte es wörtlich, als er sagte, in Slowenien muss gebetet werden, er sagte: In GANZ Slowenien muss gebetet werden. Ich werde den Verdacht nicht los, dass der Fahrer das Tempo dem Gebet angepasst hat, damit sich die unzähligen Wiederholungen dieser Litanei bis zur Grenze genau ausgehen. Keine schlechte Leistung, wenn man bedenkt, dass wir hier über eine Strecke von geschätzten hundertfünfzig Kilometern sprechen.
Der Bus vor uns am slowenischen Grenzübergang fährt gerade weiter, als wir hinter ihm halten, und so sind wir gleich an der Reihe. Eigentlich würde ich, wie auch der Kappenmann und Intschu-Tschuna, gern an die frische Luft, aber der Reiseleiter wehrt uns mit einer herrischen Geste ab, setzt seinen Bauernhut auf, steigt aus und hält dem Zöllner irgendwelche Zettel unter die Nase. Wir setzen uns wieder.
Im Bus herrscht erschöpfte Stille. Die Frauen neben mir schieben sich Brot in den Mund und trinken Wasser dazu.
Ingo beugt sich zu mir nach vorn. »Was war denn das bitte? Dachte schon, das hört gar nicht mehr auf. Ich brauche was zu essen. Ich drehe durch, wenn ich nicht bald was zu essen kriege.«
Der Zöllner kommt in den Bus und kontrolliert unsere Pässe. Nach kaum fünf Minuten ist er fertig. Der Reiseleiter steigt ein, und wir rollen weiter zu den kroatischen Kollegen, wo sich diese Prozedur wiederholt. Auch hier gibt es keine Schwierigkeiten. Ich muss sowieso keine Angst haben, denn entgegen Ingos Verdacht habe ich nichts bei mir außer einer Schachtel Xanor und drei oder vier Amphetamintabletten.
»Ich muss jetzt durchfragen, wer ein Würstel will. Ich schreib mit. Bei der nächsten Rast gibt sie Rudi unten in den Kessel, bei der übernächsten essen wir. Es sollen jetzt mal alle aufzeigen, die keine wollen.«
Offenbar zeigen viele auf, denn der Reiseleiter wirkt beleidigt.
»Wer soll dann all die Würstel essen?«
»Ich nehme zwei Paar«, sage ich zaghaft.
»Ich auch!«, ruft Ingo.
»Ihr nehmts zwei, in Ordnung«, sagt der Reiseleiter, ohne uns anzusehen. »Was ist mit euch?«, fragt er die Frauen neben uns.
»Es ist Mittwoch«, lautet die knappe Antwort.
»Für Pilger gibt es Dispens!«, sagt der Reiseleiter und hebt den Zeigefinger.
»Danke, wir brauchen nichts«, sagt die Mutter, und die Töchter nicken, den Blick starr geradeaus gerichtet.
Während der Reiseleiter nach hinten wackelt, um die Würstelwünsche zu notieren, flüstere ich nach hinten: »Was ist mit dem Mittwoch?«
»Keine Ahnung«, flüstert Ingo zurück. »Ich habe aufgepasst, sie nehmen nichts als Wasser und Brot zu sich.«
Ich bemühe mich, wieder eine Weile geradeaus zu schauen, denn mein Magen fühlt sich ein wenig flau an. Das wird nicht besser, als mir der Reiseleiter die Sicht versperrt. Er lehnt sich vor mir gegen den Sitz und hebt zur nächsten Durchsage an.
»Ich habe hier in meinem Hut die Namen von uns allen. Es ist ein guter Brauch, dass jeder von uns einen Namen zieht und im Stillen für diese Person jeden Tag ein Vaterunser spricht, solange die Pilgerfahrt dauert. Wollt ihr das?«
»Jööööh«, sagt die alte Bäuerin.
Die vier Frauen neben mir nicken eifrig. »Ja! Eine gute Idee!«
Auch im hinteren Teil des Busses macht sich Zustimmung breit.
»Gut, dann komme ich jetzt zu euch, und jeder zieht.«
Ich starre in einen Hut voller zusammengefalteter Zettel. Verschiedene Gedanken jagen durch meinen Kopf. Ich weiß nicht einmal, wie ein Vaterunser geht. Abgesehen davon werde ich ganz bestimmt sowieso nicht beten. Aber muss ich das jetzt gleich sagen, um zu gewährleisten, dass keiner der Pilger auf seine geistige Unterstützung verzichten muss? Ich will ja niemanden vor den Kopf stoßen, ich will nur dabei sein und schauen und mir selbst ein paar Fragen stellen. Ich schaue in den Bauernhut, und mir fällt nichts anderes ein, als zuzugreifen.
»Nimmst du einen Zettel für Ingo?«, fragt der Reiseleiter.
Ich drehe mich um. Um der Ziehung zu entgehen, hat der sich Lump blitzartig schlafend gestellt. Während ich seinen Zettel aus dem Hut fische, muss ich ein schadenfrohes Grinsen unterdrücken.
Der Reiseleiter wandert nach hinten, und ich lese die beiden Namen. Für mich habe ich den Liliputaner gezogen, für Ingo die Fundamentalistenmutter neben mir. Wenn jemand hier das Ausfallen eines Gebets verkraftet, dann sie, denn sie wirkt sehr gefestigt. Um den Liliputaner mache ich mir da etwas mehr Sorgen, und so vertausche ich die beiden Zettel. Nun habe ich die Fundamentalistenmutter, der Liliputaner wird Ingos Schützling.
»Wolltest du dich nicht auf das Ganze hier einlassen?«, flüstere ich nach hinten.
»Was?«
»Du hast gesagt, du wirst offen auf alles zugehen, was du auf der Pilgerreise erlebst. Hier, nimm deinen Zettel!«
Er zeigt mir den Mittelfinger und wirft sich seine Jacke über den Kopf.
Der Reiseleiter wackelt wieder herbei.
»Ich zeige euch jetzt das Video von der Radpilgerfahrt nach Medjugorje. Seit Jahren unternimmt mein Neffe diese Tour mit zehn bis fünfzehn Pilgern, da sind sie eine Woche unterwegs, und das ist immer für alle ein besonderes Erlebnis. Rudi, die Kassette starten.«
Auf dem kleinen Bildschirm über der Windschutzscheibe erscheint kein Film, wie ich es erwartet hätte, sondern eine Fotoserie. Fröhliche Radmenschen auf der Landstraße, auf Parkplätzen, vor Kirchen, beim Essen, in karger Landschaft und vor Pensionen mit Blumenkästen an den Fenstern. Das Ganze ist ungelenk zusammengestellt, und die Bilder haben nicht gerade eine famose Qualität, worüber ich mich gar nicht beklagen möchte, denn fotografieren kann ich selber nicht. Mich überfordert eher, dass dazu abwechselnd dröhnend laute Volksmusik gespielt wird und eine Panflötenversion von »Don’t cry for me, Argentina«.
Das geht so dahin bis zu einer Raststation nahe Zagreb. Ich bin als erster draußen aus dem Bus, stürme in den Shop und verlange schwarzen Kaffee. Ein Sandwich bestelle ich dazu und danach noch eines, zusammen mit einem doppelten Loza, denn wer weiß, ob ich mir mit diesem verdächtig aussehenden Thunfischaufstrich nicht den Magen verderbe.
Eine Weile steht Ingo neben mir. Wir wechseln Blicke. Er hat rote Flecken auf der Stirn. Ich deute auf die Schlange der Mitpilger vor der Toilette und nicke. Er nickt auch. Wir wissen wahrscheinlich beide nicht, warum.
Ich komme gerade rechtzeitig zum Bus zurück, um zu hören, wie der Reiseleiter dem Rest der Schar empfiehlt, hier aufs Klo zu gehen: »Bei der nächsten Station kostets fünfzig Cent, hier nur dreißig.«
Ich sehe zu, wie Rudi Würstel in einen mächtigen Kessel legt, der im Kofferraum steht. Der Kappenmann kommt herbei und verlangt nach einem Bier aus dem Vorrat neben dem Wurstkessel.
»Aber das ist doch warm! Das muss ich erst kühlen! Oben hab ich kalte!«
»Nein, ich will ein warmes.«
Der Kappenmann kauft dem sichtlich angewiderten Rudi ein warmes Bier ab, das er in einer erstaunlichen Geschwindigkeit austrinkt. Ich vertrete mir abseits die Beine, wobei ich mich bemühe, im Schatten der Bäume zu bleiben, die den Parkplatz säumen, denn es hat weit über dreißig Grad. Meine Bewegungen sind etwas unbeholfen, weil ich zum ersten Mal seit langer Zeit Gymnastik mache. Ich bin einfach nur dankbar, im Freien zu sein.
Der Reiseleiter pfeift schrill, und alle traben zu ihm. Zwei Minuten später schaukelt der Bus wieder über die Autobahn. Ich muss ständig an die Würstel im Gepäckraum denken. Der Diavortrag ist allerdings noch nicht zu Ende.
»Die Frau, die ihr da hinten rechts seht, die war Volleyballerin! Hat gut gespielt, bei einem Verein, sogar im Nationalteam, und in einer Bank gearbeitet hat sie auch. In Medjugorje hat sie den Ruf empfangen, und vorletztes Jahr ist sie in ein Kloster in der Nähe von Salzburg eingetreten.«
»Jööööh«, tönt es von hinten.
»Und der da links, der Junge, Starke, der ist auf einer späteren Pilgerfahrt gestorben. Ganz friedlich ist er eingeschlafen und heimgeholt worden. Da kann man schon sagen, das ist eine Gnade. Nicht der Zeitpunkt, aber der Ort. Ja, wir wissen halt alle nicht, wann der andere Ruf kommt, den kann auch ein Junger hören.«
Mir kommt es vor, als würde er mich mit einem Blick streifen. Er redet weiter, doch ich höre nicht mehr zu. Diese Sache mit dem Ruf, die gefällt mir nicht. Im Gegenteil, die Aussicht auf einen Tod in Medjugorje macht mir eine Heidenangst. Vom Sterben halte ich sowieso nicht viel, aber sollte mir das da unten passieren, würde irgendeiner meiner Freunde bei der Trauerfeier garantiert loslachen. Ich habe keine Lust, dass es später auf meinem Grabstein heißt: »Geboren in Graz, gestorben in Medjugorje«. Auf die Gnade kann ich verzichten.
Während ich zu den inzwischen vertrauten Panflötenklängen Bilder von Radkameraden betrachte und Worte wie »Erscheinungsberg« und »Kreuzberg« und »Pater Slavko« fallen, denke ich immer ernsthafter über dieses Thema nach. Ich hatte schon bei meinem ersten Besuch in Neapel fürchterlich Schiss, weil ich dauernd an den Spruch »Neapel sehen und sterben« denken musste. Und jetzt als Ungläubiger im Wallfahrtsort, gezeichnet vom Exzess – der Teufel schläft nicht.
Ich setze die Kopfhörer auf, höre Musik, doch die Gedanken lassen sich nicht verbannen. Ich überlege, ob ich eine Xanor in Griffweite habe oder ob die im Koffer liegen. Aber wäre das vernünftig? Würde ich damit nicht dem bösen Schicksal in die Hände spielen?