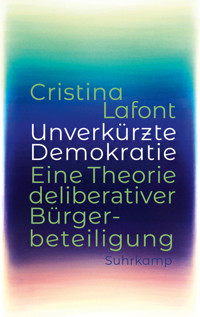
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Welche Form der Demokratie sollten wir in Zeiten von Rechtspopulismus, Wutbürgern und Fake News anstreben? In ihrem neuen Buch entwickelt die Philosophin Cristina Lafont eine partizipatorische Konzeption der deliberativen Demokratie, die das Ideal der Selbstregierung trotz aller Unkenrufe ernst nimmt. Sie plädiert dafür, das Mitspracherecht der Bürgerinnen und Bürger nicht nur zu verteidigen, sondern sogar zu stärken.
Lafont entwickelt ihre Position in kritischer Auseinandersetzung mit pluralistischen, epistokratischen und lottokratischen Konzeptionen von Demokratie. Diese sehen verschiedene »Abkürzungen« vor, um Probleme der demokratischen Regierung – unüberwindliche Meinungsverschiedenheiten, politische Ignoranz, die schlechte Qualität politischer Deliberationen – zu lösen. All diese Abkürzungen untergraben jedoch die Demokratie, weil sie nur funktionieren, wenn die Bürgerinnen und Bürger sich blindlings Akteuren unterwerfen, deren Entscheidungen sie nicht mehr kontrollieren können. Auch die Annahme, dass eine Gemeinschaft bessere Ergebnisse erzielen kann, wenn sie ihre Mitglieder übergeht, erweist sich als falsch. Es gibt keine »Abkürzungen«, sondern nur den langen, bisweilen beschwerlichen partizipatorischen Weg, der beschritten wird, wenn die Bürgerinnen einen kollektiven Willen schmieden. Das ist unverkürzte Demokratie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 652
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Cristina Lafont
Unverkürzte Demokratie
Eine Theorie deliberativer Bürgerbeteiligung
Aus dem Englischen von Bettina Engels und Michael Adrian
Suhrkamp
Widmung
9Für Jürgen Habermas
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
5Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Einleitung Demokratie für uns Bürger
I
Warum deliberative Demokratie?
1 Das demokratische Ideal der Selbstregierung
1.1 Politische Gleichheit versus demokratische Kontrolle: Das Problem blinder Überantwortung
1.2 Demokratie aus partizipatorischer Perspektive
Politische Partizipation versus politisches Aktivistentum
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der politischen Meinungs- und Willensbildung
Kostet politische Partizipation zu viele freie Abende?
1.3 Teilnehmer- versus Beobachterperspektive
2 Radikalpluralistische Demokratiekonzeptionen
2.1 Die radikalpluralistische Lösung für das Problem der Uneinigkeit: Die prozedurale Abkürzung
2.2 Die radikalpluralistische Lösung für das Problem politischer Entfremdung: Hinnehmen oder aufgeben
2.3 Kann der Dissens beliebig tief reichen?
Sind alle Dissense gleich?
Hermeneutische Binsenweisheiten: Uneinigkeit setzt Einigkeit voraus
2.4 Die agonistische Kritik an der Politik deliberativer Verständigung
Kommunikative Macht und Öffentlichkeit
II
Warum partizipatorische deliberative Demokratie?
3 Rein epistemische Demokratiekonzeptionen
3.1 Die Elitenepistokratie und das Versprechen besserer Ergebnisse: Die expertokratische Abkürzung
Elitendemokratie und blinde Überantwortung: Zum Tango gehören zwei
3.2 Demokratische Epistokratie und das Ideal der Selbstregierung
Epistemische versus politische Einbeziehung
Demokratische Epistokratie versus Demokratie
4 Lottokratische Konzeptionen deliberativer Demokratie
4.1 Deliberation versus Bürgerbeteiligung: Die mikrodeliberative Abkürzung
Die epistemische Rechtfertigung von Mini-Öffentlichkeiten mit Entscheidungsgewalt
Die demokratische Rechtfertigung von Mini-Öffentlichkeiten mit Entscheidungsgewalt
4.2 Die Illusion von Demokratie oder »Vorsicht vor Usurpatoren!«
Soll das kontrafaktische oder das reale Volk herrschen? Ein kontrafaktisches Szenario
Soll man sich seinem besseren Selbst blind fügen?
Überantwortung versus blinde Überantwortung
4.3 Keine Abkürzungen: Zurück zur makrodeliberativen Strategie
5 Lottokratische Institutionen aus partizipatorischer Perspektive
5.1 Das demokratische Argument für den politischen Gebrauch von Mini-Öffentlichkeiten
Der potentielle Beitrag von Mini-Öffentlichkeiten zur Bildung einer wohlüberlegten öffentlichen Meinung
Sollten Mini-Öffentlichkeiten ermächtigt werden oder einer Ermächtigung der Bürger dienen?
Ermächtigter Gebrauch von Mini-Öffentlichkeiten
5.2 Deliberatives Aktivistentum: Einige partizipatorische Verwendungsweisen von Mini-Öffentlichkeiten
Kontestatorischer Gebrauch von Mini-Öffentlichkeiten
Überwachender Gebrauch von Mini-Öffentlichkeiten
Antizipatorischer Gebrauch von Mini-Öffentlichkeiten
Noch einmal: Zum ermächtigten Gebrauch von Mini-Öffentlichkeiten
6 Eine partizipatorische Konzeption deliberativer Demokratie: Gegen Abkürzungen
6.1 Die demokratische Bedeutung politischer Deliberation: Gegenseitige Rechtfertigung
Das demokratische Ziel gegenseitiger Rechtfertigung
6.2 Würde die gegenseitige Rechtfertigung zu viele freie Abende kosten? Eine erste Bestimmung des angemessenen Umfangs öffentlicher Deliberation
Mit welchem Teil ihres kollektiven politischen Projekts müssen sich die Bürgerinnen identifizieren können?
6.3 Noch einmal zum Einwand der Überforderung: Hypothetische, aspirationale und institutionelle Modelle der gegenseitigen Rechtfertigung
Hypothetische Modelle der gegenseitigen Rechtfertigung
Aspirationale Modelle der gegenseitigen Rechtfertigung
Ein institutionelles Modell der gegenseitigen Rechtfertigung
III
Eine partizipatorische Konzeption der öffentlichen Vernunft
7 Kann öffentliche Vernunft inklusiv sein?
7.1 Die Debatte um die Rolle der Religion in der Öffentlichkeit
7.2 Politische Rechtfertigung und die Religiös/säkular-Unterscheidung: Exklusions-, Inklusions- und Übersetzungsmodelle
Das Exklusionsmodell
Das säkulare Übersetzungsmodell
Das Inklusionsmodell
7.3 Und wenn die Religion kein Sonderfall ist? Politische Rechtfertigung jenseits der Religiös/säkular-Unterscheidung
Das Priorisierungsmodell
7.4 Die Konzeption politischer Rechtfertigung im Sinne der öffentlichen Vernunft aus einer institutionellen Perspektive
Das Recht der Bürger auf juristische Anfechtung und die argumentative Verstrickung
Der Vorrang öffentlicher Gründe und religiöse Lebensformen
8 Bürger in Roben
8.1 Die Normenkontrolle als expertokratische Abkürzung: Ermächtigung des Volkes versus blinde Überantwortung an Richterinnen
8.2 Die demokratische Rechtfertigung der Normenkontrolle: Eine partizipatorische Interpretation
Zum richtigen Rahmen der Debatte um die Legitimität der Normenkontrolle
Ist die Normenkontrolle eine expertokratische Abkürzung? Jurizentrische versus holistische Perspektive
Partizipatorischer Konstitutionalismus: Die Normenkontrolle als Initiatorin des demokratischen Gesprächs
Die Tatsache der Uneinigkeit und ihre absehbaren Folgen
8.3 Können wir uns die Verfassung zu eigen machen? Eine Verteidigung des partizipatorischen Konstitutionalismus
Die Öffentlichkeit als Grundsatzforum
Bürger in Roben
Gerechtigkeit ohne Roben?
Danksagung
Literaturverzeichnis
Namenregister
Sachregister
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
9
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
329
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
11Einleitung Demokratie für uns Bürger
Neueren empirischen Untersuchungen zufolge sind die Vereinigten Staaten keine Demokratie mehr. Technisch gesehen sind sie eine Oligarchie. Zu diesem alarmierenden Schluss kamen Benjamin Page und Martin Gilens, indem sie einen simplen Demokratiestandard anlegten: Sie werteten aus, in welchem Maß politische Präferenzen und Überzeugungen einer Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger tatsächlich die öffentliche Politik beeinflussen.[1] Ihre Untersuchung deutet darauf hin, dass dieser Einfluss erstaunlich gering ist. Sie konstatieren zwar, dass es immer noch eine gewisse Überein12stimmung zwischen den Ansichten der Bürger und der realen Politik geben kann, allerdings nur dann, wenn das, was die meisten Bürger wollen, auch das ist, was die Oligarchen wollen.[2] Anders als es das demokratische Ideal der Selbstregierung verlangen würde, richtet sich die Gesetzgebung der Vereinigten Staaten aber keineswegs nach den Interessen, den Meinungen und dem Denken der meisten ihrer Bürgerinnen. In einem technischen Sinne sind die USA also keine Demokratie mehr.
Nun besteht durchaus Anlass zu der Sorge, dass diese Diagnose auch für viele andere vordergründig demokratische Länder gilt. Seit Jahrzehnten schon beklagt man das »Demokratiedefizit« der EU. Die griechischen Parlamentswahlen von 2015 stellen vielleicht das offensichtlichste Beispiel für dieses Defizit dar: Hier wurde eine bestimmte Partei wegen eines bestimmten Wirtschaftsprogramms von einer Mehrheit der Bürgerschaft demokratisch gewählt. Statt dieses Programm allerdings in die Tat umzusetzen, betrieb die neue Partei am Ende jedoch wieder genau dieselbe Sparpolitik, die eine große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger gerade abgewählt hatte. Die Ergebnisse der jüngsten europäischen Wahlen (wie in Italien) und Referenden (etwa des Brexits) bestätigen diesen negativen Trend. Die Bürger fühlen sich von ihren politischen Institutionen im Stich gelassen und nicht mehr repräsentiert. Diese wachsende Unzufriedenheit weist darauf hin, dass es überall höchste Zeit ist, die demokratischen Kontrollmöglichkeiten der Bevölkerung zu stärken. Und es ist ja genau der allgemeine Wunsch, to take back control, der gegenwärtig zu einem solchen Aufschwung des Populismus geführt hat. Die populistischen Angriffe auf die traditionellen Ideale und Institutionen der Demokratie machen aber auch deutlich, warum wir uns im Hinblick auf die Demokratie nicht in Sicherheit wiegen dürfen. Zahlreiche Titel jüngerer Veröffentlichungen – Der Zerfall der Demokratie, Wie Demokratien sterben, Authoritaria13nism in America, So endet die Demokratie[3] – zeugen von einer Sorge um die Demokratie beziehungsweise um die Gefahr einer demokratischen »Entkonsolidierung«; eine Sorge, die auch unsere bisher tiefsitzende Überzeugung untergräbt, die Demokratie sei eine unhintergehbare Errungenschaft.[4]
Die zugrundeliegende Befürchtung – der Bürger wie der Wissenschaftlerinnen – ist offenbar, dass das Grundgerüst der Rechte und Chancen auf politische Mitgestaltung, das demokratische Gesellschaften ihren Bürgerinnen gewähren, derzeit an politischer Bedeutung verliert.[5] Diese Rechte und Chancen scheinen nicht mehr hinreichend zu gewährleisten, dass Bürger auch wirklich die Möglichkeit haben, die Politik, der sie unterworfen sind, mitzugestalten und als ihre eigene zu betrachten. Angesichts der mangelnden Ansprechbarkeit des politischen Systems für seine Bürger können sich diese nicht mehr als gleichberechtigte Partner in einem demokratischen Projekt der Selbstregierung begreifen. Auch wenn sie nach wie vor alle formalen Rechte demokratischer Teilhabe genießen, verlieren diese Rechte doch gerade ihren »fairen Wert« – um einen Ausdruck von John Rawls zu gebrauchen.[6] Es scheint vor diesem Hintergrund also notwendig zu sein, den fairen Wert der gegenwär14tigen Bürgerrechte und die realen Einflussmöglichkeiten der Bürger auf die Politik zu vergrößern, um Demokratiedefiziten zu begegnen. Damit sich der politische Prozess wieder mehr nach den Interessen, Meinungen und politischen Zielen der Bürgerinnen und Bürger richten kann, sollten demnach institutionelle Reformen deren Möglichkeiten zu einer Beteiligung an Entscheidungsprozessen, die die Politik auch wirklich beeinflussen, möglichst stärken und nicht schwächen.[7]
Obwohl dies den intuitiven Kernsinn der Klagen über Demokratiedefizite – von Bürgerinnen, politischen Organisationen und Wissenschaftlerinnen – ausmacht, finden genau diese Bedenken in den wichtigsten demokratietheoretischen Debatten keinen ausreichenden Niederschlag. Versucht man nämlich, sich im Feld normativer Demokratietheorien einen Überblick darüber zu verschaffen, wie demokratische Institutionen gestärkt beziehungsweise wie umgekehrt Demokratiedefizite verringert werden könnten, erkennt man schnell, dass schon bei der Frage, was das Ideal der Demokratie eigentlich verlangt, große Uneinigkeit herrscht. Nicht anders verhält es sich im Hinblick auf die daran anknüpfende Frage, welche institutionellen Reformen heutige Gesellschaften dem Ideal der Demokratie näherbrächten. Im Folgenden möchte ich diese Debatte um die Formulierung und Begründung einer partizipatorischen Interpretation deliberativer Demokratie ergänzen.[8] Erst mit ihrer Hilfe lässt 15sich meines Erachtens das demokratische Potential neuerer institutioneller Reformvorschläge beurteilen, die sich gegenwärtig unter Demokratietheoretikerinnen immer größerer Beliebtheit erfreuen. Ich möchte in diesem Zusammenhang vor allem zeigen, dass einige Vorschläge, die gerne als demokratische Verbesserungen angepriesen werden, die heutigen Demokratiedefizite nicht nur nicht beseitigen, sondern möglicherweise sogar verschärfen würden. Der Weg in eine undemokratische Hölle könnte durchaus mit guten demokratischen Vorsätzen gepflastert sein.
Vorschläge zu einer Reform der bestehenden demokratischen Institutionen werden oft als praktische »Abkürzungen« für die Lösung schwieriger Probleme des demokratischen Regierens verkauft. Dagegen möchte ich deutlich machen, dass derart abkürzende Verfahren, durch die man die öffentliche Deliberation über politische Entscheidungen zu umgehen versucht, unser grundlegendes Festhalten am demokratischen Ideal der Selbstregierung nur noch weiter erschweren würden. Durch solche verkürzten Verfahren würde nämlich noch weniger gewährleistet, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger die Institutionen, Gesetze und Regelungen, denen sie unterworfen sind, gleichermaßen zu eigen machen und sich mit ihnen identifizieren können. Dieses Festhalten am demokratischen Ideal ist in pluralistischen Gesellschaften recht mühsam und ein zerbrechliches Gut. Die Versuchung ist somit groß, eine solche Selbstverpflichtung einfach zu »überspringen« und abkürzende Verfahren zu wählen, mit denen politische Entscheidungen aus dem öffentlichen Raum herausgehalten werden können, um Schwierigkeiten wie die Überwindung fundamentaler Meinungsverschiedenheiten, die politische Ignoranz der Bürgerinnen und Bürger oder eine qualitativ schlechte Deliberation im öffentlichen Raum zu umgehen.[9] Wie ich aber zei16gen möchte, würden die ausschließenden und entfremdenden Konsequenzen jener »Abkürzungen« zu einer Erosion der gegenseitigen Empathie und staatsbürgerlichen Solidarität zwischen den Bürgern führen. Die Demokratie kann allerdings auf diese Ressourcen nicht verzichten. Das demokratische Ideal, sich wechselseitig als Freie und Gleiche zu behandeln, lebt von der Selbstverpflichtung, einander von der Vernünftigkeit allgemein verbindlicher politischer Entscheidungen zu überzeugen, und dieses Ideal verkümmert, wenn wir uns gegenseitig schlicht zu Gehorsam nötigen. Nur wenn sich Bürgerinnen und Bürger wirklich verpflichtet fühlen, einander zu überzeugen, können sie sich mit den Institutionen, Gesetzen und Regelungen, denen sie unterworfen sind, auch weiterhin identifizieren und sie ohne Entfremdung als ihre eigenen begreifen. Der gegenwärtige Aufstieg des Populismus zeigt an, welche Gefahr Demokratien droht, die diese Bedenken kurzerhand in den Wind schlagen. Im Rahmen dieser »Abkürzungsvorschläge« wird außerdem blauäugig unterstellt, dass eine politische Gemeinschaft zu besseren Ergebnissen käme, wenn sie die realen Überzeugungen und Einstellungen ihrer eigenen Bürger außer Acht ließe. Doch leider gibt es keine Schnellverfahren, um eine politische Gemeinschaft besser zu machen als ihre Mitglieder, so wenig wie eine Gemeinschaft Fortschritte erzwingen kann, indem sie ihre Bürgerinnen und Bürger übergeht. Der einzige Weg, um zu politisch besseren Ergebnissen zu gelangen, ist der lange partizipatorische Weg: wenn Bürgerinnen dadurch zu einem kollektiven politischen Willen finden, dass sie ihre Mitbürgerinnen 17und Mitbürger im Herzen und Denken davon überzeugen, ihre Einstellungen zu ändern. Das Bekenntnis zur Demokratie besteht einfach in der Einsicht, dass es keine Abkürzungen gibt. So mühsam, fragil und risikoreich der Prozess des gegenseitigen Rechtfertigens politischer Entscheidungen durch eine öffentliche Deliberation auch sein mag – wir werden dem demokratischen Ideal keinen Deut näher kommen, wenn wir diesen Prozess überspringen. Tatsächlich würden wir uns dadurch nur noch weiter von ihm entfernen.
Diese spezielle These wird im Folgenden meine gesamte Argumentation in zwei wesentlichen Hinsichten leiten und beschränken: Zunächst einmal basiert die von mir vertretene partizipatorische Interpretation deliberativer Demokratie auf einer, wie man sagen könnte, »ökumenischen« Deutung des demokratischen Ideals der Selbstregierung. Ich habe nicht die Absicht, eine voll ausgearbeitete Bestimmung oder gar Letztbegründung der zentralen Werte dieses Ideals zu liefern. Mein »ökumenischer« Ansatz soll vielmehr für Leserinnen und Leser mit einem jeweils ganz unterschiedlichen Verständnis dieser Werte, ihrer relativen Bedeutung, ihrer internen Verbindungen und so weiter attraktiv sein.[10] Das ist insofern wichtig, als mein Argument gegen konkurrierende Demokratiekonzeptionen (und die sich aus ihnen ergebenden Reformvorschläge) darauf hinausläuft, dass es diesen konkurrierenden Konzeptionen nicht gelingt, dem demokratischen Ideal der Selbstregierung unter gleich welcher plausiblen Interpretation dieses Ideals gerecht zu werden. Leserinnen müssen also die besondere Konzeption deliberativer Demokratie, die ich im zweiten Teil des Buches entfalte, keinesfalls akzeptieren, um meine Kritik an den anderen Konzeptionen (und ihren entsprechenden Reformvorschlägen) in seinem ersten Teil überzeugend zu finden. Doch darüber hinaus möchte ich zeigen, dass man 18den wichtigen Bedenken, die von jeder dieser alternativen Demokratiekonzeptionen zum Ausdruck gebracht werden, besser durch ein partizipatorisches Verständnis deliberativer Demokratie Rechnung trägt. So gesehen hat meine Analyse der alternativen Konzeptionen nicht nur einen negativen Sinn: Indem ich die demokratischen Bedenken all dieser Ansätze durcharbeite, kann ich zeigen, dass Vertreterinnen der genannten Ansätze nach ihren eigenen Maßstäben gute Gründe haben, die von mir entwickelte Konzeption zu befürworten. Zweitens versuche ich angesichts meiner argumentativen Ziele, weder eine Rechtfertigung des demokratischen Ideals der Selbstregierung an sich noch eine Rechtfertigung der Demokratie als einer nichtdemokratischen Konkurrenten überlegenen Form der politischen Organisation zu geben. Sowohl bei der Entfaltung dessen, was das demokratische Ideal der Selbstregierung nach meinem Verständnis beinhaltet, als auch im Rahmen meiner Begründung, dass alternative Interpretationen dieses Ideals ihm in Wirklichkeit nicht gerecht werden können, setze ich die Zugkraft des Ideals der Selbstregierung für demokratische Staatsbürger voraus.
Angesichts der zuvor angedeuteten Entwicklungen mag die Beschränkung, die ich mir damit auferlege, besonders unzeitgemäß erscheinen. Wem um die Demokratie nicht bange ist, dem mag es so vorkommen, als würde ich mit der Explikation des demokratischen Ideals der Selbstregierung Eulen nach Athen tragen; und das ausgerechnet in einer Zeit, in der das oberste Gebot sein sollte, die Überlegenheit der Demokratie gegenüber nichtdemokratischen Alternativen zu verteidigen. Wer die Aussichten der Demokratie eher skeptisch beurteilt, wird mein Projekt wiederum vermutlich nur als vergeblichen Versuch ansehen, »die Dinge ins rechte Licht zu rücken« – oder anders gesagt: sich mit der Demokratie im Augenblick ihres Sturzes solidarisch zu erklären.[11] Ich muss diesen Vorwürfen 19insofern recht geben, als sich meine Argumente im Wesentlichen an demokratische Bürgerinnen und Bürger richten.[12] Ich wende mich mit diesem Buch als Bürgerin an andere Bürgerinnen und Bürger, was ich weder für überflüssig noch für unzeitgemäß halte. Bücher über Demokratie, die aus Sicht der Bürgerinnen geschrieben sind, sind rar. Die meisten sprechen aus der Beobachterperspektive der dritten Person. Sofern Bürger überhaupt darin vorkommen, wird über sie gesprochen, nicht mit ihnen. Und was dort über sie gesagt wird, ist oft ziemlich abfällig. Wie wir sehen werden, werden Bürgerinnen und Bürger in der Regel als politisch ignorant, irrational, apathisch, kindisch, unverantwortlich, mitunter sogar als tribalistisch dargestellt. Dieser Blick wird von einer bestimmten Forschungsrichtung, die sich im Wesentlichen auf empirische Untersuchungen 20über die politische Ignoranz der Bürger stützt, besonders eifrig propagiert. Die Parallelen zwischen ihrer Argumentationsweise und den historischen Argumenten gegen Frauenrechte – besonders gegen die politischen Rechte von Frauen – sind verblüffend.[13] Die empirischen »Beweise«, die damals angeführt wurden, um die Ignoranz, Irrationalität, Apathie und Unverantwortlichkeit von Frauen zu belegen, und die Argumente, die man noch vor nicht allzu langer Zeit vorbrachte, um ihre Unterwerfung fortzuschreiben, ähneln auf erstaunliche Weise den Argumenten und Belegen, die gegenwärtig von der Fachliteratur zur »Wählerunwissenheit« beigebracht werden.
Genau wie bei den historischen Plädoyers gegen Frauenrechte ist das Problem mit dieser Literatur nicht unbedingt die empirische Datenbasis, auf die sie sich beruft. Unter den damaligen Umständen fehlender Bildungschancen für Frauen und angesichts der Tatsache, dass sich Frauen praktisch nicht am zivilgesellschaftlichen und politischen Leben beteiligen konnten, waren ihre politische Ignoranz und Gleichgültigkeit kaum überraschend. Das Problem ist also nicht unbedingt die Fragwürdigkeit solcher empirischen Datensammlungen an sich.[14] Das Problem ist vielmehr, dass der Ge21brauch derselben eine doppelte Funktion zu erfüllen hatte: Der Ausschluss von Frauen sollte auf diese Weise nicht nur belegt, sondern im selben Moment auch festgeschrieben und gerechtfertigt werden. Beweise für die Abwesenheit von Frauen in Machtpositionen und ihr fehlendes politisches Engagement wurden als Begründung für die Behauptung vorgebracht, Frauen seien nicht in der Lage, politische Rechte auszuüben. Das Hauptproblem an diesem Argumentationstypus ist also nicht die Verlässlichkeit seiner empirischen Datenbasis, sondern die spezielle normative Empfehlung, die daraus abgeleitet wird: dass Frauen ihren Zustand akzeptieren und sich auch weiterhin von Männern beherrschen lassen sollten, statt um eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen und politischen Rechte zu kämpfen. Genauso wenig muss man bestreiten, dass Bürger vielleicht politisch ignorant oder gleichgültig sind, um die sich daran anschließende normative Empfehlung in Frage zu stellen, sie sollten ihre Lage einfach akzeptieren und sich von anderen regieren lassen, statt sich für eine Verbesserung ihrer Verhältnisse einzusetzen. Nicht anders als im Zuge des politischen Kampfes um Frauenrechte lässt sich nämlich, erst wenn die wesentlichen negativen Umstände und Institutionen beseitigt sind, herausfinden, ob Bürgerinnen und Bürger fähig sind, ihre politische Macht klug zu gebrauchen.[15] Solange das nicht geschehen ist, gibt es keine erforderliche empirische Grundlage und somit keinen guten Grund dafür, an der genannten Empfehlung festzuhalten.[16] Ein auffälliger Unterschied zwischen der Literatur über die »Wählerunwissenheit« und entsprechenden Vorstößen in Bezug auf andere askriptive Gruppen 22(zum Beispiel Frauen, Afroamerikaner, Homosexuelle, religiöse Minderheiten und so weiter) ist, dass Erstere in keiner Weise auf eine politisch korrekte Ausdrucksweise Rücksicht nehmen muss. Ganz im Gegenteil: Argumente, die begründen möchten, warum Bürgerinnen auf ihre demokratischen Rechte verzichten und sich lieber von anderen regieren lassen sollten, stehen hoch im Kurs, ja gelten gar als »wissenschaftlich erwiesen«!
Als Bürgerin, die in einer Diktatur groß geworden ist und den hart erkämpften Übergang zur Demokratie miterlebt hat, betrachte ich die Demokratie nicht als eine Selbstverständlichkeit. Ich weiß, dass demokratische Rechte nicht freiwillig gewährt werden, sondern erkämpft werden müssen. Man muss sie einfordern und zurückfordern, wenn die Mächtigen sie zu untergraben drohen. Nur Bürger und Bürgerinnen können das tun. Dafür aber muss uns klar sein, was sich zu verteidigen und zurückzufordern lohnt: welche Vorschläge uns Bürgerinnen helfen können, (wieder) demokratische Kontrolle zu erlangen, und welche zwar vielversprechend aussehen, uns dem politischen Prozess aber letztlich nur weiter entfremden würden. Gerade jetzt scheint es besonders an der Zeit herauszufinden, für welche konkreten demokratischen Rechte sich zu kämpfen lohnt, da das Schicksal der Demokratie, wie Optimisten und Skeptiker gleichermaßen anerkennen, auf der Kippe steht. Wir Bürgerinnen müssen unsere politischen Institutionen fordern, wir müssen sie uns aneignen, soll die Demokratie überhaupt noch eine Chance haben. Vor diesem Hintergrund möchte ich kurz meine Vorschläge erläutern.
Im Folgenden soll, wie gesagt, eine partizipatorische Konzeption deliberativer Demokratie formuliert und begründet werden. Die Literatur zur deliberativen Demokratie ist umfangreich, und auch mein Projekt ist ein Beitrag dazu. Was in dieser Literatur aber zu kurz kommt, ist eine hinreichende Betonung des partizipatorischen Moments des demokratischen Ideals der Selbstregierung.[17] Das 23liegt meines Erachtens unter anderem daran, dass uns ein angemessener Begriff demokratischer Teilhabe fehlt – genauer gesagt: einer, der sowohl aufnahmefähig für deliberative Anliegen als auch für Massendemokratien tauglich wäre. Um eine solche Konzeption im Austausch mit anderen Demokratiebegriffen zu entwickeln, muss man zunächst eine gewisse Vorstellung davon haben, was das demokratische Ideal insgesamt beinhaltet. In Kapitel 1 untersuche ich das demokratische Ideal der Selbstregierung, um deutlich zu machen, dass es sich nicht auf das Ideal politischer Gleichheit reduzieren beziehungsweise mit diesem gleichsetzen lässt. Politische Gleichheit ist notwendig, aber nicht hinreichend für Demokratie. Auch eine Form von demokratischer Kontrolle der Bürger über den politischen Entscheidungsprozess ist wesentlich für das demokratische Ideal. Das mag selbstverständlich erscheinen. Seltsamerweise aber konzentrieren sich all die unterschiedlichen Demokratiekonzeptionen, die ich in den ersten Kapiteln des Buches analysiere, auf das Ideal der politischen Gleichheit zulasten des Ideals der demokratischen Kontrolle – das heißt der Fähigkeit der Bürgerinnen, die Politik, der sie unterworfen sind, zu gestalten und als ihre eigene gutzuheißen.
Dabei sei zugestanden, dass es in der Praxis nicht immer leichtfällt, klar zwischen politischer Gleichheit und demokratischer Kontrolle zu unterscheiden. Doch um den Einfluss unterschiedlicher Demokratiekonzeptionen und ihrer Reformvorschläge auf die demokratische Kontrolle zu beurteilen, ist ein hilfreiches Kriterium, in welchem Maße sie von den Bürgern erwarten oder verlangen, sich den Entscheidungen anderer blind zu fügen.[18] Man beachte, dass es 24hier nicht darum geht, ob von den Bürgern verlangt wird, sich den politischen Entscheidungen anderer zu fügen. Alle repräsentativen Demokratien verlangen das von ihren Bürgern. Die Frage ist vielmehr, ob auch erwartet wird, dass sie dies blind tun. Repräsentative Demokratien erwarten von ihren Bürgerinnen, dass sie politische Entscheidungen an ihre Vertreterinnen, Beamtinnen und so weiter delegieren. In dem Maße aber, wie Bürgerinnen ein Mindestmaß an Kontrollmöglichkeiten über diese Akteure zugemessen bleibt, tun sie es eben nicht blind. Im Gegensatz dazu ist ihr Sichfügen – ihre »Überantwortung« – blind, wenn keine derartige Kontrollmöglichkeit besteht. Der Unterschied zwischen beidem lässt sich folgendermaßen erläutern: Im ersten Fall, dem der gewählten Repräsentation, hat man einen gewissen (schwachen) Grund zu der Annahme, dass die von den politischen Akteuren, denen man sich fügt, getroffenen Entscheidungen auch die sind, die man selbst aufgrund der eigenen Interessen, Werte und politischen Zielsetzungen getroffen hätte, wenn man die Angelegenheit im Besitz aller relevanten Informationen durchdacht hätte. Im zweiten Fall hingegen besteht kein Grund zu dieser Annahme – die Entscheidungen dieser Akteure könnten, nach allem, was man wissen kann, so, aber genauso gut gegenteilig ausfallen. Damit soll nicht bestritten werden, dass wir gute Gründe haben können, uns Entscheidungen anderer blind zu fügen. Diese Überlegungen dienen lediglich dem Hinweis, dass wir in all solchen Fällen bezüglich dieser Entscheidungen kein demokratisches Projekt der Selbstregierung mehr verfolgen. Worauf wir uns unter diesen Umständen vielmehr festgelegt hätten, wäre, dass die entsprechenden Entscheidungen sich eben nach ihren und nicht nach unseren wohlüberlegten Urteilen richten sollen und dass wir bereit sind, diesen Entscheidungen blind Folge 25zu leisten, wie auch immer sie aussehen mögen.[19] Die Erwartung einer solchen blinden Überantwortung (blind deference) ist mit dem demokratischen Ideal der Selbstregierung gänzlich unvereinbar.[20] Sie bildet damit einen plausiblen Maßstab für die Bewertung der demokratischen Versprechen verschiedener Demokratiekonzeptionen und ihrer Vorschläge für institutionelle Reformen. Wie ich in diesem Buch noch im Einzelnen zeigen werde, stehen diese Konzeptionen und Vorschläge umso weniger mit dem demokratischen Ideal der Selbstregierung in Einklang, je mehr sie von Bürgerinnen erwarten, sich den Entscheidungen anderer blind zu fügen, und damit die Möglichkeit einer dauerhaften Nichtübereinstimmung der Überzeugungen und Einstellungen der Bürger mit den Gesetzen und Regelungen, denen sie unterworfen sind, in Kauf nehmen. Anhand des vorgeschlagenen Maßstabs lassen sich also leichter die demokratischen Defizite von Demokratiekonzeptionen identifizieren, die bei aller Unterschiedlichkeit doch immer wieder »Abkürzungen« propagieren, mit denen eine öffentliche Deliberation politischer Entscheidungen umgangen würde (Kapitel 2 bis 4). Mit einem solchen Maßstab lässt sich andererseits auch die Kon26zeption einer »unverkürzten Demokratie« klarer umreißen und begründen (Kapitel 5 bis 8).
Mangels einer überzeugenden Darstellung des partizipatorischen Ideals geben elitaristische oder rein epistemische Ansätze innerhalb der deliberativen Demokratietheorie heute den Ton an. Dadurch hat sich wiederum der Eindruck verfestigt, nur nichtdeliberative pluralistische Demokratiekonzeptionen – solche also, die ich als »radikalpluralistisch« oder »prozeduralistisch« bezeichne – könnten auf überzeugende Weise partizipatorische Ideale artikulieren. In Kapitel 2 analysiere ich deshalb die Grundannahmen radikalpluralistischer Demokratiekonzeptionen, um nachzuweisen, dass radikale Pluralisten keine substantielle Interpretation des demokratischen Ideals der Selbstregierung vorlegen können. Auffälligstes Merkmal der radikalpluralistischen Konzeptionen ist, dass sie Mehrheitsverfahren als abkürzende Lösung für das Problem grundlegenden Dissenses befürworten, während sie zugleich die politische Gleichheit in pluralistischen Gesellschaften zu bewahren suchen. Auch wenn eine solche pluralistische Demokratie ihren Bürgern die besondere Form von politischer Gleichheit, die die Verfahrensgerechtigkeit des Mehrheitsprinzips verkörpert, in Aussicht stellen kann, vermag sie doch nicht zu erklären, wie sich alle Bürgerinnen und Bürger mit den Institutionen und Regelungen, denen sie unterworfen sind, identifizieren und sich diese zu eigen machen können, wie es dem demokratischen Ideal der Selbstregierung nach zu fordern ist. Denn tatsächlich lässt die radikalpluralistische Befürwortung des Mehrheitsprinzips Minderheiten keine andere Wahl, als sich den Entscheidungen der Mehrheit blind zu fügen. Damit aber sind die Schleusen weit geöffnet für populistische Politikvorstellungen, für die das Ideal der politischen Inklusion außer Reichweite ist. Mehr noch: Während radikalpluralistische Konzeptionen auf den ersten Blick »realistischer« erscheinen mögen als deliberative Konzeptionen, haben sie doch keine plausible Erklärung für einige ihrer eigenen Grundannahmen zu bieten (etwa das Bestehen grundlegender Dissense in demokratischen Gesellschaften). Ich komme 27deshalb zu dem Schluss, dass radikalpluralistische Konzeptionen weder besonders attraktiv sind noch der Reflexion standhalten (nach reiflicher Überlegung würden die Bürger sie also nicht befürworten). Wie noch deutlich werden soll, haben Vertreter des radikalen Pluralismus recht damit, auf politischer Gleichheit und Partizipation ebenso zu bestehen wie auf der Notwendigkeit, eine angemessene Lösung für das Problem anhaltenden und grundlegenden Dissenses zu finden. Von diesen wertvollen Einsichten, so möchte ich im Folgenden zeigen, können wir aber nur dann profitieren, wenn wir uns nicht auf die Verkürzung demokratischer Entscheidungsfindung einlassen, sondern stattdessen den langen Weg der partizipatorischen deliberativen Demokratie einschlagen.
Auch wenn pluralistische Konzeptionen keine attraktive Interpretation des demokratischen Ideals der Selbstregierung anzubieten haben, so ist doch alles andere als ausgemacht, dass deliberative Konzeptionen dafür bessere Lösungen bereitstellen. Mit dieser Frage werde ich mich in Kapitel 3 auseinandersetzen. Ich unterscheide zwischen rein epistemischen und partizipatorischen Interpretationen des Ideals deliberativer Demokratie und zeige, dass auch erstere nicht imstande sind, eine substantielle Interpretation des demokratischen Ideals der Selbstregierung zu formulieren. Rein epistemische Theorien verfehlen die demokratische Bedeutung öffentlicher Deliberation nämlich insofern, als sie die Grundidee politischer Deliberation aus einer rein epistemischen Perspektive betrachten, die ausschließlich auf die inhaltliche Qualität der Ergebnisse ausgerichtet ist. Das verschafft technokratischen Politikansätzen Schubkraft, die von politischer Partizipation nichts wissen wollen und den einfachen Bürgern nahelegen, sich den Politikexperten blind zu fügen. Rein epistemische Theorien teilen in der Tat einige Grundüberzeugungen mit elitaristischen Demokratiekonzeptionen. Zu Recht unterstreichen epistemische Demokratietheorien, wie wichtig es ist, die Qualität der politischen Ergebnisse zu verbessern. Doch gerade wenn uns an der substantiellen Qualität der Ergebnisse gelegen ist, dürfen wir uns nicht auf eine expertokratische Ab28kürzung einlassen. Ich werde ausführlich darlegen, warum nur der lange partizipatorische Weg eine politische Gemeinschaft zu besseren Ergebnissen führt. Deshalb müssten sich auch Epistokraten, um ihre eigenen Standards zu erfüllen, eigentlich darum bemühen, den politischen Meinungs- und Willensbildungsprozess unter Beteiligung der Bürger zu verbessern, damit die politische Gemeinschaft überhaupt erst in die Lage versetzt wird, solche besseren Ergebnisse zu erreichen.
Doch auch die Ablehnung jener politischen Ungleichheit, die mit elitaristischen Theorien verbunden ist, führt nicht automatisch zu einer partizipatorischen Konzeption der deliberativen Demokratie. In Kapitel 4 analysiere ich einen Trend, der sich unter deliberativen Demokratinnen zunehmender Beliebtheit erfreut. Vertreterinnen einer »lottokratischen« Konzeption der deliberativen Demokratie legen ihre demokratischen Hoffnungen auf den allgemeinen Gebrauch deliberativer Mini-Öffentlichkeiten wie Planungszellen (auch: Bürgerforen), Bürgerversammlungen und Deliberationsforen. Ich werde insbesondere neuere Vorschläge untersuchen, Mini-Öffentlichkeiten mit deliberativer Entscheidungsgewalt auszustatten. Während manche Autoren diese Ideen aus einer rein epistemischen Perspektive verteidigen (etwa als Möglichkeit, die deliberative Qualität politischer Entscheidungen zu verbessern), sprechen sich viele deliberative Demokraten auch aus partizipatorischer Sicht für sie aus, weil sie glauben, diese Mini-Öffentlichkeiten würden die demokratische Kontrolle der Bürgerinnen über den politischen Prozess stärken. Meines Erachtens aber lassen sich solche Ideen nicht mit partizipatorischen Argumenten verteidigen. Denn da hier von den Bürgern erwartet wird, dass sie sich den politischen Entscheidungen einer zufällig ausgewählten Gruppe anderer Bürger blind fügen, würde der allgemeine Gebrauch von Mini-Öffentlichkeiten für politische Entscheidungsprozesse die Fähigkeit der Bürger, sich die politischen Maßnahmen, denen sie am Ende unterworfen sind, gemäß dem demokratischen Ideal der Selbstregierung zu eigen zu machen und sich mit ihnen zu identifizieren, eher verschlechtern als 29verbessern. Zu Recht unterstreichen Lottokraten das demokratische Potential einer Institutionalisierung deliberativer Mini-Öffentlichkeiten für politische Zwecke. Dieses Potential lässt sich aber nur ausschöpfen, wenn wir der »mikrodeliberativen« Abkürzung widerstehen und stattdessen unser makrodeliberatives Ziel fest im Auge behalten. Statt also deliberative Mini-Öffentlichkeiten dazu zu ermächtigen, dass sie stellvertretend für alle anderen Bürger entscheiden, sollten Bürger die Mini-Öffentlichkeiten vielmehr nutzen, um sich selbst zu ermächtigen. Aus partizipatorischer Perspektive schlage ich in Kapitel 5 eine alternative Analyse potentieller Einsatzmöglichkeiten von Mini-Öffentlichkeiten vor, die einen Beitrag zur Stärkung der demokratischen Kontrolle der Bürgerinnen leisten könnten. Würde man Mini-Öffentlichkeiten für kontestatorische, überwachende und antizipatorische Zwecke einsetzen, dann könnten Bürgerinnen und Bürger die Qualität der öffentlichen Deliberation verbessern und so das politische System zwingen, sie angemessen am eigentlichen politischen Prozess zu beteiligen. Solche Formen eines potentiellen »deliberativen Aktivistentums«[21] werde ich mittels empirischer Beispiele aus Deliberationsforen illustrieren, die James Fishkin im Laufe der vergangenen Jahrzehnte in über zwanzig Ländern durchgeführt hat. Ich möchte auf diese Weise herausfinden, inwiefern deliberative Mini-Öffentlichkeiten zur Verbesserung der demokratischen Qualität der politischen Deliberation in der Öffentlichkeit beitragen können. Damit diese potentielle Anwendung aber einleuchtet, muss gezeigt werden, dass eine inklusive politische Deliberation der Bürgerinnen und Bürger unter pluralistischen Bedingungen tatsächlich möglich ist, dass sich also alle Bürgerinnen als gleichberechtigte Teilnehmerinnen am politischen Projekt der Selbstregierung begreifen können.
30Mit dieser Schwierigkeit befasse ich mich im zweiten Teil des Buches, in dem ich meine eigene partizipatorische Interpretation der deliberativen Demokratie formuliere, die das demokratische Ideal der Selbstregierung ins Zentrum stellt. Für diese Demokratiekonzeption ist es wesentlich, dass sich die Bürgerinnen mit dem politischen Projekt, an dem sie kollektiv beteiligt sind, identifizieren und es als ihr eigenes verstehen. Wenn wir dieses demokratische Anliegen als zentral begreifen, können wir besser beurteilen, worin das Problem der institutionellen Abkürzungen besteht, die erwarten oder fordern, dass sich Bürger den politischen Entscheidungen anderer blind fügen. In Kapitel 6 zeige ich im Einzelnen, warum rein epistemische oder lottokratische Konzeptionen deliberativer Demokratie die demokratische Bedeutung politischer Deliberation verfehlen. Hierin ist nämlich der Grund zu suchen, warum sie institutionelle Abkürzungen propagieren, die eine politische Beteiligung der Bürger umgehen. Ich behaupte, dass nicht eine Einbeziehung der epistemischen Dimension der Wahrheit in die Politik die Demokratietheorie in Gefahr bringt – wie es uns radikalpluralistische Ansätze weismachen wollen –, sondern vielmehr der Ausschluss der epistemischen Dimension einer Rechtfertigung gegenüber anderen. Denn eines ist die von deliberativen Demokratinnen geteilte Annahme, dass politische Auseinandersetzungen auf Dauer zu einem Konsens über die besten Antworten auf manche politischen Fragen führen können. Etwas ganz anderes ist es aber, die Tatsache zu ignorieren oder strikt auszuschließen, dass solche politischen Kämpfe wirklich und erfolgreich stattfinden müssen, wie es Epistokraten tun. Trotzdem ist es nicht ganz leicht, eine plausible Vorstellung davon zu entwickeln, wie sich die Bürger komplexer pluralistischer Gesellschaften wie der unseren dauerhaft an einer Praxis der gegenseitigen Rechtfertigung rechtlich bindender Politik beteiligen können. Dem Einwand, dass die Forderung wechselseitiger Rechtfertigung – die für deliberative Demokratinnen eine Bedingung demokratischer Legitimität darstellt – zu anspruchsvoll sei, kann man auf mindestens dreierlei Weise begegnen: durch eine hy31pothetische, eine aspirationale oder eine institutionelle Auslegung dieser Rechtfertigungspraxis. Zunächst werde ich die Schwierigkeiten der ersten beiden Auslegungen erläutern, um anschließend die Tragfähigkeit eines institutionellen Ansatzes zu begründen. Der wesentliche Vorteil dieser theoretischen Strategie besteht darin, dass demokratische Legitimität nach institutioneller Lesart nicht bedeutet, jede einzelne Person müsste zu jedem beliebigen Zeitpunkt die Vernünftigkeit jedes rechtlich bindenden Gesetzes, dem sie unterworfen ist, anerkennen. Ein solcher Ansatz erfordert lediglich das Vorhandensein von Institutionen, die Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit geben, alle Gesetze und Regelungen, die sie nicht aus guten Gründen akzeptieren können, anzufechten und zu verlangen, dass ihnen entweder angemessene Gründe vorgelegt oder die Gesetze und Regelungen geändert werden. In dem Maße, wie allen Bürgerinnen, und das heißt auch denen, die gerade in der Minderheit sind, solche Institutionen zur Verfügung stehen, können sie sich als gleichberechtigte Mitglieder eines kollektiven politischen Projekts der Selbstregierung begreifen.
Doch die Existenz und Legitimität dieser Institutionen hängt davon ab, dass sich Dissense zwischen Bürgern letztlich überwinden lassen und der Prozess gegenseitiger Rechtfertigung tatsächlich erfolgreich verlaufen kann. Wie in Kapitel 2 erläutert, stellen radikalpluralistische Demokratiekonzeptionen diese Annahme in Frage. Um mein Argument zu vervollständigen, muss ich deshalb zeigen, dass die von mir vertretene partizipatorische Konzeption die Herausforderung der radikalpluralistischen Demokratietheorien beantworten kann. Diesem Problem sind die letzten beiden Kapitel des Buches gewidmet: In Kapitel 7 entfalte ich eine partizipatorische Konzeption der öffentlichen Vernunft. Sie soll deutlich machen, wie Bürgerinnen einer deliberativen Demokratie im Laufe der Zeit ihre Dissense überwinden und politische Streitfragen klären können, ohne die prozeduralen Abkürzungen akzeptieren zu müssen, die Vertreterinnen eines radikalen Pluralismus als die beste und einzige Lösung ansehen. Zu diesem Zweck setze ich mich aus 32der Perspektive des demokratischen Ideals der Selbstregierung kritisch mit den gegenwärtig wichtigsten Theorien öffentlicher Vernunft auseinander. Aus diesem Blickwinkel erscheint auch die anhaltende Debatte um die Rolle der Religion in der Öffentlichkeit in einem neuen Licht. Wenn wir die bekanntesten Begründungen für das Exklusions-, das Inklusions- und das Übersetzungsmodell aus demokratischer Perspektive analysieren, sehen wir, dass keines von ihnen zu erklären vermag, wie sich alle – gläubigen oder säkularen – Bürgerinnen und Bürger als gleiche Teilnehmer an einem kollektiven Projekt der Selbstregierung begreifen können. Dem halte ich eine partizipatorische Konzeption der öffentlichen Vernunft entgegen, um zu zeigen, dass die politische Deliberation in der Öffentlichkeit ein inklusiver Prozess sein kann, der es allen Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, sich an der Praxis gegenseitiger Rechtfertigung zu beteiligen und ungeachtet tiefgreifender Meinungsverschiedenheiten Einfluss auf ihre jeweiligen Sichtweisen zu gewinnen. Die Argumentation erfolgt in zwei Schritten: Zunächst einmal muss man identifizieren, was genau demokratische Bürger in die Lage versetzt, trotz anhaltender begründeter Dissense schließlich doch zu gemeinsamen Ansichten über die richtigen Antworten auf politische Fragen zu finden. Im letzten Abschnitt von Kapitel 7 erkläre ich zu diesem Zweck die Vorrangigkeit öffentlicher Gründe und führe einen Vorbehalt der gegenseitigen Rechenschaftspflicht (mutual accountability proviso) ein. Auch wenn sich mein Ansatz stark an Rawls anlehnt, gibt es doch ein paar wesentliche Unterschiede. Insbesondere ist es aus Sicht des von mir vertretenen institutionellen Ansatzes nicht ausreichend, dass sich Bürger auf eine bestehende moralische Bürgerpflicht (Rawls) verlassen können. Was sie darüber hinaus brauchen, sind wirksame Rechte der politischen und juristischen Anfechtung, die es ihnen erlauben, einen Prozess der öffentlichen Rechtfertigung der Vernünftigkeit aller politischen Regelungen, die sie inakzeptabel finden, anzustoßen.
Um aber zu begründen, wie dieses Verfahren unter pluralistischen Bedingungen gelingen kann, muss man jene Eigenschaften demo33kratischer Institutionen und Praktiken identifizieren, die eine Struktur von Prozessen der Meinungs- und Willensbildung ermöglichen, durch die sich Meinungsverschiedenheiten zwischen Bürgern mit sehr unterschiedlichen Ansichten, Interessen, Einstellungen und so weiter begründet überwinden lassen. Das ist die Aufgabe von Kapitel 8, in dem ich die demokratische Bedeutung des Bürgerrechts auf juristische Anfechtung analysiere, um mich dem für deliberative Demokraten wohl größten Problem zu stellen: wie nämlich genuin partizipatorische Demokratiekonzeptionen nicht-majoritäre deliberative Institutionen wie die (nationale und internationale) Normenkontrolle begründen können. Zu diesem Zweck möchte ich zeigen, was an der radikalpluralistischen Interpretation der Normenkontrolle als einer expertokratischen Abkürzung, die angeblich von Bürgerinnen und Bürgern verlangt, sich den politischen Entscheidungen von Richtern blind zu fügen, falsch ist. Gegen diese weit verbreitete Ansicht argumentiere ich, dass die demokratische Bedeutung der Institution der Normenkontrolle darin besteht, dass sie Bürger dazu ermächtigt, effektiv von ihrem Recht Gebrauch zu machen, sich an den laufenden politischen Auseinandersetzungen um den richtigen Umfang, Inhalt und die angemessenen Grenzen ihrer Grundrechte und Grundfreiheiten zu beteiligen – ganz unabhängig davon, wie idiosynkratisch ihre Mitbürger ihre Interessen, Ansichten und Werte finden mögen. Indem die (nationale oder transnationale) Normenkontrolle das staatsbürgerliche Recht auf juristische Anfechtung garantiert, eröffnet sie Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich den Entscheidungen ihrer Mitbürger nicht blind fügen zu müssen. Durch die juristische Überprüfung wird ein institutioneller Ort geschaffen, an dem Mitbürger zur Rechenschaft gezogen werden können, weil dort im Rahmen einer öffentlichen Debatte angemessene Gründe verlangt werden, um Gesetze und politische Maßnahmen zu rechtfertigen, denen alle Bürger unterworfen sind. Der wesentliche Beitrag der Normenkontrolle zur politischen Rechtfertigung besteht also nicht darin, dass Gerichte losgelöst von den politischen Debatten in der Öffentlichkeit die Verfassungsmäßig34keit von Regelungen prüfen, so als müsste die Gerechtigkeit erst in Richterrobe auftreten, um dem Vorrang öffentlicher Gründe zu seinem Recht zu verhelfen. Der wesentliche Beitrag der Normenkontrolle zur politischen Rechtfertigung besteht umgekehrt darin, dass er Bürger ermächtigt, gewissermaßen alle anderen Bürger dazu aufzurufen, »ihre Roben anzulegen«, damit sie begründen, wie die von ihnen favorisierten Regelungen im Einklang mit dem gleichen Schutz der Grundrechte und -freiheiten aller Bürger stehen. Dank dieser kommunikativen Macht können sich alle Bürgerinnen als politisch Gleiche an dem fortlaufenden Prozess der Bildung und Ausgestaltung einer wohlüberlegten öffentlichen Meinung zur Begründung der politischen Entscheidungen beteiligen, die sie dann auch als ihre eigenen ansehen und mit denen sie sich identifizieren können – gerade so, wie es das demokratische Ideal der Selbstregierung verlangt.
35IWarum deliberative Demokratie?
371 Das demokratische Ideal der Selbstregierung
Der demokratische Prozess ist eine Wette auf die Chancen, dass ein selbstbestimmt handelndes Volk lernen wird, richtig zu handeln.
Robert Dahl, Democracy and its Critics
In diesem Buch entfalte ich eine partizipatorische Interpretation der Demokratie auf der Grundlage einer »ökumenischen« Deutung des demokratischen Ideals der Selbstregierung. Gemeint ist damit eine Deutung, die von demokratischen Bürgerinnen und Bürgern mit ganz unterschiedlichen Einstellungen zu den Fragen, warum die Demokratie einen Wert hat, wie sich ihr Wert zu anderen Werten und Idealen verhält und dergleichen, befürwortet werden kann.[22] 38Aus diesem Grund möchte ich im Folgenden lediglich die Kernelemente des demokratischen Ideals der Selbstregierung benennen, ohne eine umfassende (detaillierte und spezifische) Vorstellung von diesem Ideal zu entwickeln. Das ist insofern wichtig, als mein Hauptargument gegen alternative Demokratiekonzeptionen und ihre institutionellen Reformvorschläge darauf hinausläuft, dass sie dem demokratischen Ideal der Selbstregierung nicht gerecht werden können, welche minimal plausible Interpretation dieses Ideals auch immer man anlegt.
Für meine Zwecke ist ebenfalls wichtig, dünne Deutungen des demokratischen Ideals nicht auszuschließen. Das entspricht nicht nur meinem ökumenischen Ansatz, sondern soll auch gewährleisten, dass das demokratische Ideal seine Bedeutung und seine handlungsleitende Funktion für komplexe Gesellschaften wie die unseren behält. Unter der dichtesten, anspruchsvollsten Deutung könnte man das Ideal der Selbstregierung so auslegen, dass buchstäblich alle, die dem Gesetz unterworfen sind, gleichzeitig auch die Autoren und Autorinnen des Gesetzes sein müssen. Die Forderung, dass alle Mitglieder des Gemeinwesens an allen politischen Entscheidungen, von denen sie betroffen sind, auch unmittelbar mitzuwirken haben, würde das Ideal mit einer repräsentativen Staatsform unvereinbar und für komplexe Gesellschaften ungeeignet machen. Damit soll nicht bestritten werden, dass die Urheberschaft an der politischen Entscheidungsfindung einen unerlässlichen Bestandteil des demokratischen Ideals darstellt. Denn gewiss zählen politische Systeme, in denen es Bürgern niemals gestattet ist, wichtige politische Entscheidungen zu treffen (etwa per Stimmabgabe), nicht als demokratisch. Doch politische Systeme mit repräsentativen Strukturen, in denen sich Bürger an Entscheidungsprozessen beteiligen, gelten 39auch dann als »demokratisch«, wenn diese Beteiligung, so wie in allen Demokratien heutzutage, ziemlich beschränkt ist. Wenn das Ideal der Selbstregierung also nicht verlangt, dass Bürgerinnen buchstäblich an allen politischen Entscheidungen beteiligt sind, dann müssen wir abgesehen von der Urheberschaft noch einen anderen Aspekt der Bürgerbeteiligung bestimmen können, der deutlich macht, was das Ideal der Selbstregierung von repräsentativen Demokratien fordert.
1.1 Politische Gleichheit versus demokratische Kontrolle: Das Problem blinder Überantwortung
Das Ideal, keinen Gesetzen unterworfen zu sein, als deren Autorin man sich nicht begreifen kann, entspricht dem Wunsch, nicht zu blindem Gehorsam gezwungen zu sein. Anders ausgedrückt möchte das Ideal ausschließen, dass jemand gezwungen wird, Gesetze zu befolgen, die er oder sie selbst nach reiflicher Überlegung nicht wenigstens als vernünftig akzeptieren kann. Die Vermeidung reinen Zwangs erfordert nicht, dass jemand buchstäblich Urheber der Gesetze ist; sie erfordert aber sehr wohl, dass er den Gesetzen aufgrund seiner Einsicht in ihre Vernünftigkeit gehorchen kann. Man muss in der Lage sein, sich mit den Gesetzen zu identifizieren oder sie nach reiflicher Überlegung zu akzeptieren. In seinem Buch Republicanism findet Philip Pettit einen klaren Ausdruck für diese Idee. Der Unterschied zwischen demokratischen und nichtdemokratischen Formen politischer Entscheidungsprozesse besteht ihm zufolge darin, dass erstere
sich nach den Interessen und Vorstellungen der Bürger richten [tracks], die von ihnen betroffen sind […]. Es muss eine Form von Entscheidungsprozess sein, den wir uns zu eigen machen und mit dem wir uns identifizieren können: eine Form von Entscheidungsprozess, durch den wir unsere Interessen befördert und unsere Vorstellungen respektiert sehen. Unabhängig davon, ob Entscheidungen in der Gesetzge40bung, in der Verwaltung oder in den Gerichten getroffen werden, müssen sie Spuren unserer Art und Weise der Anteilnahme und des Denkens erkennen lassen.[23]
Dieser Idee zufolge können sich die Bürger in dem Maße als Teilnehmer an einem demokratischen Projekt der kollektiven Selbstregierung begreifen, wie sie imstande sind, sich mit den Gesetzen und Regelungen, denen sie unterliegen, zu identifizieren und diese als ihre eigenen zu betrachten. Eine permanente Abkopplung der Interessen, Gründe und Vorstellungen der Bürgerinnen von den real existierenden Gesetzen und Regelungen, die sie befolgen müssen, würde sie ihrer politischen Gemeinschaft entfremden. Um eine Deutung des demokratischen Ideals der Selbstregierung zu finden, die für komplexe Gesellschaften wie unsere handlungsleitend sein kann, müssen wir uns folglich mit dem Begriff der politischen Entfremdung auseinandersetzen.
Obwohl Pettit eine zutreffende Beschreibung dieses zentralen Aspekts des demokratischen Ideals der Selbstregierung liefert, dient ihm seine Analyse als Voraussetzung für ein mögliches Verständnis von Freiheit als Nicht-Beherrschung (non-domination). Doch ganz gleich, wie eng Beherrschung und Entfremdung in der Praxis zusammenhängen mögen, sind es doch unterschiedliche Phänomene. Bei der Frage politischer Herrschaft geht es um die Verteilung politischer Macht. Politisch beherrscht werde ich von anderen in dem Maße, wie sie mir ihre Entscheidungen (willkürlich) aufzwingen können, während ich nicht von ihnen beherrscht werde (zumindest nicht politisch), wenn ich genauso viel Entscheidungsgewalt besitze wie sie. Zweifellos ist die Sorge um politische Gleichheit beziehungsweise politische Nicht-Beherrschung wesentlich für das de41mokratische Ideal der Selbstregierung. Wie wir jedoch in Kapitel 4 sehen werden, schließt politische Gleichheit politische Entfremdung nicht aus. Denn die Sorge vor einer Entfremdung von Gesetzen, die man zwar befolgen muss, aber nicht einmal im Nachhinein befürworten kann, ist eine Sorge um die Substanz der Gesetze, nicht nur um die Machtverteilung zwischen den Entscheidungsbefugten. Die grundsätzliche Frage nach dem richtigen Inhalt der Gesetze und Regelungen, an die ich mich halten muss, unterscheidet sich von der zwischenmenschlichen Dimension der richtigen Beziehung zu den anderen, die ebenfalls am Entscheidungsprozess beteiligt sind. Politische Gleichheit ist für eine demokratische Selbstregierung notwendig, aber nicht hinreichend. Ich stimme Pettit zu, dass demokratische Kontrolle (in dem substantiellen Sinne des Vermeidens einer Abkopplung der Interessen und Vorstellungen der Bürgerinnen von den politischen Regelungen, denen sie unterworfen sind) hinreicht, um Beherrschung zu verhindern. Meine Sorge ist allerdings, dass sie Pettits eigener Theorie zufolge vielleicht gar nicht notwendig ist. Wie ich in Kapitel 4 zeigen werde, könnten Vorstöße, deliberativen Mini-Öffentlichkeiten Entscheidungsgewalt zu übertragen, einen politischen Prozess in Gang setzen, der sich zwar durch Nicht-Beherrschung auszeichnen, einer Entfremdung aber dennoch nicht vorbeugen würde und deshalb auch nicht imstande wäre, eine demokratische Kontrolle in Pettits spezifischem Sinne zu sichern.[24] Unabhängig davon, ob ich die gleiche Entscheidungsmacht besitze oder nicht, kann ich mich Gesetzen und Regelungen entfremden, an die ich mich zwar halten muss, mit denen ich mich aber nicht identifiziere und die ich auch nach reiflicher Überlegung nicht gutheiße. Sich politischen Entscheidungen, die man nicht wohlüberlegt befürworten kann, blind fügen zu müssen 42widerspricht grundsätzlich dem Ideal der Selbstregierung. Teil eines kollektiven politischen Projekts zu sein, das nicht auf meine Interessen und Vorstellungen – wie ich denke und woran ich Anteil nehme – eingeht, wird wohl tatsächlich zu Entfremdung führen.
In The Constitution of Equality legt Thomas Christiano detailliert dar, warum es wichtig ist, der politischen Entfremdung vorzubeugen: um nämlich ein Grundbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger zu schützen, das Bedürfnis, »in der Gesellschaft zuhause zu sein«. Dieses charakterisiert er folgendermaßen:
Das Bedürfnis, in der Welt zuhause zu sein, ist von grundlegender Bedeutung, denn es ist für das Wohlergehen eines jeden Menschen zentral. […] In der Welt zuhause zu sein […] ist der Zustand, der einem das Gefühl vermittelt, in die Welt, in der man lebt, zu passen, mit ihr verbunden zu sein und das Leben in ihr sinnvoll zu finden. Es ist folglich ein Zustand, in dem man den Wert der Dinge, die einen umgeben, erfahren kann. […] In dem Maße, wie es Interessen gibt, die mit diesem Gefühl des Zuhauseseins zusammenhängen, und wie ihre Gerechtigkeitsurteile dieses Gefühl widerspiegeln, haben die Individuen ein Interesse daran, dass die Welt, mit ihren Urteilen in Einklang steht. […] In einer Welt zu leben, die dem eigenen Urteil, wie diese Welt gestaltet sein sollte, in keiner Weise entspricht, bedeutet, in einer Welt zu leben, die hinsichtlich der eigenen Interessen undurchsichtig und diesen Interessen vielleicht sogar feindlich gesinnt ist. Es bedeutet, in einer Welt zu leben, in der nicht absehbar ist, wie man sie auf legitime Weise für die eigenen Interessen ansprechbar macht. Es ist so, als würde man ein Spiel spielen, dessen Regeln für einen selbst keinen Sinn ergeben. Man bleibt außen vor.[25]
In dieser dichten Beschreibung der Idee, »in der Gesellschaft zuhause zu sein«, zeichnen sich verschiedene Hinsichten ab, in denen Bürgerinnen ein Interesse daran haben, eine Entfremdung von ihrer sozialen Welt zu vermeiden. Da ich hier keine umfassende Theorie der politischen Entfremdung anstrebe, werde ich auf Christianos 43konkrete Darstellung dieses Phänomens und seiner Bedeutung im Zusammenhang mit anderen grundlegenden Interessen (wie Gleichheit, Öffentlichkeit, moralischem Ansehen und so weiter) nicht in allen Einzelheiten eingehen. Zwei Dimensionen der Entfremdung, die Christiano im zitierten Abschnitt erwähnt, sind für meine Zwecke aufschlussreich. Christiano sieht zwei wesentliche Quellen für das grundlegende Interesse der Bürgerinnen, in einer sozialen Welt zu leben, die ihren Urteilen entspricht: nämlich ihren Gerechtigkeitssinn und ihre Fähigkeit, den Wert der Dinge wahrzunehmen, die sie umgeben. Um es in Rawls'schen Termini auszudrücken, könnte man sagen, das grundlegende Interesse der Bürger am Vermeiden politischer Entfremdung wurzele eben in ihren beiden moralischen Vermögen: der Fähigkeit, einen Gerechtigkeitssinn, und der Fähigkeit, eine Konzeption des Guten zu entwickeln.[26] Nennen wir Letzteres den identitätsbezogenen und Ersteres den Gerechtigkeitsaspekt politischer Entfremdung.
Was den identitätsbezogenen Aspekt anbelangt, so hängt die Bedeutung, als Bürgerin in einer Welt leben zu können, die den eigenen Urteilen entspricht, nicht zuletzt mit der Möglichkeit zusammen, sich mit der Welt im Einklang und in ihr aufgehoben zu fühlen, weil man die eigenen Werte in der Gesellschaft bestätigt, die eigenen Ideen anerkannt und in der gemeinsamen Kultur reflektiert sieht und so weiter. Für die Identität und das Selbstwertgefühl der Bürgerinnen ist es wichtig, ihre soziale Welt so gestalten zu können, dass sie in der Lage sind, ihr eigenes Handeln sinnvoll und ihre eigenen Lebensformen wertvoll zu finden.[27] Doch die Möglichkeiten, die so44ziale Welt so zu gestalten, dass sie buchstäblich mit jedermanns Werten und Konzeptionen des Guten übereinstimmt, sind begrenzt. Schließlich kann keine Gesellschaft alle Werte und Lebensweisen zugleich bejahen. Rawls kleidet diesen (Berlin'schen) Gedanken in die Formulierung, dass es keine soziale Welt ohne Verluste gibt.[28] Sicherlich kann es in diesem spezifischen Sinne keine Demokratie ohne Verluste geben, da zur Einhaltung der demokratischen Verpflichtungen auf politische Gleichheit, Inklusion, Gleichberechtigung und so weiter nicht alle Werte, an denen Bürgern etwas liegt, und nicht einmal alle wertvollen Aspekte ihrer unterschiedlichen Lebensformen in den Gesetzen und Regelungen, denen sie unterworfen sind, zum Ausdruck kommen können.[29] Außerdem mag ihre soziale, kulturelle oder religiöse Identität für viele Bürger eine wichtigere Sinn- und Wertquelle sein als ihre politische Identität. Manche Bürger haben vielleicht gar kein Interesse daran, eine politische Identität auszubilden.
Anders ist die Situation allerdings, wenn die Gesetze und Regelungen, denen die Bürgerinnen unterliegen, nicht mit ihrem Gerechtigkeitsempfinden übereinstimmen. Wenn sie die Gesetze und Regelungen, zu deren Einhaltung sie verpflichtet sind, nicht als gerecht oder zumindest als begründet akzeptieren können, sehen sie sich gegebenenfalls gezwungen, Ungerechtigkeiten hinzunehmen oder sogar gegen ihr Gewissen zu handeln. Ganz unabhängig davon, welche relative Bedeutung Politik für die Identität der Bürgerinnen haben kann, liegt es doch in ihrem vitalsten Interesse, diese Art von Entfremdung zu vermeiden. Bürgerinnen und Bürger können keinen Gerechtigkeitssinn entwickeln und bewahren, wenn sie 45gezwungen sind, Gesetzen und Regelungen blind zu gehorchen, die ihre eigenen Grundrechte und Grundfreiheiten oder die anderer verletzen. Der Abgleich ihrer Interessen, Gründe und Vorstellungen mit den Gesetzen und Regelungen, denen sie unterworfen sind, ist für Bürger auch deshalb notwendig, damit sie nicht gezwungen sind, sich selbst oder anderen Unrecht zu tun. Sie haben ein grundlegendes Interesse, sich den politischen Entscheidungen anderer, die sie nicht mit guten Gründen als vernünftig begreifen können, aber trotzdem befolgen müssen, nicht blind fügen zu müssen, ob sie der Politik nun einen Wert beimessen oder politisch eher desinteressiert sind.[30] Zweifellos wird ihr Interesse am Vermeiden politischer Entfremdung immer dann am größten sein, wenn die Gesetze und Regelungen, denen sie gehorchen sollen, grundlegende Gerechtigkeitsfragen oder die wesentlichen Verfassungsinhalte berühren – um mit Rawls zu sprechen.
Jede plausible Interpretation des demokratischen Ideals der Selbstregierung muss genau dieser substantiellen Sorge der Bürger um den Inhalt der Gesetze und Regelungen, denen sie Folge zu leisten gezwungen sind, Rechnung tragen können.[31] Doch, wie gesagt, eine theoretische Explikation dieses Ideals, die sich ausschließlich an der Idee der politischen Gleichheit orientiert, kann nicht erfas46sen, welchen Beitrag die demokratische Partizipation leistet, um zu garantieren, dass sich Bürger und Bürgerinnen politische Entscheidungen zu eigen machen können. Denn es geht ihnen ja nicht nur um ihren Status als politisch Gleiche, sondern auch um die inhaltliche Angemessenheit der Gesetze und Regelungen, an die sie sich halten müssen. Kein noch so umfassender politischer Machtausgleich kann das grundlegende Interesse der Bürgerinnen am Erhalt ihres Gerechtigkeitssinns kompensieren oder ersetzen – ihr Interesse, nicht gezwungen zu sein, sich selbst oder anderen Unrecht zu tun, weil sie Gesetzen, die nach ihrem Urteil die eigenen Grundrechte und -freiheiten oder die anderer verletzen, blind gehorchen müssen. Im Zusammenhang mit den politischen Kämpfen der Vergangenheit um das Wahlrecht weist Jeremy Waldron auf diesen wichtigen Aspekt der demokratischen Beteiligung hin:
Bei der Partizipation […] geht es ebenso sehr ums Prinzipielle wie um Tagespolitik. Diejenigen, die für das Wahlrecht (der Arbeiter, Besitzlosen, Frauen, ehemaligen Sklaven oder aus anderen rassifizierten Gründen Entrechteten) kämpften, hatten nicht nur das Recht auf eine Beteiligung an tagespolitischen Fragen im Sinn, sondern auch das auf eine Beteiligung an den großen Grundsatzfragen, mit denen ihre Gesellschaft konfrontiert war […]. So verstanden lief der Ruf nach gleichem Wahlrecht auf die Forderung hinaus, dass Rechte betreffende Fragen von der gesamten Gemeinschaft der Rechtsträger einer Gesellschaft entschieden werden sollten, das heißt von allen, um deren Rechte es ging.[32]
Wenn wir auf das substantielle Interesse der Bürgerinnen und Bürger blicken, nicht Gesetze und Maßnahmen befolgen zu müssen, die ihre eigenen Grundrechte oder die Grundrechte anderer verletzen, wird klar, warum das demokratische Ideal der Selbstregierung nicht nur ein Ideal politischer Gleichheit, sondern auch eines der Beteiligung am politischen Entscheidungsprozess ist. Nur ein demokratisches politisches System, in dem Bürgerinnen an der Gestaltung der Gesetze und Regelungen, denen sie unterliegen, mit47wirken können, kann nämlich gewährleisten, dass diese Gesetze und Regelungen mit ihren Gerechtigkeitsurteilen übereinstimmen. Nur so können Bürgerinnen und Bürger ihren Gerechtigkeitssinn entwickeln und bewahren, ohne gezwungen zu sein, Gesetzen und Regelungen, die ihnen selbst oder anderen Unrecht tun, blind zu gehorchen.[33] Die demokratische Beteiligung am Entscheidungsprozess ist wesentlich, um eine entfremdende Abkopplung der politischen Ansichten und des politischen Willens der Bürger von den politischen Entscheidungen, denen sie unterworfen sind, zu verhindern. Ein politisches System, das von Bürgern verlangt, sich den politischen Entscheidungen anderer blind zu fügen, ist mit dem demokratischen Ideal der Selbstregierung im Kern unvereinbar.
Wenn diese kurze Analyse des demokratischen Ideals der Selbstregierung einleuchtet, dann können wir nun auch genauer bestimmen, in welchem Sinne eine Bürgerbeteiligung an politischen Entscheidungsprozessen für die Demokratie wesentlich ist, ohne dass diese Beteiligung eine repräsentative Regierungsform ausschließt. Die Demokratie muss nicht in dem Sinne partizipatorisch sein, dass die Bürgerinnen an allen politischen Entscheidungen beteiligt sind. Sie muss es hingegen insofern sein, als sie über Institutionen verfügt, die einen permanenten Abgleich zwischen den Regelungen, denen die Bürger unterworfen sind, und dem Prozess der politischen Meinungs- und Willensbildung, an dem sie (aktiv und/oder passiv) teilnehmen, ermöglichen. Bürger können einen großen Teil der politischen Entscheidungsfindung an ihre Vertreterinnen delegieren, solange sie nicht gezwungen sind, dies blindlings zu tun. Solange 48es effektive und dauerhafte Möglichkeiten für sie gibt, sowohl den politischen Prozess mitzugestalten als auch erhebliche Abweichungen zwischen den Regelungen, denen sie Folge zu leisten haben, und ihren Interessen, Vorstellungen und politischen Zielen zu verhindern und anzufechten, können sie sich unvermindert als Teilnehmer an einem demokratischen Projekt der Selbstregierung begreifen. So verstanden bleibt das demokratische Ideal für repräsentative Demokratien gleichermaßen praktikabel und handlungsleitend.
Mit dem Wort »praktikabel« möchte ich allerdings nicht suggerieren, dass wir zu einer vollständigen Übereinstimmung zwischen der realen Politik und den Prozessen der politischen Meinungs- und Willensbildung, an denen sich Bürgerinnen beteiligen, kommen könnten. Ich meine nur, dass das Ideal, einem solchen Zustand näherzukommen, nicht mit der unrealistischen Vorstellung verwechselt werden darf, dass sich die Bürgerinnen möglichst an allen politischen Entscheidungen beteiligen. Während Letzteres die Abschaffung jeder Form von repräsentativem Regieren erfordern würde, ist Ersteres mit politischer Repräsentation absolut vereinbar. Insofern uns das Ideal dazu anhält, die gegenwärtigen demokratischen Institutionen und institutionellen Reformvorschläge danach zu beurteilen, ob sie die demokratische Kontrolle der Bürgerinnen (das heißt den permanenten Abgleich zwischen den politischen Meinungs- und Willensbildungsprozessen, an denen sie beteiligt sind, und den politischen Regelungen, die für sie verbindlich sind) stärken oder schwächen würden, ist es außerdem handlungsleitend. Diese Beurteilung ist nicht im Mindesten von der Annahme abhängig, dass eine vollkommene Angleichung erreichbar wäre. Wenn man das Ideal so versteht, dass es demokratischer Institutionen und Praktiken bedarf, die den Bürgern möglichst viele wirksame Gelegenheiten einräumen, um eine dauerhafte Abkopplung der ihnen auferlegten Regelungen von ihren wohlüberlegten Meinungen und ihrem reflektierten Willen zu vermeiden, dann kann es folglich sowohl praktikabel als auch handlungsleitend sein. Man muss wohl nicht eigens darauf hinweisen: Je mehr auf dem Spiel steht, desto wichti49ger ist, dass alle Bürgerinnen solche Gelegenheiten bekommen. Auf diese nicht gänzlich utopische Weise verstanden stellt die potentielle Abkopplung oder dauerhafte Nicht-Übereinstimmung zwischen Interessen, Werten und wohlüberlegten Meinungen der Bürger einerseits und den politischen Entscheidungen, denen sie unterworfen sind, andererseits den wichtigsten Lackmustest für demokratische Defizite dar. Der angemessene Maßstab zur Bewertung der demokratischen Qualität politischer Institutionen ist also, ob sie darauf angelegt sind, eine solche Entkopplung zu verhindern beziehungsweise zu minimieren, oder ob sie umgekehrt von den Bürgern verlangen, sich den Entscheidungen anderer blind zu fügen, und einer Entkopplung damit weiter Vorschub leisten. Anhand dieses Maßstabs werde ich in den folgenden Kapiteln prüfen, wie attraktiv verschiedene normative Demokratietheorien und ihre institutionellen Reformvorschläge sind.[34] Bevor ich aber in diese Diskussion einsteige, möchte ich kurz erläutern, wie ich die Begriffe der »Beteiligung« respektive »Partizipation« und der »partizipatorischen« Demokratie im Folgenden gebrauchen werde.
1.2 Demokratie aus partizipatorischer Perspektive
Im Anschluss an die bisherige Analyse betrachte ich eine Demokratiekonzeption als »partizipatorisch«, wenn sie dem demokratischen Ideal der Selbstregierung, das heißt der Idee, dass die (aktive und/50oder passive) politische Meinungs- und Willensbildung der Bürgerinnen die Gesetze und Regelungen, denen sie unterworfen sind, wirksam beeinflussen und mitgestalten sollte, Vorrang einräumt. Meine partizipatorische Interpretation der deliberativen Demokratie folgt Habermas' Verständnis von demokratischer Kontrolle, die eine permanente Rückkopplung zwischen den Prozessen der politischen Meinungs- und Willensbildung in der Öffentlichkeit und den vom politischen System getroffenen Entscheidungen vorschreibt. Dieses dynamische Modell ermöglicht es, demokratische Kontrolle im Sinne der Ansprechbarkeit für die öffentliche Meinung zu verstehen, und zwar nicht für die faktische, zu einem bestimmten Zeitpunkt zufällig herrschende öffentliche Meinung, sondern für die wohlüberlegte öffentliche Meinung, die sich im Laufe der Zeit herausbildet und weiterentwickelt.[35]





























