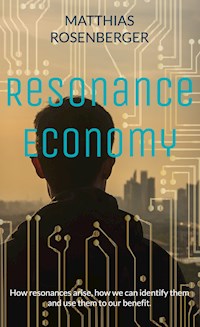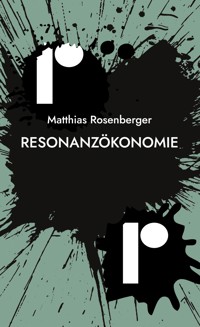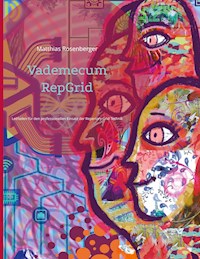
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Vademecum RepGrid
- Sprache: Deutsch
Die Nutzung kollektiver Intelligenz wird vor dem Hintergrund stetig ansteigender Komplexität und Dynamik immer wichtiger. Ein Einzelner ist heute kaum mehr in der Lage, alle relevanten Informationen zur Entscheidung eines Sachverhalts einzubeziehen. Methoden, die in der Lage sind, sowohl tiefliegende Überzeugungen sichtbar zu machen, als auch kollektive Trends aufzuzeigen, sind zunehmend gefragt. Die Repertory Grid Technik (repgrid) ist ein solch tiefschürfendes Instrument. Bis vor ein paar Jahren gab es nur sehr wenige Möglichkeiten, individuelle Repertory Grid Ergebnisse zu einem Gesamtbild zusammenzuführen und Kollektivmuster auszuwerten. Mit modernen IT-Lösungen zur Interviewführung und Analyse, ist es jetzt möglich. Softwaregestützt lassen sich nahezu vorgabefrei, zuverlässig und schnell Überzeugungen und Werthaltungen Einzelner aggregieren und analysieren; oft mit attraktiver, intuitiv verständlicher dreidimensionaler Grafik, mit unvergleichbar hoher inhaltlicher Aussagekraft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für George
Inhaltsverzeichnis
1.
Vom Subjekt zum Konstrukt
1.1 Die Welt erklären: der nomothetische Ansatz
1.2 Die Welt verstehen: der idiografische Ansatz
1.3 Methodendilemma der Psychologen
1.4 Die Qual der Wahl
1.5 Methodenbrücke Repertory Grid
2.
Kellys Theorie der persönlichen Konstrukte
2.1 Der Schöpfer George A. Kelly
2.2 Fundamente der Theorie
2.2.1 Konstruktiver Alternativismus
2.2.2 Der Mensch als Forscher
2.2.3 Gut gerüstet: Grundpostulat und Hilfssätze
2.2.4 Im Zentrum steht das persönliche Konstrukt
2.2.5 Die Struktur der Konstrukte: das Konstruktsystem
2.2.6 Dreh- und Angelpunkt der Konstrukte: das Element
2.2.7 Originalität: Kellys Elemente-Sets
2.2.8 Kellys Elementekategorien und Triadenauswahl
2.3 Grenzen der Theorie
2.4 (Ein-)Ordnung muss sein
3.
Die Repertory-Grid-Technik
3.1 Repertory-Grid-Projekte mit repgrid
3.1.1 Motiv & Planung
3.1.1.1 Vom Alltagsproblem zu den Elementen
3.1.1.2 Elementeauswahl/Elementeentwicklung
3.1.1.3 Ideen für Elementekombinationen
3.1.1.4 Die Qual der Wahl: Konstrukte vorgeben?
3.1.2 Rekrutierung und Terminierung
3.2 Es wirklich wissen wollen: Erhebungsformen
3.2.1 Triaden, Dyaden
3.2.2 Opposition oder Differenzierung
3.2.3 Günstige Frageformen
3.2.4 Die Güte der Konstrukte
3.2.5 Bewertungsmaßstab: Rating und Skalierung
3.2.6 Interview-Etikette
3.2.7 Rahmenbedingungen im Interview
3.3 Des Pudels Kern: Auswertungsalgorithmen
3.3.1 Hierarchische Clusteranalyse (Bertin)
3.3.2 Hauptkomponentenanalyse (ESA und Multi-ESA)
3.3.3 repgrid-Werkzeuge
3.3.4 Mehr oder weniger nützliche Statistikmaße
3.4 Statistische Güte
4.
Praktische Beispiele
4.1 Kulturanalyse + Systemdiagnose
4.2 Strategisches Management
4.3 Quality Benchmarking
4.4 Marken- und Produktführung
4.5 Top Team Development
4.6 Coaching
4.7 Leistungssport
4.8 Projektevaluation
5.
Benchmark der Repertory-Grid-IT-Lösungen
6.
Literatur
1 Vom Subjekt zum Konstrukt
Je dynamischer und komplexer die Umwelt erscheint, desto mehr sind Menschen darauf fixiert, Ordnung aktiv zu gestalten (vgl. Luhmann 1989, S. 5). Je komplexer und dynamischer beispielsweise Unternehmensstrukturen gestaltet sind, desto deutlicher und bedeutsamer treten diejenigen subjektiven Charakteristika in den Vordergrund, die sich nicht auf der Basis rational logischer Kompetenz befinden, sondern die auf psychologisch bzw. soziologisch relevanten Fähigkeiten und Wirkfaktoren (Soft Facts) aufsetzen. Das Gleiche gilt für politische Meinungstrends, Stimmungen in Organisationen oder die Wahrnehmung von Marken, Produkten und Dienstleistungen. Insbesondere scheinen aus psychologischer Sicht Intuition und die Fähigkeit, suggestiv zu agieren bzw. mit Suggestionen umzugehen, sinnvolle Persönlichkeitseigenschaften in dynamisch komplexen Umwelten zu sein.
Die professionelle Betrachtung des Individuums im Kontext institutionalisierter Umweltbedingungen wird traditionell dem Bereich der industriellen Sozialpsychologie bzw. Soziologie zugeordnet (March/Simon 1976, S. 7ff.), jedoch spielen auch Persönlichkeitsmerkmale des Menschen in diesem Feld eine bedeutsame Rolle. Denn nur über die vom Individuum gebildeten subjektiven Repräsentationen einer institutionellen Begebenheit können wertvolle und valide Hinweise über die Institution selbst gewonnen werden. Organisation und Individuum bedingen einander. Ob, wie March und Simon (1976, S. 129ff.) darlegen, über die Identifikation des Individuums mit der Organisation, was der direkten Betrachtung des Individuums als eigene Persönlichkeit am ehesten entspricht, oder indirekt, wie bei Giddens (1997), über das rekursive Zusammenspiel von Handlung und Struktur in Organisation und Gesellschaft. Eine Handlung ist zielgerichtet und entspringt damit einem Wunsch oder Bedürfnis, was sie vom einfachen Verhalten unterscheidet. Das handelnde Individuum zum Beobachtungsgegenstand zu machen, begründet damit ebenfalls die Betrachtung der Persönlichkeit in institutionalisierten Kontexten.
Beschäftigt man sich mit der Frage, wie Ansichten von Menschen im Kontext ihrer Umwelt ermittelt werden, befindet man sich im Bereich der Persönlichkeits- oder auch Differenziellen Psychologie (Amelang/Bartussek 2001, S. 29ff.). Für uns, die vom Grunde her neugierig sind und stets VOR einer Interventionsphase eine Analysephase ansetzen, bedeutet es, gezielt nach einer geeigneten Methode zu suchen, die sowohl individuelle Persönlichkeitseigenschaften eruieren als auch interindividuell vergleichbare Ergebnisse liefern kann. Schließlich suchen wir nach Erkenntnissen, die allen Beteiligten helfen, sich gegenseitig besser zu verstehen(s. a. Resonance Economy, Rosenberrger 2021). Doch welche Ansätze gibt es, um Erkenntnisse zu gewinnen, die entweder im Einzelnen oder im Kollektiv verankert sind und nur zutage gefördert werden müssen? Eigentlich nur zwei (vgl. Angleitner 1980, S. 11ff.).
1.1 Die Welt erklären: der nomothetische Ansatz
Auf der einen Seite steht der „nomothetische“ Ansatz, der auch synonym als „erklärend“ bezeichnet wird und aus dem naturwissenschaftlichen Forschungsparadigma stammt. Nach dieser Auffassung können allgemeine Gesetzmäßigkeiten formuliert werden, die zur Voraussage spezifischer Ereignisse dienen. Ein Beispiel im psychologischen Bereich ist die Vorgehensweise bei der klassischen Konditionierung nach Pawlow. Ein zuvor neutraler Reiz, der mit einem natürlichen, angeborenen Auslösereiz gekoppelt wird, ist in der Lage, selbst eine dem natürlichen Reiz zugehörige Reaktion auszulösen. Das klassische Instrumentarium der Allgemeinen Psychologie ist nach diesem Ansatz die Varianzanalyse. „Es gilt Haupteffekte für ein gesetztes Treatment zu finden“ (Angleitner 1980, S. 9). Eine Stichprobe liefert die allgemeingültigen Ergebnisse, welche dann auf eine vordefinierte Gesamtpopulation Anwendung finden (vgl. Lewin 1986, S. 11ff.).
1.2 Die Welt verstehen: der idiografische Ansatz
Auf der anderen Seite steht der „idiografische“, verstehende Ansatz. Hier liegt die Annahme zu Grunde, individuelle Merkmale der Persönlichkeit eines Menschen könnten nicht erklärt werden, sie könnten nur nachvollzogen werden, indem „der Interpret sich in die Situation der zu verstehenden Person hineinversetzt und sich vergegenwärtigt, wie er selber gehandelt hätte“ (Kelle 1994, S. 58ff.). Diese Auffassung ist vornehmlich in der Sozialforschung vertreten und aus der Perspektive des „Interpretativen Paradigmas“ genährt. Demnach können wir Hypothesen weder formulieren noch operationalisieren, ohne auf unseren Wissenshintergrund wenigstens implizit Bezug zu nehmen. Wir sind nur in der Lage, unser Gegenüber zu verstehen, wenn wir gemeinsame Erlebniswelten haben und über dieselben Symbole verfügen, die einen Austausch über persönliche Sichtweisen zu bestimmten Phänomenen zulassen (vgl. Abbildung 1). Dieser Wissenshintergrund konstituiert sich durch aktive Handlungen der Gesellschaft in der sozialen Realität (Kelle 1994, S. 44ff.).
Abbildung 1: Unterscheidende Charakteristika induktiver und deduktiver Ansätze in der Erkenntnisgewinnung über ein Forschungsfeld (in Anl. a. Lewin 1986, S. 37).
Die Debatte um die kontroversen Grundpositionen „Erklären“ vs. „Verstehen“, also die Geisteswissenschaft als kausal erklärende Wissenschaftsdisziplin zu konzipieren, oder die Notwendigkeit des „inneren Nachvollzugs“ möchte ich hier nicht weiter verfolgen. Eine sehr umfangreiche Darstellung dieser Problematik diskutiert Kelle (1994, S. 57ff.).
Folgenschwer ist allerdings die Konsequenz, die sich aus dem genannten Dilemma nomothetischer vs. idiografischer Perspektiven auf den Gegenstand unserer Analysen ergibt: zwei methodisch völlig gegensätzliche Herangehensweisen an eine Problematik.
1.3 Methodendilemma der Psychologen
Psychologen machen sich das Leben schwer, indem sie die Lagerbildung zwischen quantitativer (also zählorientierter) und qualitativer (verstehensorientierter) Methodik schüren.
In den quantitativen Methoden (z. B. standardisierte Fragebogen, Test oder Laborexperiment) werden im Allgemeinen theoretische Vorannahmen zugrunde gelegt, sie sind daher theoriegeleitet (vgl. Lewin 1986, S. 221ff.). Diese Vorgehensweise entspricht der o. g. deduktiven Perspektive (s. Abbildung 1), auch hypothetico-deduktive Methode genannt. Im Vordergrund dieses Vorgehens steht die Anwendung der Logik der Ableitung von Hypothesen aus Annahmen, die a priori, also vor der Datenerhebung, bestehen.
Diejenigen, die dem induktiven Ansatz folgen, bewegen sich demgegenüber gewissermaßen in einem Meer aus Informationen und lassen die wesentlichen Variablen und Hypothesen aus dem Bereich ihres Interesses auf sich zutreiben (s. Abbildung 1, vgl. a. Lewin 1986, S. 36f.). Zu Beginn einer Analyse besteht relative Offenheit gegenüber dem Problemfeld bzw. -gegenstand einer Fragestellung. Vorannahmen werden möglichst vermieden. Erst im Verlauf der Analyse werden Hypothesen gebildet, indem sukzessiv und kumulativ Daten zu einem Bild zusammengeführt werden (Lewin 1986, S. 37). Eine induktive Methode erfordert die systematische Beobachtung und Beschreibung des Problemfeldes.
1.4 Die Qual der Wahl
Je nach Art einer Fragestellung sollte man gut überlegen, welcher methodische Weg nach o. g. Grundhaltung sinnvoller ist. Bei der deduktiven Vorgehensweise werden im Allgemeinen quantitative Methoden den qualitativen vorgezogen. Zu den quantitativen (zählorientierten) Methoden gehören u. a. der Fragebogen, der Test und Laborexperimente. Bei induktiven Ansätzen wählt man wohl eher die weichen oder auch qualitativen Methoden, wie beispielsweise das sog. narrative Interview oder das Experteninterview.
Im 19. Jahrhundert begann die sozialwissenschaftliche Forschung sich den Prämissen der naturwissenschaftlichen Forschung anzunähern. Insbesondere wurde der Versuch unternommen, die Kriterien dieser Richtung zu übernehmen, wobei die Rigidität der Methoden, die strengen Prüfungsmechanismen und schließlich die mathematischen Regeln oft zum Selbstzweck wurden. Mit anderen Worten: Selbst im Bereich des Sozialen wird quantifiziert, Qualitatives umgemünzt in Zählbares, obwohl gerade die Naturwissenschaften sich eines Quantifizierungs- und Methodenfetischismus entledigt haben und das Diktum „Wissenschaft heißt messen“ längst seine Ausschließlichkeit verloren hat (Atteslander 1984, S. 50, vgl. a. Mayring 1999, S. 1). Quantitative Methoden sind prinzipiell geleitet durch explizierte theoretische Überlegungen, sind dadurch eher „objektiv“ und vergleichbar. Sie können schnelle Rückläufe realisieren, jedoch leidet diese Vorgehensweise an inhaltlicher Bedeutung.
Qualitative Methoden (z. B. Interview oder Beobachtung) überzeugen durch ihre inhaltliche Relevanz und Aussagekraft, da sie sich an den Erfahrungen und Äußerungen des Individuums orientieren, jedoch führt die zeitintensive Erhebung und interpretative Auswertung zu subjektiven und oft veralteten Informationen (vgl. Westermann 2000, S. 25ff.). Hinsichtlich der Diagnose stehen sich quantitative und qualitative Methoden gegenüber (s. Abbildung 2).
Abbildung 2: Gegenüberstellung der Vorteile von qualitativer und quantitativer Methodik.
Moderne Softwarelösungen für Repertory-Grid-Anwendungen, wie repgrid, verbinden die Vorteile beider methodischen Ansätze und bilden quasi ein Methodenoxymoron. Sie erheben inhaltliche Relevanzen (Konstrukte) und liefern gleichzeitig faktisch klare Ergebnisse (numerische Auswertungsoptionen).
1.5 Methodenbrücke Repertory Grid
Unsere Welt um uns herum ist unüberschaubar komplex und dynamisch. Jeder von uns konstruiert sich seine eigene Wirklichkeit im Dschungel der uns umgebenden Informationen, denn Realität ist, wie ja oben bereits angesprochen, Ansichtssache. Wir sind ein Teil des großen Ganzen und bewegen uns gemeinsam mit anderen in Wechselbädern systemisch verbundener Elemente, die jeder von uns individuell deutet und bewertet. Kollektive Entscheidungsmuster entstehen durch ein komplexes Zusammenspiel von Umgebungsvariablen, internen Entscheidungsheuristiken und Zufällen. Verfahren, die uns helfen, Komplexität mit Komplexität zu begegnen, systemische Verbundenheiten und Bewertungen aufdecken, sind klar im Vorteil.
Die Repertory-Grid-Technik ist solch ein Verfahren. Mit ihr kann ein temporäres Abbild interindividueller Entscheidungsströme visualisiert werden. Bis vor ein paar Jahren gab es jedoch nur sehr wenige Möglichkeiten, individuelle Repertory-Grid-Ergebnisse zu aggregieren. Mit repgrid, dem computergestützten Repertory-Grid-Interview- und - Analyseverfahren, haben wir eine Methodenbrücke geschaffen. Die repgrid App beinhaltet neben einem interaktiven Befragungsmodul, angelehnt an die Erfordernisse eines modernen Repertory-Grid-Interviews, ein elegantes, attraktives und statistisch robustes Auswertungsmodul zur schnellen und zuverlässigen Analyse von Einzel- und Gruppenmeinungen. Softwaregestützt lassen sich nahezu vorgabefrei, zuverlässig, schnell und individuell Überzeugungen und Wertehaltungen analysieren. Das Ergebnis einer Repertory Grid-Untersuchung ist eine attraktive, intuitiv verständliche, dreidimensionale Grafik mit einer unvergleichbar hohen inhaltlichen Aussagekraft.
So viel zu einer knackigen Werbebotschaft, die auch aus unserem Produktflyer stammen könnte. Ich bin jedoch kein großer Freund der plakativen und unreflektierten Nutzung eines Verfahrens oder einer Methode zur psychologischen Diagnostik, besonders, wenn wichtige und zukunftsträchtige Entscheidungen auf der Basis der Ergebnisse getroffen werden sollen. Daher lade ich Sie als Leser ein, etwas mehr über den Hintergrund der Methodik „Repertory Grid“ und die dahinterliegenden theoretischen Annahmen der Personal Construct Theory zu erfahren sowie einen kleinen Einblick zu erhalten in die Biografie des Erfinders: George A. Kelly.
2 Kellys Theorie der persönlichen Konstrukte
Im Jahre 1955 veröffentlichte George A. Kelly sein Buch „The Psychology of Personal Constructs“. In diesem zweibändigen Werk grenzte er sich von den damals vorherrschenden Denkrichtungen des Behaviorismus auf der einen und der tiefenpsychologischen Betrachtungsweise auf der anderen Seite ab. Kelly war der Überzeugung, dass durch die Trennung von Denken, Fühlen und Handeln der Vielseitigkeit des Betrachtungsgegenstandes (Mensch) nicht genügend Rechnung getragen wird. Er übernahm aber durchaus Teile und Ideen dieser Theorien und entwickelte eine Zwischenposition – man könnte auch sagen ein theoretisch-methodisches Oxymoron.
Kelly sieht in seiner „Theorie der persönlichen Konstrukte“ den Menschen als „Forscher“, der bemüht ist, seine Konstruktionen über die Welt permanent zu überprüfen und zu verbessern, um möglichst genaue Vorhersagen über kommende Ereignisse treffen zu können. Er stützt sich dabei auf die philosophischen Grundannahmen des „konstruktiven Alternativismus“ (vgl. Westmeyer 2002, S. 3f.). Demnach können Menschen nicht unmittelbar mit der sie umgebenden „objektiven“ Wirklichkeit in Kontakt treten, sondern sie (re-)konstruieren ihre Wirklichkeit. Nach Westmeyer (2002, S. 326) ist Kellys Theorie daher auch einer der ersten subjektwissenschaftlichen Ansätze in der Psychologie. Kellys Grundpostulat lautet: „A person’s processes are psychologically channelized by the ways in which he anticipates events“ (Kelly 1991, S. 32, vgl. a. Westmeyer 2002, S. 327, Bannister/Fransella 1981, S. 7ff.). Mit anderen Worten: Der Mensch antizipiert Ereignisse in Form individueller Verknüpfungen seiner Erfahrungen, denn nur diese stehen ihm zur Verfügung. Das Ergebnis seiner Handlung kann er auch nur mit den ihm zur Verfügung stehenden Konstruktionen aufnehmen und zur Anpassung an die Erfordernisse der Umwelt heranziehen.
Die zentralen Begriffe in Kellys Theorie sind das „persönliche Konstrukt“ und das „Element“. Elemente stellen konkrete, für den Befragten bedeutsame Dinge, Situationen/Ereignisse oder Personen dar. Konstrukte sind Bewertungen und beziehen sich auf Eigenschaften der Elemente. Gemeinsam bilden sie die Grundlage für das Individuum, die Welt zu strukturieren. Elemente fungieren als Bedeutungsträger, Konstrukte führen zu Verhaltenskonsequenzen und können als Handlung umgesetzt oder auch formuliert werden. Kelly fasst Konstrukte als dichotome Dimensionen (z. B. gut vs. böse) auf, die dazu dienen, die vorhandenen Elemente in Gruppen hinsichtlich ihrer Ähnlichkeit zu sortieren und zu bewerten. Dieser Vorgang wird von Kelly als „Konstruktionsprozess“ beschrieben. Ergebnis dieses Konstruktionsprozesses ist eine Abstraktion, die unabhängig von den Elementen existiert und von Kelly als „Konstruktsystem“ bezeichnet wird (Kelly 1991, S. 74ff.).
Diese Abstraktion bestimmt die Wahrnehmung und Bewertung anderer, ähnlicher Erscheinungen bei zukünftigen Ereignissen. Kelly betont, dass es vom psychologischen Standpunkt aus keine anderen als dichotome Denksysteme gibt. Eine Ähnlichkeit festzustellen bedeutet, bewusst oder unbewusst, immer auch die Heranziehung eines differenzierenden Kriteriums (Gegensatz). Sollten nur Ähnlichkeiten wahrgenommen werden, so würde die Realität zu einer ununterbrochenen Kette von monotonen Erscheinungen; sollten nur Unterschiede wahrgenommen werden, so würde die Realität zu einem Chaos von unwiederholbaren Erscheinungen. Die Konstrukte stellen gleichzeitig Ähnlichkeiten und Unterschiede fest, ordnen die Ereignisse bestimmten Kategorien zu und werden so zu einer realitätsstiftenden Einheit für das Individuum (Kelly 1991, S. 75, s. a. Catina/Schmitt 1993, S. 15ff.).
2.1 Der Schöpfer George A. Kelly
Der „Erfinder“ der Repertory-Grid-Methode war George Alexander Kelly (* 28. April 1905 in Perth, Kansas, USA; † 6. März 1967). Er war Professor für Klinische Psychologie und ist der Begründer der Psychologie der persönlichen Konstrukte.
G. A. Kelly kam aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater war ein strenggläubiger Geistlicher. Zunächst ging Kelly in eine einklassige Landschule und besuchte dann die höhere Schule. Nach seinem Abschluss studierte er Mathematik und Physik, wechselte 1931 zur Erziehungswissenschaft und dann zur Psychologie. Während des Krieges arbeitete er als Psychologe bei den Marinefliegern. Von 1946 bis 1965 war Kelly Professor für Psychologie an der Ohio State University. Ab 1965 arbeitete er bis zu seinem frühen Tod an der Brandeis University (vgl. Sader 1980).
Kelly arbeitete in den 50er Jahren außerdem als Leiter in einem Krankenhaus. Um seinen Studenten einen Leitfaden für spezifische Vorgehensweisen innerhalb der Therapie und zur Förderung des Verständnisses gegenüber den Klienten zu vermitteln, sollte ein Handbuch für klinische Verfahren entwickelt werden (Kelly 1986). Ein bedeutender Grund für das Buch war Kellys Kritik an den maßgeblichen psychologischen Konzepten der 40er und 50er Jahre. Hauptsächlich kritisierte er dabei die behavioristische Psychologie auf der einen und die tiefenpsychologisch-psychodynamische Psychologie auf der anderen Seite. Beide Theorien berücksichtigten seiner Meinung nach nicht die Vielseitigkeit des Betrachtungsgegenstandes. Durch die Begründung, eine neue Theorie zu entwickeln, erachtete er es außerdem als notwendig, für seine neuartigen Gedanken auch eine neue Terminologie zu entwickeln (vgl. Scheer/Catina 1993), die später ausgiebig erläutert wird.
Das Werk „The Psychology of Personal Constructs“, bestehend aus zwei Bänden mit über 1.200 Seiten, entstand zusammen mit vielen Kollegen Kellys. Zuerst stellte er fest, dass es sinnlos sei, dem Leser nur mitzuteilen, wie er mit klinischen Problemen umgehen sollte, wenn er nicht wisse, warum er damit so umgehen soll. Später bemerkten Kelly und seine Schüler(innen), dass sie sich in den Jahren ihrer isolierten klinischen Praxis weit von dem entfernt hatten, was die bisherige gängige Psychologie zu sagen hatte. Die vielen impliziten Annahmen, die das Team um Kelly gemacht hatte und bereits als erwiesen ansah, mussten klar dargelegt werden. So begannen Kelly und seine Schüler(innen) zusammenhängende Annahmen zu erarbeiten, die einem breiten Forschungsfeld standhalten würden, und formulierten Überzeugungen, die sie als erwiesen betrachteten. Es entstand eine neue Persönlichkeitstheorie, die mit ihren praktischen Auswirkungen direkt in die Arbeitswelt der Psychologen reichte (Kelly 1986). 1955 veröffentlichte Kelly sein monumentales Werk über die „Personal Construct Psychology“ (PCP), die ebenso unter dem deutschen Titel „Die Psychologie der persönlichen Konstrukte“ bekannt ist. Dieses Werk enthält zum einen die theoretischen Aspekte, die unter dem Namen „Theorie der persönlichen Konstrukte“ (seit 1986 auch als deutschsprachiges Werk erhältlich) behandelt werden, und zum anderen den methodischen Zugang durch die Repertory-Grid-Technik, die auch methodisch und methodologisch der repgrid App zugrunde liegt.