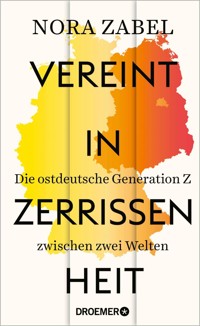
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die ostdeutsche Generation Z erhebt ihre Stimme für mehr Gerechtigkeit Deutschland ist seit über 35 Jahren wiedervereint, doch die Mauern in den Köpfen sind längst nicht abgebaut. Die Kluft zwischen Ost und West scheint größer denn je. Die Stärke der AfD – vor allem bei der jungen Wählerschaft – ist Beleg für eine große Polarisierung. Genau diese Themen greift Nora Zabel in ihrem gesellschaftskritischen Sachbuch auf. Mitte der 1990er Jahre in der mecklenburgischen Provinz geboren, verlor sie niemals die Hoffnung auf eine gleichberechtigte Gesellschaft und engagierte sich schon in ihrer Schulzeit politisch. »Man kann sich der DDR überhaupt nicht entziehen. Man wird im Osten ständig damit konfrontiert. Es ist gut, sich damit auseinanderzusetzen, um sich selbst besser zu verstehen.« Nora Zabel in tazfuturzwei.de Nr. 35/2026 Nora Zabel beschreibt die Hoffnungen, Wünsche und Ängste ihrer Generation Z, die sowohl von der DDR-Vergangenheit als auch der dynamischen Wechselbeziehung zwischen Ost und West geprägt ist. Sie stellt fest: Die Gen Z im Osten ist nach wie vor mit begrenzten Chancen in Bildung und Beruf konfrontiert. Im Westen dagegen stehen jungen Menschen ganz andere Möglichkeiten offen. In Gesprächen mit Wegbegleitern aus Ostdeutschland und Westdeutschland spürt Nora Zabel die Ursachen der Ungleichheit im heutigen Deutschland auf. Ein kluges und hoffnungsvolles Plädoyer für soziale Gerechtigkeit und eine bessere Zukunft in Ost und West Wird es der Gen Z gelingen, die Gräben zu überwinden und ein neues Kapitel in der ostdeutschen Geschichte zu schreiben? Nora Zabel ist davon überzeugt und ruft in ihrem Buch eindringlich auf, die Deutsche Einheit in den Köpfen und Herzen endlich Wirklichkeit werden zu lassen. Eine Pflichtlektüre für alle, die an der Zukunft Deutschlands interessiert sind und sich für echte Chancengleichheit einsetzen. »Ich möchte mit anderen meiner Generation mit Herzblut unsere Heimat gestalten und den Leuten klarmachen, dass es keine nette Spielerei ist, sich in der Demokratie zu engagieren, sondern ebenso für uns Ostdeutsche eine Art Pflicht.« Nora Zabel in Nordkurier 3.12.2025 Für Leser*innen von Jessy Wellmer, Steffen Mau und Ilko Sascha-Kowalczuk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Nora Zabel
Vereint in Zerrissenheit
Die ostdeutsche Generation Z zwischen zwei Welten
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Deutschland ist seit über 35 Jahren ein wiedervereintes Land, doch die soziale und bildungspolitische Spaltung zwischen Ost und West scheint unüberwindbar. In »Vereint in Zerrissenheit« erhebt Nora Zabel, 1996 geboren in der mecklenburgischen Provinz, ihre Stimme für eine echte und vor allem gerechte Einheit. In einem Mix aus persönlicher Biografie und tiefgehenden Gesprächen mit Wegbegleiter:innen beleuchtet sie die Hoffnungen, Wünsche und Ängste ihrer Generation. Trotz der Stärke populistischer Parteien und der weiter vorhandenen Ungleichheiten: Den Glauben an eine gemeinsame Zukunft verliert sie nie.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Motto
Widmung
Vorwort von Ricarda Lang
Der Osten in mir, der Westen vor mir
Die Macht der Herkunft: Bildungswege nach der DDR
Was bleibt?
Generationen, Erinnerung und die Politik am Küchentisch
»Je weiter weg die DDR ist, desto schöner wird sie in der Erinnerung.«
Wer ist eigentlich ostdeutsch?
Freizeit und Jugend in den »neuen Ländern«
Politische Prägung im Klassenzimmer: Mein erster Kontakt mit Widersprüchen
Vom Eintritt in die CDU zur politischen Erkenntnis: Meine Reise zu Hendrik Wüst
Von Merkel zu Merz: Wie eine junge Ostdeutsche die Transformation ihrer CDU erlebt
Quo vadis, CDU? Und wie Mariam Lau das sieht
»Hallo, hier ist Angela Merkel!«
Demokratie in Krisenzeiten
Zwischen Liebe und Ideologie oder: Von der Kneipe zur Weltpolitik
Von Jugendkulturen, AfD-TikToks und einem politischen Zuhause der Generation Z
Fremd im eigenen System: Politik aus der Perspektive eines »Inside-Outsiders«
Eine Frage der Bildung?
Über Bildungsaufstieg und Entfremdung nachdenken mit Armin Nassehi
Zu Hause ist da, wo ich nicht bin: Zwischen Heidelberg und Mecklenburg
»Das Entscheidende ist für mich nicht der Wohnort!« Im Gespräch mit Ilko-Sascha Kowalczuk
Warum ich das Sylt-Video twitterte – rechtes Gedankengut ist nicht gleich ostdeutsch
Was bleibt für die ostdeutsche Generation Z zu tun?
Neue Formen der Demokratiebeteiligung
Warte nicht, misch dich ein! Netzwerke, Allianzen und das richtige Timing
Kein Ende in Sicht: Sisyphos in Ostdeutschland
Dank
»Dieses verstörende Gefühl, an einem Ort zugleich zu Hause und fremd zu sein. Ehrlich gesagt, ist mir dieser Spagat mit den Jahren so gut wie unmöglich geworden.«
Didier Eribon, Rückkehr nach Reims1
Für meine Schwestern Carolin und Liene, die mich fliegen lassen und mir Halt geben
»Für einen gelingenden Perspektivwechsel zwischen Ost und West«
Vorwort von Ricarda Lang, Mitglied des Deutschen BundestagesBündnis 90/Die Grünen
Freiheit. Das war für mich in meiner Kindheit eines der vielen Wörter, die irgendwie immer da waren, unter denen ich mir aber auch nicht wirklich viel vorstellen konnte. Ich wuchs in Nürtingen, einem kleinen Städtchen in Baden-Württemberg auf, das westdeutscher kaum sein konnte. Harald Schmidt, mit dem ich den Geburtsort teile, hat einmal gesagt, dass man dort arm sei, wenn man sich im Freibad kein drittes Calippo leisten könne. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass diese Darstellung des Nürtinger Lebens etwas zu klischeehaft ist. Aber viele Anlässe, über die Bedeutung von Freiheit nachzudenken, brachte das Aufwachsen dort nicht mit sich – abseits der Frage natürlich, mit welchem Tempo man auf der Autobahn fahren darf.
Ich kann nicht genau sagen, wann sich mein Nachdenken über Freiheit verändert hat, aber ich weiß, was und wer eine sehr große Rolle dabei spielte: die Gespräche mit Mitgliedern von BÜNDNIS90, mit Bürgerrechtlern wie Werner Schulz oder Marianne Birthler, die meine Partei geprägt und verändert hatten. Für sie war Freiheit kein abstrakter Begriff, kein theoretisches Konzept. Sie hatten am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, in einem Staat zu leben, der es sich zum Ziel gemacht hat, die individuelle Freiheit zu bekämpfen und zu untergraben. Und sie wussten, dass es Menschen gelingen kann, sich Freiheit in einer friedlichen Revolution zurückzuerkämpfen.
Die Gespräche mit ihnen waren für mich und meine politische Entwicklung von unschätzbarem Wert. Und sie waren in gewisser Weise historisierend: Das, was ich zuvor im Schulunterricht gelernt hatte, wurde nun mit echten Menschen und ihren individuellen Geschichten, Träumen und Ängsten unterfüttert.
Was ich dabei allerdings lange Zeit ausgeblendet habe: Die Wiedervereinigung und das Verhältnis zwischen Ost- und Westdeutschland prägen eben nicht nur die Geschichte, sondern auch die Gegenwart unseres Landes. »Der Osten« sind nicht nur Menschen, die doppelt so alt sind wie ich, sondern auch eine Uni-Freundin, die fürs Studium aus Pirna nach Heidelberg gezogen war und sich darüber aufregte, dass ihre Heimatstadt ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen nur von Anti-Nazi-Demos bekannt war; die politische Weggefährtin, deren Familie die Wiedervereinigung nicht nur als Befreiung, sondern auch als Reihung von Abwertungen erlebt hatte – und die beim Wort »Transformation«, mit dem wir in der Grünen Jugend freudig um uns warfen, regelrecht aufschreckte; oder mein Freund Kassem Taher Saleh, der die 90er-Jahre – in Ostdeutschland nicht grundlos auch als Baseballschläger-Jahre bezeichnet – in einem sächsischen Flüchtlingsheim verbrachte und heute, als gelernter Bauingenieur, Politik für Dresden im Deutschen Bundestag macht.
Kurzum: Wie vermutlich bei vielen Menschen meiner Generation aus Baden-Württemberg, Bayern oder Nordrhein-Westfalen war die Wahrnehmung von Ost und West vor allem durch Ignoranz geprägt.
Das hat sich in den letzten Jahren verändert, vor allem durch eine selbstbewusste Generation junger Ostdeutscher, zu denen auch Nora Zabel gehört. Auch ich beschäftige mich mehr mit dem Thema und bin darüber sehr dankbar. Aber ich will ehrlich sein: Je mehr ich das tue, desto intensiver suche ich auch nach einem richtigen Zugang, einer sinnvollen politischen Auseinandersetzung. Und die Suche geht weiter.
Lange Zeit verlief die politische Debatte anhand der Frage: »Was kann der Osten vom Westen lernen?« Westdeutschland war, wie Steffen Mau in seinem Buch Ungleich vereint eindrücklich beschreibt, die Norm; und der Osten sollte sich Stück für Stück angleichen. Man muss kein Profi in politischer Analyse sein, um zu verstehen, dass dieser Ansatz weder aufgehen konnte noch aufgegangen ist. Dann folgte eine Debatte mit dem Schwerpunkt: »Was kann der Westen für den Osten tun?« Und auch wenn dieser Diskurs sinnvolle Aspekte rund um Investitionspolitik oder Repräsentation gebracht hat – vor allem dort, wo Macht verteilt wird –, droht er doch immer wieder ins Paternalistische abzurutschen. Gemeinsamkeiten mit Regionen im Westen, die eine ähnliche Sozialstruktur aufweisen, werden unsichtbar gemacht.
Wenn wir es also anders machen wollen, kann der bestmögliche Weg nur der Perspektivwechsel sein. Ziel darf nicht der Dialog zweier unversöhnlicher Blöcke sein, die sich gegenüberstehen und fragen, was sie in einer transaktionalen Beziehung vom anderen erwarten können – sondern der ernsthafte Versuch des gegenseitigen Verstehens und Weiterdenkens.
Im besten Fall bedeutet Perspektivwechsel nämlich, voneinander zu lernen. Dabei denke ich an meinen eigenen Wahlkreis, Schwäbisch Gmünd. Ähnlich wie meine Heimatstadt Nürtingen ist er eine traditionell starke Industrieregion, die durch die Automobilindustrie wohlhabend und wirtschaftlich gut aufgestellt ist. Schwäbisch Gmünd war eine dieser Städte, in denen du als Jugendlicher eine Ausbildung bei ZF oder Bosch machtest und eigentlich sicher sein konntest, die nächsten vierzig Jahre dort zu arbeiten – mit einem Metaller-Tarifvertrag, der die Familie gut absichert und den ein oder anderen Urlaub ermöglicht. In den letzten Jahren haben diese Gewissheiten allerdings zu bröckeln begonnen. Die Automobilindustrie schwächelt; Bosch hat gerade die Streichung von Tausenden von Stellen angekündigt; die Verunsicherung in der Region ist riesig.
Und hier kommt das Voneinander-Lernen ins Spiel. Natürlich sollten heutige wirtschaftliche Veränderungsprozesse besser und gerechter gestaltet werden, als es bei den wirtschaftlichen Umbrüchen in Ostdeutschland nach der Wende der Fall war. Es sollten gerade keine abrupten Brüche sein, sondern die Modernisierung eines Wirtschaftsstandorts. Bei allen Unterschieden frage ich mich deshalb, ob wir nicht – gerade, weil manches anders laufen soll – in solchen Situationen sehr viel mehr vom Transformationswissen Ostdeutschlands lernen könnten. Auch und insbesondere in Fragen von Gerechtigkeit und Fairness im Übergang.
Ohnehin: Im Kern geht es bei Aushandlungen zwischen Ost und West doch immer um das Thema, das mich überhaupt erst in die Politik gebracht hat – Ungleichheit. Ich meine damit nicht Dinge, die unterschiedlich sind und es glücklicherweise auch bleiben werden, von kulturellen Bräuchen bis hin zu Fußballpräferenzen. Ich meine Ungleichheiten, die eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit sind: ungleiche Löhne, ungleiche Erbschaften, ungleiche Renten.
Ich habe mit achtzehn Jahren angefangen, mich politisch zu engagieren, weil ich es ungerecht fand, dass meine Mutter aufgrund einer klammen kommunalen Kassenlage ihren Job in einem Frauenhaus verloren hatte. Damals machte mich vor allem wütend, wie offensichtlich ungleich wir als Gesellschaft einerseits »Frauenberufe« und andererseits Jobs mit einem hohen Männeranteil behandelten. Mit der Zeit wurde ich wütend darüber, dass bei Menschen meines Alters die Frage, ob Wohneigentum überhaupt vorstellbar ist, vor allem davon abhängt, wer geerbt hat und wer nicht. In den letzten Jahren dann habe ich ein deutlich tieferes Verständnis dafür entwickelt, wie problematisch es ist, dass diese Wahrscheinlichkeit wiederum davon abhängt, in welchem Teil Deutschlands man geboren wurde: ob im Westen oder im Osten. Das kann so nicht bleiben.
Denn was all diese Ungleichheit und Ungerechtigkeit vereint: Sie gefährden zunehmend das Versprechen der Demokratie. Ein Versprechen, das im Kern auf das Leitmotto der Französischen Revolution zurückgeht: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Sicher, diese drei Werte waren historisch nie vollends eingelöst und oft nur partikular gedacht. Doch das Streben nach ihrer Erfüllung ist eine zentrale Triebfeder moderner demokratischer Gesellschaften. Und möge es bleiben.
Ins Moderne übersetzt könnte man sagen: Alle Menschen sollen die gleichen Chancen haben. Jede und jeder soll sich frei entfalten und teilhaben können. Doch was ist, wenn sich dieses Versprechen für immer mehr Menschen eher wie Hohn anhört als wie Verheißung? Was, wenn immer weniger Menschen den Versprechungen der liberalen Demokratie glauben? Sie im Zweifelsfall sogar eher als Druck empfinden, da zunehmend wieder Ansprüche von außen und innen formuliert werden, die in der Realität immer weniger erreichbar erscheinen? Und was tun wir, wenn sich immer mehr Menschen aus Frust und Enttäuschung darüber von dieser Demokratie abwenden, weil das einfacher ist, als die Ambivalenz eines enttäuschten Versprechens zu ertragen? Ich jedenfalls bin fest davon überzeugt, dass die Krise der repräsentativen Demokratie auch eine Krise der Ungleichheit ist.
Das führt unweigerlich zur Frage: Welche Möglichkeiten haben wir, uns dieser Krise entgegenzustemmen, so wie es auch dieses Buch tut? Ich glaube, wir müssen zum einen verstehen, wie sich Konflikte in unserer Gesellschaft verschoben haben. Denn auch wenn die oben beschriebenen Ungleichheiten existieren, teilweise zunehmen und teilweise deutlich weniger abnehmen als erhofft, werden sie an vielen Stellen doch gar nicht als Konflikte der Ungleichheit im klassischen Sinne verstanden: Während soziale Konflikte in den letzten Jahren medial und politisch eher selten thematisiert wurden, drücken sie sich oft in anderen Arenen und Sphären aus. Zwischen drinnen und draußen: »Die Flüchtlinge nehmen uns die Jobs weg.« Heute versus morgen: »Der Klimaschutz zerstört unsere Wirtschaft.« Identitär: »Mit Deutschland geht’s bergab, weil wir uns nur noch mit Gendern beschäftigen.«
Man kann vor diesem Hintergrund – und meine Partei hat das allzu oft getan – den moralischen Zeigefinger erheben. Womöglich sogar spöttisch werden. Doch wir sollten uns eher fragen, ob diese Projektionen nicht auch daher rühren, dass weder Regierung noch Opposition überhaupt zugetraut wird, soziale Konflikte zu lösen. Und fragen sollten wir uns ebenfalls, ob wir uns genug Mühe gegeben haben, dem entgegenzuwirken und das demokratische Versprechen wieder mit Leben zu füllen.
Wenn wir also etwas ändern wollen, muss es zum einen darum gehen, die Kulturalisierung von materiellen Fragen wieder umzudrehen, und zum anderen darum, nicht blind zu sein für den biografischen und individuellen Teil der Ungleichheit. Bei all den angesprochenen Facetten nämlich – Frau und Mann, West und Ost, Akademikerin oder Arbeiter – geht es natürlich darum, wer wie viel auf dem Konto hat und wer sich ein gutes Leben leisten kann. Aber auch darum, wer gesehen, wer gehört wird und gestalten kann. Es geht um Anerkennung und, auch wenn der Begriff von der Sozialdemokratie leider etwas totgeritten und entkernt wurde, um Respekt.
Es wird vor diesem Hintergrund nicht einfach sein, das demokratische Versprechen wiederzubeleben. Aber eines ist klar: Es gelingt weder im Verteidigungsmodus noch in parteipolitischen Grabenkämpfen. Es braucht Mut, neue Ideen und damit auch eine neue Generation von Politikerinnen und Politikern.
Damit meine ich nicht, dass sich an einer Generation auch eine politische Haltung ablesen ließe. Das wäre eine wahnsinnig langweilige und homogenisierende Vorstellung. Nora und mich trennen nicht nur einige Kilometer zwischen unseren Geburtsorten, sondern auch viele politische Ansichten. Während Nora etwa Wahlkampf für Angela Merkel machte, bin ich gegen deren Klimapolitik auf die Straße gegangen.
Doch ich bin davon überzeugt, dass bei allen inhaltlichen Unterschieden die Chance auf eine neue politische Generation besteht. Eine Generation, welche die Spielregeln, die uns in die Vertrauenskrise hineingeführt haben, neu definiert, damit wir uns Stück für Stück wieder aus ihr herauskämpfen können. Eine Generation, die sich nicht in den Konflikten der letzten Jahrzehnte verliert, sondern über den parteipolitischen Tellerrand hinausschaut und neue Allianzen ermöglicht. Eine Generation, die versteht, dass sie gute Arbeit in den sozialen Medien nicht zu weniger substanziellen Politikerinnen oder Politikern macht – sondern dass diese Arbeit für eine zeitgemäße politische Kommunikation überlebensnotwendig ist. Eine Generation, für die es selbstverständlich ist, dass Frauen mit am Tisch sitzen, wo Entscheidungen getroffen werden, und die ein paritätisches System überall dort einfordert, wo es nicht selbstverständlich umgesetzt wird.
Eine Generation, der der Perspektivwechsel zwischen Ost und West hoffentlich besser gelingt als den Generationen zuvor.
Nora ist für mich eine Stimme dieser neuen Generation; und dieses Buch ein wichtiger Beitrag dazu. Ich hoffe, dass ihr es alle mit so viel Erkenntnisgewinn und Freude lesen werdet wie ich.
Berlin, April 2025
Der Osten in mir, der Westen vor mir
Ich sitze in einer Vorlesung in Heidelberg. Die Professorin sagt: »Erlebtes Wissen sticht immer erlerntes Wissen.« Sie fügt hinzu, dass der Begriff »Experte« vom lateinischen Verb »experiri« abstammt, was so viel bedeutet wie »erfahren« oder »erproben«. Ein Experte, so schlussfolgert sie, ist also jemand, der durch Erfahrung Wissen erlangt, nicht nur durch abstrakte Theorien, sondern durch das direkte Durchleben.
Ich frage mich: Wie viel von meiner Haltung, meinem Verständnis der Welt und mir selbst stammt aus Büchern und wie viel aus meinem eigenen Leben? Mein Aufwachsen in Ostdeutschland, auch 35 Jahre nach dem Mauerfall, ist mehr als nur eine biografische Fußnote. Es ist das Fundament meines Verständnisses von Politik, Gesellschaft und der Welt.
An diesem Tag begriff ich, dass Ostdeutschland nicht nur eine geografische Region ist, sondern ein Geflecht aus gelebten Geschichten, die bis heute in uns weiterwirken.
Doch die Frage blieb: Kann erlebtes Wissen tatsächlich immer erlerntes Wissen übertrumpfen? Und ist es nicht genauso richtig, dass wir die Grenzen unseres Erlebten erweitern? Schließlich sind es Bücher und Theorien, die uns Einblicke in Erfahrungen ermöglichen, wie wir sie selbst vielleicht niemals machen werden. Sie bieten uns die Möglichkeit, über unseren eigenen begrenzten Horizont hinauszugehen.
Doch wer ist jetzt ein echter Experte? Diese Frage spiegelt den Riss wider, der sich tief durch Deutschland zieht: die Kluft zwischen Ost und West. Erlebtes Wissen ist kontextgebunden – mein Kontext ist das Aufwachsen in Ostdeutschland, ein Raum, der so oft durch die Augen westlicher Deutungsmuster betrachtet wird. »Transformation« oder »Wiedervereinigung« sind für viele Westdeutsche abstrakte Begriffe, während sie für Menschen im Osten eine persönlich erlebte, oft schmerzhafte Realität beschreiben.
Während meines beruflichen Wirkens in der CDU und meines Studiums in Heidelberg habe ich oft eine unsichtbare Grenze gespürt. Es sind die Fragen, die ich gestellt bekomme, die feste Annahmen über mich und meine Heimat offenbaren. »Bei euch sehen die Straßen doch viel besser aus als bei uns hier.« Stimmt, die Straßen sehen oft besser aus, aber das liegt auch daran, dass hier viele andere Baustellen nie angegangen wurden. Wenn Infrastruktur der Trostpreis für verloren gegangene Arbeitsplätze, Perspektiven und Identität ist, dann danke dafür, doch schöne Straßen bringen alleine keine Zukunft.
Viele Westdeutsche staunen, wenn ich von den langen Schatten der Nachwendezeit erzähle: von den Arbeitslosen, gescheiterten beruflichen Existenzen, von der Wut, die zurückblieb, und von dem Gefühl meiner Generation Z, zwischen zwei Welten zu leben und sich nie einer ganz zugehörig zu fühlen. Wir müssen immer erklären, warum wir so denken oder so sprechen, warum wir über etwas lachen, während wir bei perfekt einstudierten Witzen schweigen. Der Osten wird nie einfach so »normal sein« dürfen, wie es der Westen ist, der Osten wird immer seine Geschichte tragen müssen – entweder die von Mauer und Stasi oder die von Aufbau oder Veränderung. Viele Menschen in Westdeutschland können nicht nachvollziehen, was es bedeutet, in einer Welt aufzuwachsen, die so radikal verändert wurde.
Zu allem und gleichzeitig nirgendwo dazuzugehören, ist unser Schicksal. Wir pendeln zwischen der eigenen Herkunft und den westdeutschen Leitbildern, die bis heute maßgeblich bestimmen, was als erstrebenswert oder erfolgreich gilt. Wir haben Wurzeln, die oft nicht gesehen werden. Und manchmal verstecken wir sie auch, weil wir denken, dass sie hinderlich sein können.
Das hier ist keine laute Anklage. Es ist mehr ein leiser Zweifel, der immer mal wieder aufkommt: Sind wir Teil von etwas Größerem oder werden wir immer nur der »andere Teil« bleiben? Gerade weil das kollektive Erinnern an die ehemalige DDR zum Streitpunkt geworden ist, möchte ich beim Schreiben behutsam sein – mit dem Wissen, dass Erinnerungen Brücken schlagen können, aber eben auch Gräben vertiefen. Während meiner Gespräche für dieses Buch begegnete ich Menschen, mit denen ich eine unerwartete Harmonie spürte – sogar dann, wenn sie der vermeintlichen Utopie einer besseren Welt in der DDR nachtrauerten. Oder vielleicht gerade deshalb? In ihren Geschichten spiegelte sich vieles von dem wider, was unsere heutige Zeit prägt: die Überforderung durch die Gegenwart, der Verlust von Visionen, die Angst vor Krieg und der ständige Versuch, sich in einer Welt beweglicher Identitäten zurechtzufinden. Ich rede mich in Rage, als ich der Autorin Jana Hensel erkläre, warum ein Teil in mir trotzdem all die Menschen in meiner Heimat verurteilt, die damals nicht gegen das Regime rebellierten. Ich fühle mich persönlich angegriffen, weil es um meine Eltern und um all diejenigen geht, die mich beim Aufwachsen begleitet haben. Unvorstellbar, dass wir die gleichen Werte teilen. Sie schaut mich resigniert an: »Die Menschen, die sich damals für ihre Umgebung eingesetzt haben, denen ihr Umfeld wichtig war, waren wie wir beide, wie Sie und ich. Nur mit dem Unterschied, dass die sich damals in der SED engagieren mussten, um überhaupt Einfluss zu haben. Wer damals wie Sie Politik machen wollte, musste diesen Weg gehen.« Als ich mich um diesen Perspektivwechsel bemühte, musste ich mir wieder einmal Ahnungslosigkeit eingestehen. Sie hatte recht. Ob Demokratie oder Diktatur: Unter all diesen Schichten bleiben wir alle dieselben Menschen, mit denselben grundlegenden Bedürfnissen nach Sicherheit, Zugehörigkeit und Sinn. In einem autoritären System mag Anpassung das Überleben sichern, in einer Demokratie mag Individualität gefördert werden. Doch der Kern bleibt: die Sehnsucht nach einem besseren Morgen, die Fähigkeit, zu lieben, zu zweifeln und zu träumen.
»Das Vergangene ist nie tot. Es ist nicht einmal vergangen.«2 Und doch kann ich aus eigener Erfahrung sagen: Es ist für das Seelenheil nicht förderlich, Erwartungen auf eine Vergangenheit zu gründen, in der man selbst noch nicht einmal gelebt hat. Der Appell an eine verjährte und möglicherweise imaginierte Schuld belastet einzig die Beziehungen in der Gegenwart.
Es ist der 1. September 2024. Heute um 18:00 Uhr wird feststehen, ob die Partei Alternative für Deutschland in Sachsen und Thüringen die Ministerpräsidenten stellen wird. Exakt an dem Tag, an dem vor 85 Jahren Deutschland mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg auslöste. Welch eine Ironie des Schicksals, denke ich mir.
Vielleicht ist es aber auch kein Schicksal, sondern reine Kausalität, wenn ich ein paar Stunden später den blauen Balken bis hoch in die 30 Prozent schießen sehe: Die AfD wird in Thüringen die stärkste politische Kraft, in Sachsen die zweitstärkste.
Meine Mutter schickt mir per WhatsApp ein Foto, auf dem sie und vier weitere Frauen in die Kamera lächeln. »Deine Verwandtschaft aus Thüringen war heute da. Es war sehr schön. Wir haben sehr geschnattert.« Sie mussten früher los, weil sie unbedingt wählen wollten. Ich brauchte gar nicht nachzufragen, was sie wählen. Sie machen keinen Hehl daraus. »Aber Nora, denen geht’s auch nicht so gut. Immer fleißige Leute gewesen. Sie sind einfach frustriert.«
Ich frage, ob sie etwas über mich gesagt haben. Ich weiß, dass sie mich und mein politisches Engagement für die CDU in den sozialen Medien verfolgen. Meine Mutter wurde ein bisschen lauter: »O Gott, nein! Du musst dich mal mit ihnen unterhalten, dann erklären sie dir, warum sie so wählen.«
Ich habe Politikwissenschaften studiert und engagiere mich seit mehr als zehn Jahren in der Christlich Demokratischen Union. Es ist mein Hobby und gleichzeitig mein Beruf, mich für politische Phänomene zu begeistern. Aber in der Familie? Es fühlt sich komisch an, meine Familie als soziologisches Labor für die Analyse von ostdeutschen Wahlergebnissen zu betrachten. Und doch ermöglicht mir diese angeborene Nähe zur ostdeutschen Erfahrungswelt einen Zugang zum Verstehen.
Familien sind der Ort der primären Sozialisation – sie sind der Schnittpunkt von Individual- und Kollektivgeschichte. Wenn wir erwachsen werden, orientieren wir uns zuallererst an unseren Eltern, wir übernehmen deren Handlungs- und Einstellungsmuster, um uns in der Welt zurechtzufinden. Kompliziert wird es dann, wenn zwischen der Eltern- und Kindergeneration zwei Staatssysteme stehen, die die Identitäten nicht unterschiedlicher hätten formen können. Noch komplizierter wird es dann, wenn das emotionale Gepäck in Form von traumatischen Erfahrungen unreflektiert und zum Teil unbewusst an künftige Generationen weitergegeben wird.
Seit einigen Jahren sammelt sich etwas in Ostdeutschland, das über die politische Unzufriedenheit von Ewiggestrigen hinausgeht. Der Generalzweifel am jetzigen demokratischen System in der breiten Masse der normalen Bürger wächst. Dabei sind Wahlen nur der Ausdruck dessen, was sich seit Jahrzehnten unter der Oberfläche abspielt.
Damit meine ich, dass das Gefühl der Entfremdung zu den politischen Eliten in Berlin wächst und das Vertrauen in die Problemlösungskompetenz der Politiker:innen abnimmt. Oder um es in den Worten eines meiner Fußballtrainer zu sagen: »Die haben doch alle keine Ahnung mehr von den Sorgen hier, die leben in ihrer eigenen Welt.« Ein Satz, den ich immer häufiger von Freunden, Bekannten oder in der Familie höre, wenn ich in meine mecklenburgische Heimat nahe Schwerin zurückkomme. Ich selbst lebe und studiere inzwischen im westdeutschen Heidelberg. Ich pendele zwischen zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und ich weiß, dass es vielen Menschen so geht, die im ehemaligen Osten geboren und aufgewachsen sind oder deren Eltern in der ehemaligen DDR groß geworden sind. Ich will nicht von einem Riss durch meinen Familien- und Freundeskreis sprechen, aber wohl doch von einer inneren Zerrissenheit.
Steffen Mau, bekannter Soziologe und Ostdeutschland-Experte, beschrieb seine Beobachtungen in seiner ehemals ostdeutschen Heimat so, dass er gleichzeitig Nähe und Distanz zu vielen Dingen verspüre. Er empfand eine Distanz, weil er mit dem Leben in Lütten Klein wenig gemein hatte, ebenso Nähe, weil er den Blick auf die Welt und die Erfahrungen nachvollziehen konnte.3
Ich will noch ergänzen, dass mir vermutlich der Humor und das unverhohlene und direkte Wesen der Ostdeutschen immer näher bleiben werden als der westdeutsche akademische Habitus. Das sind natürlich Pauschalisierungen, aber den Kern, warum es überhaupt diese Eigenheiten gibt, warum man sie nicht einfach als regionale Charaktermerkmale wegwischen kann und warum sie auch liebenswert sein können, werde ich in diesem Buch anhand meiner Beobachtungen und Gespräche mit »Daheimgebliebenen« beschreiben.
»Daheimgebliebene« klingt so alt, dabei meine ich die Leute aus meiner Generation. Der Generation Z. Wir sind die zweite Generation nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung Deutschlands. Wir sind im Gegensatz zu unseren Eltern in einem vereinten und freien Land aufgewachsen. Wir können Berufschancen wahrnehmen, von denen unsere Eltern keinen blassen Schimmer hatten, dass es sie überhaupt einmal geben wird. »Work-Life-Balance«? »Life is work!« war damals die Realität. Und ist sie im Osten der Republik heute vielfach immer noch – nur dass diese Einstellung heute kaum noch über das Existenzminimum hinausreicht und mit dem Blick in den Westen zu Ernüchterung und Gefühlen der Benachteiligung führt.
Hinzu kommen die kollektiven und individuellen Verletzungen vom Übergang der DDR zum wiedervereinten Deutschland. Was dort genau schiefgelaufen ist, erfahre ich nur aus den Geschichtsbüchern, aber dass meine Generation die negativen Erfahrungen, die all die Jahre von der Politik nicht bearbeitet wurden, mit in die Wiege gelegt bekommen hat, scheint mir eine plausible Erklärung dafür zu sein, dass populistische Parteien gerade unter jungen Leuten so viele Anhänger finden.
Und als wäre das nicht schon genug Ballast, prasseln auf die ostdeutsche, eher ländliche Gen Z Begriffe wie Feminismus, Weltbürgertum und Klimaschutz ein. Das führt bei einigen zur Überforderung und dem Gefühl des Betrogenwerdens, da die Erwartung, in derselben Welt zu sterben, in die man hineingeboren wurde, nicht eingelöst werden kann. Sie fragen sich, warum muss ich etwas an meinem Leben ändern, meine Heimat verlassen, wenn ich mich doch hier – und nur hier – wohlfühle? Die Identität speist sich aus dem Heimatgefühl, dem seit der Kindheit vorhandenen Freundeskreis, dem örtlichen Fußballverein oder der ansässigen freiwilligen Feuerwehr.
Und dann gibt es noch die, die ihre Heimat verlassen haben, um sich ein Leben fernab des Bekannten aufzubauen. Diese Leute streben nach Wandel und sozialem Aufstieg; sie widmen ihrem beruflichen Erfolg deutlich mehr Aufmerksamkeit. Sie sind die »Anywheres«, die überall leben können, im Gegensatz zu den »Somewheres«, die einen festen, vertrauten Ort zum Leben brauchen. Dieses Gegensatzpaar, auf das ich später noch zurückkomme, fußt auf einem Konzept des englischen Publizisten David Goodhart4 und liefert damit einen Erklärungsansatz für die unterschiedlichen Lebens- und Gefühlsweisen von denen, die ihre Heimat verlassen, und denen, die dageblieben sind. Ich rechne mich zu denen, die die Heimat verlassen. Ich werde aber im Verlauf des Buches erklären, dass ich beides in mir trage und mich daher mit den Menschen im Osten einerseits solidarisch fühle, mich aber andererseits in konkreten Fragen, wenn es etwa um Migrations-, Klima- oder Verteidigungspolitik geht, klar abgrenze.





























