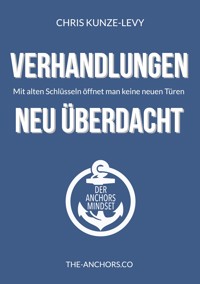
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In VERHANDLUNGEN - NEU ÜBERDACHT steht das Anchors Mindset im Zentrum - eine neue und innovative Verhandlungsmethode, die die traditionellen Ansätze in den Schatten stellt. Sie bietet nicht nur eine frische Perspektive auf Verhandlungen, sondern auch eine grundlegende Verschiebung deiner Denkweise und eine aufregende Transformation deiner Verhandlungsfähigkeiten. Verabschiede dich von den abgenutzten Verhandlungstaktiken, die tausendmal recycelt wurden. In einer Welt, in der wir immer noch den üblichen Ansatz von Gewinnen gegen Verlieren praktizieren, setzt das Anchors Mindset einen neuen Maßstab: die Erschaffung echter Win-Win-Situationen. Wie funktioniert das? Durch die Verwendung von Ankerpunkten, die eine gemeinsame Grundlage in Verhandlungen schaffen, wodurch die Kreativität und Kooperation gefördert werden, um Lösungen zu finden, die langfristig den Bedürfnissen beider Parteien gerecht werden. Das Geheimnis dieser Verhandlungsharmonie liegt in der Fähigkeit, die rationalen und emotionalen Aspekte der Verhandlung harmonisch miteinander zu verbinden. Durch die Orchestrierung dieses Gleichgewichts stellt das Anchors Mindset sicher, dass deine Verhandlungen nicht nur auf impulsiven Emotionen oder reinen Fakten basieren, sondern es betont vielmehr die Schaffung von Mehrwert und die Priorisierung gemeinsamen Erfolgs. VERHANDLUNGEN - NEU ÜBERDACHT ist keine typische Anleitung für besseres Verhandeln; es ist eine philosophische Herangehensweise. Es fordert dich heraus, den Status quo infrage zu stellen, deine Komfortzone zu verlassen und dich auf eine Reise kontinuierlicher Selbstverbesserung zu begeben. Es ermutigt dich, deinen Geist für neue Ideen und Ansätze zu öffnen, dich von herkömmlichen Weisheiten zu befreien und den Mut zu haben, anders zu sein. Wenn du bereit bist, deine Verhandlungsstrategie neu zu erfinden, um echte Win-Win-Ergebnisse zu erzielen, dann ist dieses Buch dein unverzichtbarer Begleiter. Tauche ein in die Welt des Anchors Mindsets und entschlüssle die Geheimnisse moderner Verhandlungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Hila, Joshua, Ella und Jonathan, die mir täglich zeigen, wie wertvoll Neugierde, Liebe und der Glaube an sich selbst ist.
INHALTSVERZEICHNIS
Einleitung
VERHANDELUNGEN, EIN GROSSER IRRTUM
Warum wir nicht gern verhandeln
Verhandlungsmythen - Warum wir daran glauben
Nein - Das verhasste Wort
Verlustaversion
Entscheidungsermüdung
DIE SEELE DER VERHANDLUNGEN
The-Anchors Mindset - Verhandlungen neu überdacht
Die reale Gegenwart
Die Idee der die Dualität des Denkens
Die zweigeteilte Welt
Der Schwingender Anker
Das Harvard Prinzip
Emotionen gehören zu Verhandlungen
VERBORGENE GEHEIMNISSE DER VERHANDLUNG
Der dritte Ort
Der Kennedy Effekt
Wie der Stimmung uns beeinflusst
Wie du sitzt, so verhandelst Du
Think Outside The Box - Das 18te Kamel
Dopamin Kick - der Benjamin Franklin Effekt
Lass die Zeit für Dich spielen
Der Mix macht’s
Ankern
Die Macht des Schweigens
Die Essenz von Verhandlungen
The Anchors Mindset
DER PERFEKTE VERHANDLUNGSZYKLUS
Informationen Sammeln
Ziele und Grenzen definieren
Art und Ort der Verhandlung
Terminvereinbarung und Agenda
Ankunft, Begrüßung und Small Talk
Übergang in die Verhandlung
Bedarfs- und Positionsanalyse
Interessen
Lese den Raum
Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Angebotspräsentation
Optionen und Annäherungen
Lösungen und Alternativangebot
Preisangebot und Preisverhandlungen
Einwandbehandlung
Verhandlungsabschluss
Fazit
Danksagungen
Anmerkungen
EINLEITUNG
Seit meiner Kindheit hat mich die Welt des Handballs fasziniert, und diese Begeisterung hat nie nachgelassen. Das Dröhnen der Fans, das Pfiffen der Schiedsrichter und die energiegeladenen Rufe der Spieler vermischten sich zu einem akustischen Erlebnis, das meine Sinne schärfte, wenn ich auf dem Spielfeld stand - oder wie die Handballer es nennen, auf der "Platte". Der Moment, in dem das Spiel mit dem Anpfiff startete, war jedes Mal magisch. In dieser Sekunde wurde einem klar, dass jetzt alles auf dem Spiel stand und jede Handlung unmittelbare Konsequenzen haben konnte. Fehleinschätzungen oder schlechte Entscheidungen könnten den Gegner in eine vorteilhafte Position bringen und das Spiel in die falsche Richtung lenken. In diesen Momenten gab es kein Zurückspulen, keine Möglichkeit zur Korrektur. Du wusstest, dass jeder deiner Schritte das Endergebnis beeinflusste und darüber entschied, ob du am Ende als Sieger oder Verlierer vom Platz gehen würdest.
Meine eigene Schnelligkeit, meine Sprungkraft, meine Zielgenauigkeit und nicht zuletzt meine Rolle als hochgewachsener Linkshänder schienen die perfekte Grundlage zu sein, um im Handball weit zu kommen. Insbesondere im Handball sind schnelle, groß gewachsene Linkshänder äußerst gefragt. Doch trotz all dieser Vorteile übte die Position des Torwarts auf mich eine geradezu magnetische Anziehungskraft aus. Für die meisten Menschen ist ein Torwart nur der Verteidiger des Tores, die letzte Barriere, die verhindern muss, dass der Gegner punktet, wenn die Abwehr versagt. Wir alle erinnern uns an die Schulhof-Situation oder im Freizeitsportteams, in denen derjenige, der weder rennen, werfen noch schießen konnte, ins Tor gestellt wurde, um den anderen nicht im Weg zu stehen. Doch für mich war die Rolle des Torwarts immer mehr als das. Während die Feldspieler hektisch über das Spielfeld liefen und versuchten, Tore zu erzielen, lag es allein in der Hand des Torwarts, genau das zu verhindern. Der Torwart war der einzige Spieler, der in seiner Position verharrte, eine einzigartige Rolle innerhalb des Teams.
Die Rolle des Handballtorwarts unterscheidet sich grundlegend von der der Feldspieler und erfordert, dass er gegenüber evolutionären Überlebensmechanismen und Selbstschutzinstinkten trotzt, anstatt ihnen nachzugeben. Es ist ein Fakt, dass die meisten Menschen instinktiv versuchen, sich vor einem schnell fliegenden Ball zu ducken oder auszuweichen, da das Gehirn dies als mögliche Gefahr interpretiert. In Reaktion darauf aktiviert der Körper Schutzreflexe, um Verletzungen zu verhindern. Das Zurückweichen oder Wegducken ist eine reflexartige Reaktion, um sich aus der vermeintlichen Gefahrenzone zu entfernen. Doch als Torwart musst du bewusst das genaue Gegenteil tun.
Außerdem erfordert die Position des Torwarts mehr als nur Reflexe, Entschlossenheit und Reaktionsfähigkeit. Du musst blitzschnelle Entscheidungen treffen, präzise reagieren und den Ball aus nächster Nähe parieren können. Gleichzeitig musst du in den hitzigen Momenten einen kühlen Kopf bewahren. Ein erstklassiger Handballtorwart agiert oft als Dirigent des Spiels, und diese Rolle basiert auf besonderen psychologischen Fähigkeiten statt auf Instinkten oder Bauchgefühl. Während die Feldspieler in ständiger Bewegung sind und verschiedene Aufgaben gleichzeitig bewältigen müssen, behältst du als Torwart einen ruhigen und kontrollierten Überblick über das Spielfeld. Du benötigst ein tiefes Verständnis für das Spiel und die Spielstrategie, um die Bewegungen der gegnerischen Spieler vorherzusehen und Anweisungen zu geben, die deine Mannschaft unterstützen. Dies erfordert eine hohe Spielintelligenz und die Fähigkeit, Muster im Spielverlauf zu erkennen.
Schließlich entwickeln Handballtorhüter ein einzigartiges Belohnungssystem, das auf den ersten Blick vielleicht ungewöhnlich erscheint: Schmerz! Während die meisten Menschen Schmerz als etwas Negatives empfinden, ist er für den Torwart eine Quelle der Erfüllung und Belohnung. Im Handball besteht deine Aufgabe als Torwart darin, dich dem Ball in den Weg zu stellen und Tore zu verhindern, auch wenn das bedeutet, kräftige Würfe abzuwehren, die mit hoher Geschwindigkeit auf das Tor zukommen. In erfolgreichen Momenten spürst du den Schmerz, wenn der Ball deinen Körper trifft. Doch dieser Schmerz ist gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass du alles richtig gemacht und ein Tor verhindert hast. Jedes abgewehrte Tor, begleitet von einem gewissen Schmerz, ist ein kleiner Triumph. Der empfundene Schmerz hat mich stets psychologisch gestärkt und motiviert, über deine eigenen Grenzen hinauszugehen und noch besser zu werden.
Die Fähigkeiten und die mentale Stärke, die ich als Handballtorwart entwickelt habe, haben tiefgreifende positive Einflüsse auf verschiedene Bereiche meines persönlichen und beruflichen Lebens gehabt. Diese Auswirkungen sind eng mit den psychologischen Effekten verbunden, die im Handballsport entwickelt werden und sich als äußerst wertvoll erweisen. Als Torwart habe ich gelernt, selbst unter großem Druck einen klaren und ruhigen Kopf zu bewahren. Das Treffen von Entscheidungen unter Stress ist nicht nur im Handball, sondern auch im Berufsleben von entscheidender Bedeutung. Hier müssen oft komplexe Entscheidungen unter Zeitdruck und in emotional aufgeladenen Situationen getroffen werden.
Durch das Lesen und das Vorhersagen der gegnerischen Spielzüge habe ich die Fähigkeit entwickelt, Wichtiges von Unwichtigem in meinem beruflichen und privaten Leben zu trennen. Ich habe gelernt, auf die kleinen Feinheiten zu achten, die oft den Unterschied ausmachen. Das aktive Zuhören und das Abwarten des richtigen Moments, um mit einer passenden Antwort zu reagieren, sowie die Fähigkeit, mental stark zu bleiben und das Gesamtergebnis im Blick zu behalten, auch wenn die Dinge nicht wie geplant verlaufen, sind Fertigkeiten, die mir im Handball beigebracht wurden und die sich auch außerhalb des Spielfelds als äußerst nützlich erwiesen haben.
Im Laufe meiner beruflichen Laufbahn wurde mir zunehmend bewusst, wie eng Sport, insbesondere im Kontext von Verhandlungen, mit meiner Arbeit verknüpft ist. Es wurde deutlich, dass viele der Fähigkeiten und Prinzipien, die ich als Handballtorwart entwickelt habe, erstaunlich gut auf die Welt der Verhandlungen übertragbar sind. Im Handball war es beispielsweise von entscheidender Bedeutung, die Gegner vor dem Spiel zu analysieren, Spielstrategien zu entwickeln und verschiedene Szenarien durchzuspielen. Gleiches gilt für Verhandlungen. Eine gründliche Vorbereitung legt oft den Grundstein für den Erfolg in Verhandlungen. Dabei ist es jedoch entscheidend, über oberflächliche Vorbereitungen hinauszugehen und sich auf die wichtigen Details und die psychologischen Auswirkungen der eigenen Handlungen zu konzentrieren.
Im Handball musste ich mich während eines Spiels kontinuierlich an sich verändernde Umstände, Taktiken und die Stärken meiner Mitspieler anpassen. Ähnlich müssen Verhandlungsführer flexibel sein und bereit sein, ihre Strategien anzupassen, wenn sich die Situation entwickelt. Die Fähigkeit, in Echtzeit auf neue Informationen und unerwartete Wendungen zu reagieren, kann oft den entscheidenden Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen.
Die Bedeutung der Kommunikation erstreckt sich gleichermaßen auf beide Bereiche. Als Torwart war ich oft derjenige, der Anweisungen gab, die Abwehr organisierte und das Team immer wieder motivierte. In Verhandlungen ist die Fähigkeit, klar und effektiv zu kommunizieren, mein Team zu motivieren und meinen Verhandlungspartner psychologisch positiv auf unser gemeinsames Ziel auszurichten, von entscheidender Bedeutung. Verhandeln erfordert nicht nur das Präsentieren der eigenen Position, sondern auch das aktive Zuhören und das Verständnis für die Perspektiven anderer.
Eine der bedeutendsten Lektionen, die ich im Verlauf meiner Erfahrungen im Handball und in Verhandlungen gelernt habe, ist die Erkenntnis, dass viele Menschen Verhandlungen fürchten und ihnen bewusst aus dem Weg gehen. Selbst erfahrene Verhandlungsführer stehen oft vor solchen Herausforderungen, die schwer zu überwinden sind und die es ihnen erschweren, positive Ergebnisse zu erzielen.
Was mir in diesem Zusammenhang besonders deutlich wurde, ist, dass Verhandlungen nicht zwangsläufig negative oder konfrontative Ereignisse sein müssen. Im Handball, wie im Leben, sind Konfrontationen und Herausforderungen unvermeidlich. Aber sie können als Chancen betrachtet werden, um gemeinsam Lösungen zu finden und aufeinander zuzugehen.
Diese Erkenntnis war eine treibende Kraft hinter der Idee, dieses Buch zu verfassen und meine Erfahrungen sowie Erkenntnisse mit anderen zu teilen. Mein Ziel war es, sowohl Einsteigern als auch weniger erfahrenen Verhandlern zu helfen, Verhandlungen nicht länger als unüberwindbare Hürden zu betrachten, sondern als aufregende Möglichkeiten. In diesem Buch teile ich nicht nur die Prinzipien und Fähigkeiten, die ich im Sport, im Studium und in meinem Berufsleben erworben habe, sondern zeige auch, wie man eine positive Einstellung gegenüber Verhandlungen entwickeln kann. Ich möchte Menschen ermutigen, sich auf Verhandlungen zu freuen, da sie die Gelegenheit bieten, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten und erfolgreich zu sein.
VERHANDLUNGEN – EIN GROSSER IRRTUM
WARUM WIR NICHT GERN VERHANDELN
„Du bekommst nicht, was du willst. Du bekommst, was du verhandelst“
- Harvey Mackay
Verhandlungen können für viele von uns eine Herausforderung sein, vergleichbar mit einem unangenehmen Knoten im Magen, der Unsicherheit, Schwäche und Hilflosigkeit mit sich bringt. Die Vorstellung davon allein kann einen unangenehmen Beigeschmack hinterlassen, geprägt von der Sorge, dass wir nicht das erreichen werden, was wir uns wünschen. Oft haben wir das Gefühl, dass die andere Seite alle Trümpfe in der Hand hält oder das Ergebnis auf Schadensbegrenzung abzielt.
Es ist interessant zu bemerken, dass diese Abneigung gegenüber Verhandlungen auf einige nachvollziehbare Ursachen zurückzuführen ist. Viele von uns tragen Erfahrungen aus der Schulzeit mit sich, in der negative Situationen unser Selbstvertrauen beeinträchtigt haben. Diese Erfahrungen haben Ängste vor dem Scheitern, dem Unterlegenfühlen und dem Gefühl, ausgenutzt zu werden, verstärkt. Die Befürchtung, nicht akzeptiert oder abgelehnt zu werden, begleitet uns.
Paradoxerweise sind wir von Natur aus geborene Verhandler. Schon in einem zarten Alter von etwa zwei bis drei Jahren entwickeln wir einen ausgeprägten Sinn für Verhandlungen. Wir verhandeln ständig mit Spielkameraden, Eltern, Geschwistern und Erziehern im Kindergarten. Der Grund dafür ist simpel: Das Leben eines Kindes ist ein fortwährendes Spiel.
In unseren frühen Jahren waren wir beharrlich und lernten aus unseren Fehlern. Wir bewegten uns mutig und ohne übermäßige Ängste vorwärts. Wenn etwas nicht funktionierte, behielten wir selten Groll, denn Plan B stand (noch) nicht auf unserer Liste. Unsere Verhandlungsstrategien folgten kaum festen Regeln oder Vorstellungen. Jeder Versuch war ein ehrgeiziger Schritt in Richtung unseres Ziels, und wir waren stets darauf fokussiert, wie wir es beim nächsten Mal noch besser schaffen könnten.
Doch dann trat eine Veränderung ein, als wir die Schule betraten. Trotz unserer anfänglichen Neugierde und Freude am Lernen wurden uns schnell die Flügel gestutzt. Der Lehrer mahnte uns, stillzusitzen, zuzuhören und uns zurückzuhalten. Es schien niemanden wirklich zu interessieren, was uns bewegte oder in welchen Bereichen wir talentiert waren.
Das Schulsystem basiert auf einer klaren Hierarchie, in der die Macht in den Händen einer einzigen Person, des Lehrers, liegt. Gehorsamkeit gegenüber dem Lehrer wurde uns eingetrichtert, unabhängig davon, ob seine Ansichten korrekt waren oder nicht. Es wurde uns systematisch abgewöhnt, Fehler machen zu dürfen oder Einwände zu erheben. Nur ein vorgegebener Weg zur vermeintlich richtigen Antwort war akzeptabel. Kollaboration zwischen Schülern, sei es bei Hausaufgaben oder Tests, wurde oft missbilligt.
Das Schulsystem erstickt häufig den Geist des Lernens und die Kreativität von Kindern und Jugendlichen. Es prägt unser Denken um und verwandelt Individualität in Konformität.
Dieses Verhalten wird oft noch durch das Handeln unserer Eltern verstärkt. Während sie in jungen Jahren unsere Kreativität lobten und förderten, werden wir in der Schulzeit dazu gedrängt, exzellente Leistungen zu erbringen, indem wir brav den Schulregeln folgen und stets zu den Besten gehören sollten. Am Ende unserer schulischen Laufbahn leiden viele von uns unter einem geringen Selbstvertrauen und der übertriebenen Angst, Fehler zu machen oder zu versagen. Wir haben uns daran gewöhnt, mit dem Strom zu schwimmen, unauffällig zu sein und Autoritäten ohne Hinterfragen zu akzeptieren.
VERHANDLUNGSMYTHEN – WARUM WIR DARAN GLAUBEN
„Mythen erweisen sich langlebiger als wissenschaftliche Erkenntnisse“
- Helmut Glaßl
Mythen sind faszinierende Erzählungen, die einst mündlich über Generationen hinweg weitergegeben wurden und später in verschiedenen bekannten Werken niedergeschrieben wurden. Diese Geschichten handelten oft von Göttern, Helden oder Dämonen und erzählten von epischen Abenteuern. Die griechischen, ägyptischen und römischen Götter sowie die unvergessliche Odyssee des Odysseus oder die erstaunliche Eroberung von Troja sind einige der bemerkenswerten Mythen, die bis heute unsere Vorstellungskraft beflügeln. Im Laufe der Zeit entstanden auch aus anderen Kulturen zahlreiche weitere Mythen, die Bräuche, Rituale und Traditionen erklärten und uns eine praktische Anleitung für das tägliche Leben boten. Viele dieser Mythen haben sich bis heute in religiösen Schriften unterschiedlicher Kulturen erhalten.
Es ist bedeutend zu beachten, dass während der Blütezeit der Mythen und Legenden die Mehrheit der Menschen weder lesen noch schreiben konnte. Die Schulpflicht war unbekannt, und nur wenige Privilegierte beherrschten das Lesen und Schreiben. Daher ist verständlich, dass Mythen uns halfen, die Welt und ihre Geheimnisse zu begreifen und zu erklären. Doch auch in Zeiten des scheinbar grenzenlosen Zugangs zu wissenschaftlicher Forschung, Bildung und dem Internet erfüllen Mythen immer noch eine wichtige Funktion für unser Wohlbefinden und die Bewältigung unseres Lebens.
Ein bekannter Mythos, der bis heute anhält, betrifft den vermeintlich hohen Eisengehalt von Spinat. Diese Legende entstand bereits im Jahr 1890 durch einen einfachen Rechenfehler des Physiologen Gustav von Bunge. Obwohl er den Eisengehalt von 100 Gramm Spinat korrekt mit 35 Milligramm ermittelte, hatte er getrockneten Spinat analysiert, der zehnmal mehr Eisen enthielt als die gleiche Menge frischen Blattgemüses. Auch wenn der Irrtum schnell aufgedeckt wurde, geriet er rasch in Vergessenheit. Allerdings trug die Popularität von Popeye, der dank des grünen Krauts übermenschliche Kräfte erlangte und sich mit eisernen Fäusten verteidigte, dazu bei, dass dieser Mythos weiterlebt. Noch heute versuchen Eltern, ihre Kinder mit dieser Geschichte dazu zu bewegen, das gesunde Gemüse zu essen.
Weitere weitverbreitete Mythen, deren Ursprung oft unbekannt ist, werden dennoch von vielen Menschen geglaubt und weitergegeben. Ein solcher Aberglaube betrifft beispielsweise das Hinzufügen von Öl zum kochenden Nudelwasser, um ein Verkleben der Nudeln zu verhindern. Wir alle haben es vermutlich schon getan, obwohl wir aus dem Physikunterricht wissen sollten, dass das Öl einfach auf der Wasseroberfläche schwimmt und den Kochprozess nicht beeinflusst. Tatsächlich ist regelmäßiges Umrühren nach wie vor die beste Methode, um perfekte Pasta zuzubereiten. Selbst der berühmte Schuss Olivenöl nach dem Kochen und vor dem Servieren der Nudeln beeinträchtigt den Geschmack, da die Pasta dadurch weniger Saucen aufnimmt. In gewisser Weise "versiegeln" wir damit sogar die Nudeln vor der Sauce, was ihr Aroma mindert.
Ähnlich wie im Alltag greifen auch Verhandlungstrainer immer noch auf Mythen zurück, wenn es um Verhandlungstechniken und erfolgreiche Verhandlungen geht. Obwohl diese Mythen wissenschaftlich nicht belegt sind, halten sie sich hartnäckig. Forscher vermuten, dass Mythen so beliebt sind, weil sie durch ihre bildhafte Darstellung sehr eindrucksvoll, leicht verständlich und universell zugänglich sind. Dadurch werden sie leichter von einer breiten Masse akzeptiert als eine rein faktenbasierte und rationale Darstellung von Prozessen und Situationen. Unklarheiten, Unwissenheit oder Fremdbestimmung erhalten durch Mythen einen Rahmen der Orientierung, Hintergründe erscheinen plötzlich sinnvoll und die Realität wirkt einfach und logisch. Dadurch können Ängste und Unsicherheiten leichter überwunden werden. Die ständige Wiederholung durch verschiedene Quellen verleiht dem Mythos zusätzlich eine gewisse Glaubwürdigkeit.
Der Mythos der "Verhandlung aus der Position der Macht" gehört zweifelsohne zu den weitverbreitetsten Irrtümern in der Verhandlungslehre. Er besagt, dass bestimmte Verhandlungsteilnehmer aufgrund ihrer Macht und Dominanz in der Lage sind, Verhandlungen nach ihren Bedingungen zu beeinflussen und zu ihren Gunsten abzuschließen. Dieser Irrglaube hält sich nur deshalb so hartnäckig, weil viele Menschen automatisch sozialen Status, Reichtum, Image, Titel oder Reputation mit Macht und Dominanz gleichsetzen und sich dieser Macht unterordnen. Doch die "Position der Macht" einer einzelnen Person verändert sich mit jeder Situation. In Verhandlungen ist es nicht die Macht, die wir einer Person zuschreiben, sondern vielmehr die Position, die sie in der jeweiligen Situation einnimmt.
Ein eindrucksvolles Beispiel liefert uns die US-Präsidentschaftswahl von 1980, bei der der amtierende Präsident Jimmy Carter gegen Ronald Reagan antrat. Zu Beginn des Wahlkampfes galt Jimmy Carter als erfahrener Politiker und Amtsinhaber, während Ronald Reagan oft als Schauspieler und damit als politischer Außenseiter abgetan wurde. Carter hatte bereits vier Jahre als Präsident gedient und wurde von vielen als Favorit angesehen.
Doch Reagan gelang es, eine breite Unterstützung bei den Wählern zu gewinnen, indem er eine klare und überzeugende Vision für Amerika präsentierte. Er versprach niedrigere Steuern, eine Stärkung der Wirtschaft und eine robustere Außenpolitik. Reagan sprach die Unzufriedenheit vieler Amerikaner mit der wirtschaftlichen Lage und den internationalen Angelegenheiten direkt an. Im Verlauf des Wahlkampfes positionierte sich Reagan geschickt als starke Alternative zu Carter und traf den Nerv der Wählerschaft. Seine Kommunikationsfähigkeiten und sein Charisma halfen ihm, die Unterstützung der Bevölkerung zu gewinnen, während Carter mit Herausforderungen wie der anhaltenden wirtschaftlichen Stagnation und der Geiselnahme in der amerikanischen Botschaft im Iran zu kämpfen hatte.
Am Tag der Wahl wurde deutlich, dass Reagan die Herzen und Stimmen der Wähler für sich gewonnen hatte. Er sicherte sich einen überzeugenden Sieg und wurde der 40. Präsident der Vereinigten Staaten. Carter musste die Niederlage hinnehmen und verlor seine Machtposition gegenüber dem vermeintlichen "Nobody" Reagan.
Dieses Beispiel verdeutlicht eindrucksvoll, dass es nicht allein die vermeintliche Macht ist, die den Erfolg in Verhandlungen bestimmt. Viel wichtiger ist die Art und Weise, wie man sich in der gegebenen Situation positioniert und die Bedürfnisse und Wünsche der Beteiligten anspricht. Es zeigt, dass wirkungsvolle Verhandlungen auf klaren Visionen und überzeugender Kommunikation beruhen, unabhängig von vorgeblich vorhandener Macht und Dominanz.
Ein weiterer weit verbreiteter Mythos betrifft die fälschliche Annahme, dass Verhandlungspositionen bereits im Vorfeld einer Verhandlung festgelegt sind und während des Verhandlungsprozesses kaum verändert werden können. Diese Vorstellung entspringt einer kognitiven Verzerrung, die unsere individuelle Wahrnehmung unserer eigenen Stärke im Vergleich zur Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder Institution beeinflusst. Oft fühlen wir uns als Einzelpersonen schwächer, wenn wir einer etablierten Gruppe oder einem Unternehmen gegenüberstehen. Doch liegt es in unserer Macht, unsere eigene Position während der Verhandlung zu stärken oder die Position unseres Verhandlungspartners zu schwächen.
Nehmen wir an, es kommt zu einer Verhandlungssituation zwischen einem hochrangigen CEO eines großen Technologieunternehmens und einem unabhängigen Softwareentwickler, der eine revolutionäre Idee entwickelt hat, die den Markt auf den Kopf stellen könnte. Der CEO zeigt Interesse daran, diese innovative Technologie für sein Unternehmen zu erwerben, da sie enorme Wettbewerbsvorteile verspricht. Der Softwareentwickler wiederum möchte seine Technologie verkaufen, jedoch sicherstellen, angemessen entlohnt zu werden und weiterhin Einfluss auf ihre Verwendung zu behalten.
Aus der Perspektive des Softwareentwicklers mag der CEO aufgrund seiner Macht und Ressourcen eine dominante Verhandlungsposition innehaben. Er besitzt eine starke Marktposition, ein etabliertes Unternehmen und beträchtliche finanzielle Mittel. Es mag den Anschein haben, als könne er die Preisgestaltung und Konditionen nach Belieben diktieren. Der Softwareentwickler hingegen könnte sich in einer vermeintlich schwächeren Position sehen, da ihm vergleichbare Ressourcen, Finanzmittel und möglicherweise Verhandlungserfahrung fehlen, um seine Vision nach eigenen Vorstellungen zu verwirklichen.
Was der CEO jedoch möglicherweise übersehen könnte, ist die entscheidende Ressource, die der Softwareentwickler besitzt: das geistige Eigentum dieser bahnbrechenden technologischen Innovation. Wenn diese Technologie tatsächlich wegweisend ist und eine hohe Marktnachfrage besteht, wird der CEO auf den Erwerb dieser Technologie angewiesen sein, um im Wettbewerb bestehen zu können. In dieser Situation könnte der Softwareentwickler, sofern er sich seiner eigenen Macht bewusst ist, die Konditionen beeinflussen und seine Interessen schützen, um bessere Verhandlungsergebnisse zu erzielen. Er könnte etwa eine höhere Kaufsumme verlangen, eine Beteiligung an zukünftigen Gewinnen verhandeln oder bestimmte Nutzungsbedingungen für die Technologie festlegen. Je innovativer die Idee des Softwareentwicklers ist, desto geringer ist der Spielraum des CEOs.
Diese und zahlreiche andere Mythen im Bereich der Verhandlungsführung fungieren gewissermaßen wie Placebos. Sie haben keine inhärente Wirkung und führen nur dann zum Erfolg, wenn beide Seiten an ihre Gültigkeit glauben. Wenn unser Ziel jedoch darin besteht, in komplexen und anspruchsvollen Verhandlungssituationen erfolgreich zu agieren, sollten wir bestrebt sein, solche Mythen weitestgehend zu vermeiden. Stattdessen sollten wir uns auf eine klare und rationale Analyse der Verhandlungssituation stützen und auf strategische Ansätze setzen, die auf nachweisbaren Fakten basieren, um unsere Ziele zu erreichen.
„NEIN“ - DAS GEHASSTE WORT
„Nein zu sagen ist so herzzerreißend“
- Britney Spears
Warum löst das kleine Wort „Nein“ in uns so viele Emotionen und sogar Ängste aus? Die Antwort darauf findet sich in unserer Kindheit. Von Anfang an verbinden wir mit dem Wort „Nein“ fast ausschließlich negative Emotionen. Wie oft haben wir als Kinder dieses Wort von unseren Eltern oder Spielkameraden gehört? "Nein", wenn wir länger wach bleiben wollten. „Nein“, wenn wir den Lutscher an der Supermarktkasse haben wollten. „Nein“, wenn wir wieder mal mit dem Essen gespielt haben. „Nein“, wenn wir das Schaufeln im Sandkasten haben wollten und das andere Kind uns dies nicht überlassen wollte, auch wenn es gerade nicht damit spielte.
In unserer kindlichen Wahrnehmung war die Welt nicht rational, sondern emotional und spielerisch. Dadurch empfanden wir dieses Wort als eine Ablehnung unserer Experimentierfreude oder unseres Spaßes am Erforschen von etwas Neuem. Ich erinnere mich nicht daran, dass ich als Kind jemals etwas Positives mit dem Wort verbunden habe. Für mich war es immer negativ geprägt - frustrierend und abweisend. Diese Prägung wurde in unserer kindlichen Welt noch verstärkt, weil das Wort zwei widersprüchliche Bedeutungen hatte. Wir mussten lernen, dass ein „Nein“ unserer Eltern eine in Stein gemeißelte negative Aussage war, die wir akzeptieren mussten. Andererseits haben unsere Eltern jedoch sehr selten unser „Nein“ akzeptiert. Äußerungen wie „Nein, ich räume mein Zimmer nicht auf“ oder „Nein, ich will meine Hausaufgaben nicht machen“ wurden mit Rügen, finsterem Blick, unangenehmen Konsequenzen oder sogar Bestrafung beantwortet. Zusätzlich mussten wir natürlich auch Dinge tun, die wir nicht wollten. In unserer emotionalen, spielerischen Welt konnten wir die rationalen Hintergründe dafür nicht verstehen.
Diese Erfahrungen haben dazu geführt, dass das Wort „Nein“ eine besondere emotionale Bedeutung für uns hat und es uns schwerfällt, damit umzugehen. Die negative Prägung aus der Kindheit wirkt immer noch nach und beeinflusst unser Verhalten und unsere Reaktionen als Erwachsene. Es ist wichtig, uns bewusst zu machen, dass das Wort „Nein“ nicht immer eine Ablehnung unserer Person oder unserer Ideen bedeutet, sondern oft einfach nur eine Meinungsverschiedenheit oder eine klare Grenze darstellt. Durch eine bewusste Auseinandersetzung mit unseren Emotionen und Erfahrungen können wir lernen, mit einem „Nein“ besser umzugehen und es nicht als persönlichen Angriff zu empfinden. Dies ermöglicht es uns, konstruktiver und gelassener mit ablehnenden Aussagen umzugehen und in Verhandlungen, Beziehungen und dem alltäglichen Leben souveräner zu agieren.
Auch war uns als Kind das Gegenteilprinzip fremd. Worte und ihre Bedeutung haben wir getrennt voneinander gelernt und empfunden. Erst in späterer Entwicklung haben wir verstanden, dass einzelne Worte in direktem Zusammenhang zueinander stehen können. Lange Zeit war uns nicht klar, dass zum Beispiel „Rechts“ das Gegenteil von „Links“ ist. Für uns war links einfach nur links und rechts eben rechts - ohne dass dort ein erkennbarer Zusammenhang bestehen musste. Ein anschauliches Beispiel hierfür zeigt sich, wenn Kinder Fahrradfahren lernen. Rufen Eltern ihren Kindern zum Beispiel zu „nicht nach links fahren“, werden sie oft erstaunt feststellen, dass das Kind mit großer Wahrscheinlichkeit weiterhin geradeaus fährt und nicht automatisch nach rechts abbiegt. Dasselbe gilt für den aus Sicht der Eltern logischen Zusammenhang zwischen „Ja“ und „Nein“.
Wenn wir als Kinder beispielsweise aufgefordert wurden, „Nein, nicht mit den Händen essen“, waren wir verwirrt und wussten nicht, was unsere Eltern von uns erwarteten. Unsere Verwirrung bezog sich darauf, ob wir weiter essen sollten oder nicht und wenn ja, wie? Erst später konnten wir den Zusammenhang erkennen und verstehen, dass wir weiteressen sollten, aber eben nicht mit den Händen, sondern mit Gabel oder Löffel.
Diese negativen und teilweise widersprüchlichen Erfahrungen tragen wir noch heute in uns. Da wir auf ein „Nein“ immer erst emotional reagieren und erst später den rationalen Zusammenhang mit dem entsprechenden Ereignis herstellen, versuchen die meisten Menschen, jedem potenziellen "Nein" aus dem Weg zu gehen, um nicht diese emotionale Achterbahnfahrt von Ablehnung und Unverständnis durchleben zu müssen. Daher vermeiden wir oft, ein direktes „Nein“ auszusprechen, um unserem Gegenüber nicht in diese emotionale Situation zu bringen. Wer kennt es nicht, wenn wir von einem Freund gefragt werden, ob wir Lust haben, am Wochenende um die Häuser zu ziehen, und unsere erste Reaktion ein spontanes „Nein, kein Bock“ ist. Dennoch antworten wir jedoch oft mit einem halbherzigen „Im Grunde kein Problem. Ich spreche mal mit meinem Partner, ob nichts anderes geplant ist“ oder „Ja, könnte klappen“.
VERLUSTAVERSION
„Ich hatte schon immer eine Abneigung gegen Schulden“
- Brunello Cucinelli
In der Welt der Entscheidungsfindung und des menschlichen Verhaltens gibt es ein faszinierendes Phänomen, das unsere Denkweise und unsere Entscheidungen maßgeblich beeinflusst: die Verlustaversion. Die Verlustaversion beschreibt unsere angeborene Tendenz, Verluste stärker zu fürchten und zu meiden als potenzielle Gewinne. Diese psychologische Neigung spielt eine bedeutende Rolle in unserem beruflichen und persönlichen Leben und kann erheblichen Einfluss auf unsere Entscheidungen haben.
Aber woher kommt diese Verlustaversion, und warum sind wir so anfällig dafür? Um dies zu verstehen, müssen wir einen Blick auf die menschliche Evolution und die Funktionsweise unseres Gehirns werfen.
Die Verlustaversion ist eng mit unserem evolutionären Überlebensinstinkt verbunden. In früheren Zeiten, als unsere Vorfahren als Jäger und Sammler lebten, waren Ressourcen knapp und das Überleben hing von der Sicherung von Nahrung, Schutz und anderen lebenswichtigen Gütern ab. In dieser Umgebung war es für das Überleben entscheidend, Verluste zu vermeiden, da sie die Zukunft und das Wohlergehen gefährden konnten. Diejenigen, die erfolgreich Verluste minimierten, hatten größere Chancen zu überleben und ihre Gene weiterzugeben. Diese evolutionäre Prägung ist bis heute in uns präsent.
Untersuchungen haben gezeigt, dass Verluste in unserem Gehirn stärker wahrgenommen werden und eine größere emotionale Reaktion hervorrufen als Gewinne. Eine Studie von Benedetto De Martino vom britischen University College London zeigt, wie irrational Menschen reagieren, wenn sie vor die Wahl zwischen Gewinn und Verlust gestellt werden. Die Forscher ließen Probanden ein Spiel spielen, bei dem sie 50 britische Pfund gewinnen konnten. Die Teilnehmer mussten vor dem Spiel wählen: entweder direkt aussteigen und 20 Pfund Prämie erhalten oder am Spiel teilnehmen, mit der Chance, die genannten 50 Pfund zu gewinnen oder leer auszugehen, wenn sie das Spiel verlieren. 57 Prozent der Probanden entschieden sich daraufhin auszusteigen und die 20 britischen Pfund zu behalten.
Der Bereich unseres Gehirns, der für die Verarbeitung von Bedrohungen und negativen Emotionen zuständig ist, reagiert intensiver auf Verluste, während der Bereich, der mit Belohnungen und positiven Emotionen verbunden ist, weniger stark aktiviert wird. Dies führt dazu, dass wir Verluste als schmerzhafter empfinden und versuchen, sie um jeden Preis zu vermeiden.
Emotionen im Allgemeinen lassen sich nicht einfach unterdrücken, da sie sich aus all unseren Erinnerungen an Verluste oder Versagen zusammensetzen und die damit verbundenen negativen Gefühle. Zum Beispiel der Frust, den wir als Kleinkind an der Supermarktkasse hatten, wenn wir den Lutscher nicht bekommen haben, den wir wollten. Die Enttäuschung, als wir zum Geburtstag oder zu Weihnachten nicht die ersehnten Geschenke erhalten haben. Das Gefühl der Ratlosigkeit, wenn unsere Mannschaft das Spiel verloren hat, obwohl wir besser als der Gegner gespielt haben. Diese und unzählige ähnliche Situationen haben uns im Laufe unserer Entwicklung geprägt und uns ein eigenes Warnsystem aufbauen lassen: die Verlustaversion.
Diese persönliche Sensibilisierung des irrationalen Wunsches der Vermeidung von Verlusten in unsicheren und unbekannten Szenarien führt unweigerlich zu physischen und emotionalen Reaktionen, noch bevor wir die eigentliche Situation durchleben. Wie das Lampenfieber vor einer Prüfung, das uns blockiert. Die Scham, uns zu blamieren, wenn wir plötzlich in einem Meeting gefragt werden und spontan antworten müssen. Wie die Panik, sich schlecht informiert oder sogar dumm zu fühlen, plötzlich zu stottern oder gar zu schwitzen, wenn wir vor einer Gruppe von Menschen frei sprechen sollen.
Verlustängste werden im Laufe des Lebens intensiver, je mehr Gewinnund Verlustsituationen wir durchleben. Forscher gehen davon aus, dass Erwachsene den Schmerz des Verlustes bis zu viermal stärker wahrnehmen als das Glücksgefühl des Gewinns. Wenn wir zum Beispiel 50 Euro auf unserem Konto haben, freuen wir uns deutlich mehr über zusätzliche 100 Euro, als wenn wir 100 Euro geschenkt bekommen und auf unserem Konto bereits 1.000 Euro vorhanden sind. Im Arbeitsumfeld kann eine Verlustaversion dazu führen, dass wir uns vor Veränderungen und Risiken scheuen.
Diese tiefsitzende Verlustaversion kann uns davon abhalten, neue Möglichkeiten zu ergreifen und uns von unserem eigentlichen Potenzial abhalten. Statt uns auf Chancen und potenzielle Gewinne zu konzentrieren, verharren wir oft in unseren Komfortzonen, um mögliche Verluste zu vermeiden. Doch gerade in einer sich schnell verändernden Welt ist die Bereitschaft, Risiken einzugehen und aus unseren Erfahrungen zu lernen, von entscheidender Bedeutung für persönliches Wachstum und beruflichen Erfolg.





























