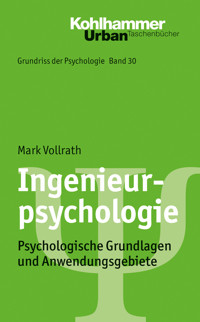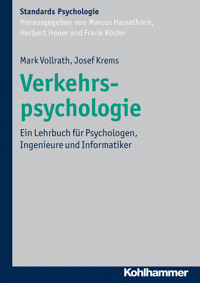
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der moderne Verkehr wird immer sicherer, obwohl die Anforderungen an die Verkehrsteilnehmer zunehmen. Hohe Verkehrsdichten, komplexe städtische Umgebungen, neue Informationstechnologien und automatisches Fahren sind einige Schlüsselthemen. Im Mittelpunkt der modernen Verkehrspsychologie steht inzwischen das System Fahrer-Fahrzeug-Umwelt. Psychologen arbeiten in interdisziplinären Teams auch an der Gestaltung von Fahrzeugen, Straßen und Verkehrssystemen mit. Dieses Lehrbuch vermittelt ein grundlegendes Verständnis des Fahrers im Verkehr und seiner Interaktion mit neuen technischen Systemen - und hoffentlich auch den Reiz, den dieses wachsende Gebiet auf Forscher und Anwender ausübt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der moderne Verkehr wird immer sicherer, obwohl die Anforderungen an die Verkehrsteilnehmer zunehmen. Hohe Verkehrsdichten, komplexe städtische Umgebungen, neue Informationstechnologien und automatisches Fahren sind einige Schlüsselthemen. Im Mittelpunkt der modernen Verkehrspsychologie steht inzwischen das System Fahrer-Fahrzeug-Umwelt. Psychologen arbeiten in interdisziplinären Teams auch an der Gestaltung von Fahrzeugen, Straßen und Verkehrssystemen mit. Dieses Lehrbuch vermittelt ein grundlegendes Verständnis des Fahrers im Verkehr und seiner Interaktion mit neuen technischen Systemen - und hoffentlich auch den Reiz, den dieses wachsende Gebiet auf Forscher und Anwender ausübt.
Professor Dr. Mark Vollrath, Lehrstuhl für Ingenieur- und Verkehrspsychologie, TU Braunschweig. Professor Dr. Josef Krems, Professur für Allgemeine und Arbeitspsychologie, TU Chemnitz.
Kohlhammer Standards Psychologie
Begründet von Theo W. Herrmann Werner H. Tack Franz E. Weinert (†)
Herausgegeben von Marcus Hasselhorn Herbert Heuer Frank Rösler
Mark Vollrath, Josef Krems
Verkehrspsychologie
Ein Lehrbuch für Psychologen, Ingenieure und Informatiker
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikrofilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
1. Auflage 2011 Alle Rechte vorbehalten © 2011 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
Print: 978-3-17-020846-9
E-Book-Formate
pdf:
epub:
978-3-17-028138-7
mobi:
978-3-17-028139-4
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort
Vorwort
1 Was ist Verkehrspsychologie?
1.1 Verkehr und Psychologie
1.2 Was ist »Verkehrspsychologie«?
1.3 Geschichtliches
1.4 Zentrale Fragestellungen der Verkehrspsychologie
1.5 Berufsbild »Verkehrspsychologe« – Praxisfelder
1.5.1 Der Fahrer
1.5.2 Verkehrsmittel-bezogene Anwendungsfelder
1.5.3 Gestaltung des Verkehrsumfeldes
1.6 Ausblick
1.7 Inhalt und Ziele des Lehrbuchs
2 Fahren
2.1 Was muss der Fahrer tun? Die Fahraufgabe
2.2 Kognitive Prozesse
2.2.1 Fahren ist Sehen – visuelle Wahrnehmung und Aufmerksamkeit
2.2.2 Was ist hier eigentlich los? Das Situationsbewusstsein
2.2.3 Aktionsauswahl und -kontrolle
2.3 Menschen können sicher fahren – Zusammenfassung
3 Fehler und Unfälle im Straßenverkehr
3.1 Verkehrspsychologen machen den Verkehr sicherer
3.2 Menschen machen ständig Fehler
3.3 Nicht jeder Fehler führt zum Unfall – warum eigentlich?
3.4 Macht die Verkehrspsychologie den Verkehr sicherer?
4 Methoden der Verkehrspsychologie
4.1 Hat die Verkehrspsychologie eigene Methoden?
Exkurs: Das Experiment – Nachweis von Wirkungen
4.2 Verkehrspsychologische Studien – Alternativen und Ergänzungen zum Experiment
4.2.1 Epidemiologie – Wie viel trinken deutsche Fahrer?
4.2.2 Unfallrisiko – Wie schädlich ist Alkohol?
4.2.3 Feldstudien – Wann ist eine Kreuzung schwierig?
4.2.4 Evaluationsstudien zur Erhöhung der Verkehrssicherheit – »Hallo Raser, wir warten!«
4.2.5 Natürliches Fahrverhalten oder Fahrsimulator – Was ist die Wirklichkeit?
4.3 Verkehrspsychologie braucht eigene Methoden
5 Fahrer und Alter
5.1 Man ist nur so alt wie man sich fühlt – was ist eigentlich »Alter«?
5.2 Alter und Unfallrisiko
5.3 Beeinträchtigungen und Kompensation bei älteren Fahrern
5.4 Fahrausbildung und Maßnahmen bei jüngeren Fahrern
5.5 Alter ist Persönlichkeit, Erfahrung und Fähigkeiten
6 Andere Verkehrsteilnehmer
6.1 Es gibt nicht nur Autofahrer…
6.2 Fußgänger
6.3 Radfahrer
6.4 Kinder
6.5 Motorradfahrer
6.6 Verkehr als Beruf
6.7 … sondern viele andere Gruppen im Verkehr, an die man bei »Verkehrssicherheit« denken muss
7 Der Fahrerzustand und seine Auswirkungen
7.1 »Mir geht es nicht so gut, aber fahren kann ich schon noch« – Selbstwahrnehmung und Leistung
7.2 Alkohol
7.3 Sind Drogen wirklich gefährlich? Braucht man Medikamente zum sicheren Fahren?
7.4 »Ich bin ziemlich müde – aber das letzte Stück schaffe ich auch noch…« – Müdigkeit
7.5 »Der hinten drängelt, der vorne bremst – was soll ich tun?« Überforderung und Stress
7.6 Wer nimmt schon Drogen beim Fahren? Die Bedeutung des Fahrerzustands
8 Fahrerinformationssysteme und ihre Auswirkungen
8.1 Worüber wird der Fahrer informiert?
8.2 Welche Systeme gibt es?
8.2.1 Navigationssysteme
8.2.2 Nachtsichtassistenz
8.2.3 Warnsysteme
8.2.4 Was gibt es noch und wie geht es weiter?
8.3 Ablenkung durch Informationssysteme – größer als der Nutzen?
8.4 Wie sollte man Informationssysteme gestalten?
8.5 Wie bewertet man die Wirkung von Informationssystemen?
8.5.1 Okklusionsmethode
8.5.2 Peripheral Detection Task (PDT)
8.5.3 Lane-Change-Task (LCT)
8.6 Welche Informationen hat der Fahrer der Zukunft?
9 Fahrerassistenzsysteme
9.1 FAS – was ist das?
9.2 Wie funktionieren Assistenzsysteme?
9.2.1 Was ist Assistenz und Automation beim Fahren?
9.2.2 Warum entwickelt man Assistenzsysteme?
9.2.3 Wie sind Fahrerassistenzsysteme aufgebaut?
9.2.4 Wichtige Assistenzsysteme – ein kleiner Überblick
9.3 Kommen Fahrer mit Assistenzsystemen zurecht?
9.3.1 Grenzen der Automatisierung
9.3.2 Von der direkten Regelung zur Überwachung
9.3.3 Entlastung und Vigilanzminderung
9.3.4 Veränderungen des Situationsbewusstseins
9.3.5 Risikokompensation, Vertrauen, Missbrauch
9.3.6 Erwerb und Verlust von Kompetenzen
9.4 Was sagt das Gesetz?
9.5 Zusammenfassung: Brauchen Fahrer Assistenz?
10 Verkehrseignung und Fahrerlaubnis: Schulung, Training, Diagnostik, Therapie
10.1 Fahren lernen – Erstausbildung in der Fahrschule
10.1.1 Lehr- und Lernziele aus psychologischer Sicht
10.1.2 Die Ausbildung in der Fahrschule und die Führerscheinprüfung
10.2 Die Fahrerlaubnis – der Führerschein
10.2.1 Ersterwerb
10.2.2 Verlust und Wiedererlangung der Fahrerlaubnis
10.2.3 Führerschein auf Probe – Begleitetes Fahren – Lehr-/Lernsoftware
10.3 Verkehrspsychologische Beratung und Therapie
10.4 Wer ist wann geeignet für den Verkehr?
Literatur
Stichwortverzeichnis
Geleitwort
1982 veröffentlichte D. Klebelsberg mit dem Band »Verkehrspsychologie« das erste umfassendere Lehrbuch dieses Teilgebiets der Angewandten Psychologie und gab der Verkehrspsychologie als Aufgabe mit auf den Weg: »Angewandte Psychologie muss aber nicht bloße Anwendung psychologischer Erkenntnisse bedeuten, sondern ist als Grundlagenforschung in bestimmten Lebensbereichen zu verstehen ... Die Verkehrspsychologie untersucht Grundformen des Verhaltens und Erlebens im Straßenverkehr sowie Möglichkeiten der Verwertung von Ergebnissen aus dieser Grundlagenforschung für Fragestellungen der Praxis.« (Klebelsberg, 1982, 10 f.). Jetzt, fast 30 Jahre später, haben wir wieder ein »Lehrbuch« auf dem Markt. Lehrbücher sollten sich dadurch auszeichnen, dass sie aus dem meist riesigen Stoff einer Disziplin die wesentlichen Dimensionen selektieren und deren Fülle auch noch verdichten. Braucht es nach so langer Zeit ein neues verkehrspsychologisches Lehrbuch? Die Frage ist sehr schnell mit Ja zu beantworten.
Zum einen ist es auch heute noch notwendig, der scientific community zu dokumentieren, dass Verkehrspsychologie psychologische Grundlagenforschung im Bereich der Mobilität darstellt1. Vor allem aber: Der Erhalt der Mobilität ist eine der großen Aufgaben der Zukunft. Mobilität ist mehr denn je die Grundvoraussetzung für wirtschaftliches Wachstum. Und die Randbedingungen dafür werden immer schwieriger, kommen wir doch mehr und mehr in Konflikt mit der Forderung nach dem Schutz von Mensch und Umwelt bei gleichzeitig immer weiter steigendem Transportbedarf. Zum anderen ist Mobilität für das Individuum nichts anderes und nichts Geringeres als die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Hier liegen große Aufgaben vor uns: Der demografische Wandel wird in den nächsten 50 Jahren eine völlig veränderte Altersstruktur erzeugen, die uns zwingen wird, Menschen bis ins höchste Lebensalter hinein – auch individuell – mobil zu halten. Der Rückgang der Bevölkerung in der Fläche und die zunehmende Urbanisierung werden diese Aufgaben noch einmal drastisch erschweren2.
Die – hoffentlich – erfolgreiche Bewältigung dieser Zukunftsaufgabe ist die Aufgabe aller Disziplinen und in zunehmendem Maße auch der Psychologie. Was kann die Verkehrspsychologie beitragen? Sie hat eine lange Tradition in den Fragen der Fahreignung und deren Diagnostik. Bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts kam das Klientel der Verkehrspsychologie vor allem aus den Berufsfahrern und dem Militär. Der mit dem Wirtschaftswunder einhergehende explosionsartig ansteigende Individualverkehr zusammen mit dem wachsenden Güterverkehr führte zu dramatischen Konsequenzen: Im Jahr 1950 starben bei 0.26 Millionen Unfällen etwa 6 400 Menschen. Diese Zahl stieg bis in die 70er Jahre: 1970 waren es 19 000 Menschen bei 1.4 Millionen Unfällen. Die Zahlen von 2010: Die Unfallzahlen steigen weiter auf 2.5 Millionen, die Zahl der Toten liegt unter 4 000. Die Verkehrspsychologie kann behaupten, an dieser Eindämmung der negativen Konsequenzen der Mobilität erheblich mitgewirkt zu haben. Für die Bewältigung dieser Aufgabe konnte sie auf einen stetig wachsenden Korpus psychologischen Wissens in allen Teilgebieten der Psychologie zugreifen und daraus ihre Werkzeuge der Eignungsdiagnostik, ihre Konzeptionen von Nachschulung und Rehabilitation, ihre Zugänge zur Sicherheitskommunikation und zur Verkehrspädagogik entwickeln. Die kontinuierliche Weiterentwicklung dieser diagnostischen und therapeutischen Modelle ist eine bleibende Aufgabe der Verkehrspsychologie. Die Zukunft wird diesem Zweig der Verkehrspsychologie eine intensive Beschäftigung mit allen Fragen des Alterns abverlangen. Präzise diagnostische Modelle der Fahreignung und -tüchtigkeit sind gefragt. Aber anders als früher werden die Lösungsmöglichkeiten über den klassischen Bereich der psychologischen Intervention hinausgehen und eine intensive Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaften verlangen.
Bereits in der »Verkehrspsychologie« von Klebelsberg wird ein Anspruch aufgemacht, dass Verkehrspsychologie nicht nur im engeren Sinn als Diagnostik und Intervention zu verstehen ist, sondern dass alle Komponenten der Mobilität auf ihren psychologischen Anteil überprüft werden müssen. Die Ausstattung einer Straße mit Markierungen, die Veränderung einer Bremsleuchte, die Auswirkung einer Droge – überall dort, wo eine Auswirkung auf das Mobilitätsverhalten angestrebt oder wahrscheinlich ist, ist Verkehrspsychologie gefragt und meldet ihren Anspruch an. In überwältigender Weise erleben wir dies in der Entwicklung der letzten 25 Jahre, in denen sich ein Technologiesprung ohnegleichen vollzogen hat und sich immer schneller vollzieht. Wir stehen kurz vor der Möglichkeit, autonom zu fahren. Die Entwicklung von Informations-, Warn- und eingreifenden Assistenzsystemen ist in vollem Gange und verändert das Fahren dramatisch. Mit der Einführung von Car-to-car-Kommunikation und mit den neuen Möglichkeiten der Car-to-infrastructure-Kommunikation sind völlig neue Möglichkeiten der Verkehrssteuerung und der Beeinflussung der Fahrsicherheit gegeben. All dies wird dazu führen, dass Fahren zunehmend automatisiert wird – aber nicht automatisch, noch lange nicht – und die Verkehrspsychologie vor neue Probleme der Interaktion von Mensch und Automation stellt. Entsprechend dieser Entwicklungen wird der arbeitspsychologischergonomische Part der Verkehrspsychologie gegenüber ihrer diagnostisch-klinischen Ausrichtung immer wichtiger. Aus diesem arbeitspsychologischen Geist heraus ist das vorliegende Lehrbuch geschrieben und zeichnet damit ein facettenreiches Bild der aktuellen Forschungsfragen. Ist Aktualität für ein Lehrbuch wünschenswert, vor allem vor dem Hintergrund eines sehr schnellen Wandels der Forschungsfragen? Die Antwort der Autoren überzeugt: Ja, es ist zu verantworten, wenn an diesem aktuellen Stoff der Verkehrspsychologie gleichzeitig eine profunde Kenntnis der fachspezifischen Forschungsmethoden und eine klare inhaltliche Verankerung in der Kognitiven Psychologie vermittelt wird. Beide Ziele sind durchgängig erkenntlich. Damit hat, wer sich auf dieses Buch einlässt, auch die Möglichkeit, neue Erkenntnisse der Verkehrspsychologie zu verstehen und zu bewerten und darüber hinaus auch eigenständig empirisch zu arbeiten.
In diesem Sinne wünsche ich dem Buch Erfolg, verbunden mit der Hoffnung, die Autoren mögen sich auch um die ständige Aktualisierung kümmern.
Würzburg, August 2011
Hans-Peter Krüger
1 Siehe dazu Krüger, H.-P. (2009). Verkehrspsychologie im Spannungsfeld zwischen Grundlagen und Anwendung. Psychologische Rundschau, 60, 254 f.
2 Siehe zur Zukunft der Mobilität das »3. Verkehrsforschungsprogramm der Bundesregierung« (2008)
Vorwort
Der moderne Verkehr wird immer sicherer. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen, die sich für die Verkehrsteilnehmer stellen. Hohe Verkehrsdichten, komplexe städtische Umgebungen, überall verfügbare Informationstechnologien, intelligente Systeme in Fahrzeugen und automatisches Fahren sind einige Schlüsselthemen. Die Verkehrspsychologie hat mit Beiträgen zu diesen Themen in den letzten Jahrzehnten ihren Schwerpunkt verändert. Im Zentrum steht nicht mehr die Begutachtung von Fahrzeugführern hinsichtlich ihrer Fahreignung. Vielmehr versucht man, das System Fahrer–Fahrzeug–Umwelt zu verstehen. Dieses Lehrbuch vermittelt ein grundlegendes Verständnis des Fahrers im Verkehr und seiner Interaktion mit Informationssystemen und Fahrerassistenzsystemen. Und hoffentlich auch den Reiz, den dieses wachsende Gebiet auf Forscher und Anwender ausübt.
Dieses Lehrbuch wäre nicht entstanden ohne die Anregungen und kritischen Kommentare vieler Personen. Wir danken insbesondere Matthias Beggiato, Franziska Bühler, Julia Fofanova, Christhard Gelau, Matthias Henning, Anja Katharina Huemer, Jannette Maciej, Elke Muhrer, Ute Niederée, Tibor Petzoldt, Klaus Reinprecht, Diana Rösler, Fabian Utesch, Julia Werneke und Manfred Weinand und seinem Team bei der BASt. Mark Vollrath dankt außerdem Hans-Peter Krüger, der ihn zur Verkehrspsychologie gebracht hat, obwohl beide die Verkehrspsychologie am Anfang gar nicht so spannend fanden und Jutta, Ben und Leon, die das viele Schreiben geduldig ertragen haben (und das Buch vielleicht auch einmal lesen werden).
Braunschweig und Chemnitz, im August 2011 Mark Vollrath und Josef Krems
1 Was ist Verkehrspsychologie?
1.1
Verkehr und Psychologie
1.2
Was ist »Verkehrspsychologie«?
1.3
Geschichtliches
1.4
Zentrale Fragestellungen der Verkehrspsychologie
1.5
Berufsbild »Verkehrspsychologe« – Praxisfelder
1.5.1
Der Fahrer
1.5.2
Verkehrsmittelbezogene Anwendungsfelder
1.5.3
Gestaltung des Verkehrsumfeldes
1.6
Ausblick
1.7
Inhalt und Ziele des Lehrbuchs
1.1 Verkehr und Psychologie
Box 1.1: Aus den wilden Jahren der »Automobilisten«
Ein Pariser Bürger schrieb 1896 an den Polizeipräsidenten:
»Sehr geehrter Herr Polizeipräsident, gestern Abend um sechs Uhr bin ich auf der Rue de Courcelles mit meiner Frau und meinen Kindern fast von einem Herrn, der auf einem Automobil mit der Geschwindigkeit einer Lokomotive daher raste, überfahren worden. Ihn festzuhalten, war unmöglich. Der Polizist, an den ich mich wandte, … sagte mir: ›Mon dieu, Monsieur, wir sind ohnmächtig gegenüber diesen Leuten. Sie wissen genau, dass sie sich durch Flucht entziehen können.‹ … da Ihre Polizisten sich für ohnmächtig erklären, habe ich die Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass ich von heute ab mit einem Revolver in der Tasche ausgehen und auf den nächsten verrückten Hund schießen werde, der mit seinem Automobil die Flucht ergreift, nach dem er drauf und dran war, mich und die Meinen zu überfahren.«
(Brief eines Pariser Bürgers an den Polizeipräsidenten, zitiert aus Echterhoff, 1991, S. 12 f.)
Die individuelle Mobilität hat inzwischen enorme Ausmaße erreicht, mit einer Vielzahl von Vorzügen, aber auch mit gewaltigen Problemen: Der weltweite Bestand an Autos wird auf etwa 950 Millionen geschätzt und die Anzahl der Autofahrer auf mindestens 2 Milliarden, davon mehr als 40 Millionen in Deutschland! Alleine in Deutschland aber ereignen sich pro Jahr ungefähr 400 000 Unfälle mit Personenschäden. Diese Zahl hat sich in den letzten Jahren nur geringfügig vermindert, allerdings bei stark gestiegener Fahrleistung im gleichen Zeitraum. Die Anzahl der bei Verkehrsunfällen zu Tode gekommen Personen lag 2010 bei etwa 3700. Diese Zahl hat sich seit 1970 auf ungefähr ein Fünftel des damaligen Niveaus (19 100) reduziert (Statistisches Bundesamt, 2011). In Europa sind derzeit pro Jahr fast 40 000 Tote zu beklagen. Eine ähnliche Zahl gilt für die USA. Im Ganzen schätzt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Anzahl der Todesopfer auf ungefähr 1 Million pro Jahr. Mit insgesamt 25–30 Millionen getöteter Personen in den letzten 100 Jahren wird die Größenordnung von Weltkriegen erreicht.
Die bei weitem wichtigste Ursache für Unfälle mit Todesfolge sind Fehler, die von den Autofahrern selbst gemacht werden: Sie fahren zu schnell, berücksichtigen zu wenig die Straßenverhältnisse, sie fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen etc. Kurz: Sie verhalten sich in Verkehrssituationen unangemessen mit teilweise katastrophalen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen für die eigene Person und für andere Menschen.
Es ist angesichts des individuellen Leids nicht nur eine ethisch gebotene Notwendigkeit für die Angewandte Psychologie, sondern im Hinblick auf den gewaltigen volkswirtschaftlichen Schaden, der mit Unfällen verbunden ist, auch ökonomisch unabdingbar in der Auswahl und Ausbildung von Verkehrsteilnehmern, in der Gestaltung der Infrastruktur (z. B. Straßenzustand) und in der technischen Auslegung der Kraftfahrzeuge zur Vermeidung von Unfällen beizutragen. Bei der enormen sozialen und ökonomischen Bedeutung des technischen Großsystems »Verkehr« ist es deshalb nicht verwunderlich, dass die Verkehrspsychologie zu den wichtigsten Teilgebieten der Angewandten Psychologie zählt.
1.2 Was ist »Verkehrspsychologie«?
Die Verkehrspsychologie beschäftigt sich mit dem Erleben und Verhalten von Menschen in Verkehrs-, Transport- und Mobilitätssystemen und mit den zugrunde liegenden psychischen Prozessen. Neben dem individuellen Verhalten in Verkehrssituationen (z. B. Regulation der Geschwindigkeit in Abhängigkeit vom Straßenzustand und der Verkehrsdichte, Benutzung von Zebrastreifen durch Fußgänger) und dessen Zusammenhang mit Unfällen bzw. Gefahrensituationen gehören zur Verkehrspsychologie auch allgemeine Fragen zur Mobilität von Menschen (z. B. Wahl der Verkehrsmittel). Die Verkehrspsychologie beschäftigt sich auch mit der ergonomischen Gestaltung der Verkehrsmittel (z. B. Cockpits von Flugzeugen) und der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Radwege etc.). Ein wichtiges Teilgebiet ist die Berücksichtigung psychologischer Aspekte bei der Gestaltung von verkehrsnahen Arbeitsplätzen bzw. bei der Organisation von Arbeitstätigkeiten (z. B. Team-Ressource-Management bei Schiffs- oder Flugzeugbesatzungen, Pausenregelung bei Berufskraftfahrern). Obwohl der Straßenverkehr die wissenschaftliche Literatur bislang dominiert, beschäftigt sich die Verkehrspsychologie auch mit der Schifffahrt, dem Bahn- und Flugverkehr und seit Kurzem auch mit der Raumfahrt.
In modernen Gesellschaften ist die Verkehrsregelung eine staatliche Aufgabe. Dazu gehört die Ausbildung und Auswahl der Teilnehmer, die Führung und Markierung von Straßen, die Festlegung von Verkehrsregeln, das Erlassen von Vorschriften zum technischen Zustand von Fahrzeugen und die Überwachung des Verkehrsgeschehens. Diese Aspekte finden sich unmittelbar wieder in den wichtigsten Teilgebieten der Verkehrspsychologie: Fahreignung, Verkehrserziehung, Ergonomie und Gestaltung der Verkehrsumwelt.
Seit ihrer Gründung vor fast 100 Jahren ist die Verkehrspsychologie stark interdisziplinär ausgerichtet. Sie hat Berührungspunkte mit den Ingenieurwissenschaften (z. B. ergonomische Gestaltung von Fahrzeugen, Straßenbau), den Verkehrswissenschaften (z. B. Betriebskosten des Straßennetzes), der Medizin (z. B. Diagnostik, Rehabilitation), den Wirtschaftswissenschaften (z. B. Marketing) und auch mit den Rechtswissenschaften (z. B. Straßenverkehrsordnung).
Die Verkehrspsychologie verfügt über keinen einheitlichen theoretischen Rahmen. Es spielen unterschiedliche Konzepte und Befunde aus den Grundlagendisziplinen eine Rolle, insbesondere aus der Allgemeinen Psychologie (Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Kognition, Lernen, Motivation und Emotion), der Sozialpsychologie (Einstellung und Einstellungsänderung) und aus den Anwendungsfächern, besonders Diagnostik, Pädagogische Psychologie und Arbeits- und Ingenieurpsychologie. Eine aktuelle Übersicht über wichtige Anwendungsfelder findet sich bei Krüger (2009). Eine Einführung über den Bereich der Eignungsbegutachtung und Intervention geben Kranich, Kulka und Reschke (2008). Übersichten aus dem englischsprachigen Raum bieten Barjonet (2001), Groeger (2000) und Hole (2008).
1.3 Geschichtliches
Das Automobil und die Psychologie als Wissenschaft sind fast gleich alt und wurden beide in Deutschland erfunden. 1879 eröffnete Wilhelm Wundt in Leipzig das erste experimentalpsychologische Labor. Sieben Jahre später stellte Carl Benz in Schwaben das erste Automobil vor. Die neue Technik nahm eine grandiose Entwicklung. Bereits 1909 waren so viele »Automobilisten« unterwegs, dass eine rechtliche Regelung zur Erlangung der Fahrerlaubnis unerlässlich wurde. Es dauerte auch nicht lange, bis psychologische Analysen im rasant wachsenden Verkehrswesen (inklusive Eisenbahn und Straßenbahn) nötig schienen (in Italien bereits ab 1900, in Frankreich ab 1908).
Hugo Münsterberg, ein Wundt-Schüler, entwickelte um 1910 einen Berufseignungstest für Straßenbahnfahreranwärter. Wenige Jahre später wurden vom deutschen Militär systematisch Eignungsuntersuchungen für Kraftfahrer durchgeführt, die dann auch auf die Auswahl von Lokomotivführern und Straßenbahnfahrern ausgedehnt wurden. Einen ersten Fahrsimulator, der in der Auswahl von Militärkraftfahrern eingesetzt wurde, entwickelten ab 1915 in Deutschland Moede und Piorkowski. Ein wichtiger Meilenstein war das Jahr 1917, als in Dresden und Berlin psychotechnische Laboratorien durch die Eisenbahn-Generaldirektion bzw. die lokalen Behörden eingerichtet und in Hamburg die Eignungsprüfung für Straßenbahnfahrer durch William Stern eingeführt wurde. In den 1920er Jahren wurden weitere Untersuchungseinrichtungen in den USA und in vielen europäischen Ländern aufgebaut. Es wurden Methoden für die Auswahl und Schulung von Personal entwickelt. Dazu gehörte die »Wirklichkeitsprobe« von Poppelreuter (1929), ein Verfahren, das uns heute als Fahrstudie vertraut ist. Die Angewandte Psychologie hatte sich damit ein weites Feld der Diagnostik erschlossen, das bis heute erhalten geblieben ist.
Das erste umfangreiche Handbuch zur Verkehrspsychologie wurde mit starker Fokussierung auf die Eignungsprüfung 1925 von Giese publiziert. Etwa zur selben Zeit wurde die Deutsche Verkehrswacht gegründet, die sich insbesondere um die Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Information und Fahrerausbildung bemühen sollte. Damit war die Verkehrserziehung geboren, ebenfalls ein Anwendungsgebiet, in dem Verkehrspsychologen tätig wurden und nach wie vor tätig sind. Auch das Problem von Alkoholfahrten und die Nachschulung auffällig gewordener Kraftfahrer haben ihre Wurzeln bereits in den späten 1920er Jahren.
Der Bedarf an Verkehrspsychologie blieb vor und während des Zweiten Weltkriegs hoch: Neben der Auswahl von Personen (z. B. Piloten) in der Eignungsdiagnostik wurden Psychologen mehr und mehr auch in der Gestaltung technischer Systeme herangezogen (z. B. Anzeigen in Cockpits). Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Bedeutung der Verkehrspsychologie durch die gewaltigen Veränderungen im Mobilitätsverhalten und durch die rasante Entwicklung der Verkehrssysteme weiter verstärkt. Die drastische Zunahme der Unfallopfer in den 1960er und 1970er Jahren machte ein Auswahlverfahren nötig, das es erlaubte, ungeeignete Verkehrsteilnehmer zu identifizieren. Dieses wurde Institutionen übertragen, die als »Medizinisch-Psychologische Untersuchungsstellen (MPU)«, seit 2000 »Begutachtungsstellen für Fahreignung« genannt, amtlich anerkannt waren bzw. sind. Seit wenigen Jahren ist die Verkehrspsychologie im Straßenverkehrs-Gesetz verankert. Im universitären Kontext ist die Verkehrspsychologie unter anderem mit Lehrstühlen an den Technischen Universitäten Dresden und Braunschweig verankert. An einer ganzen Reihe von Universitäten finden sich Forschungsgruppen, die verkehrspsychologische Fragestellungen bearbeiten und auch in der Lehre entsprechende Inhalte berücksichtigen. Weitere Details zur Geschichte der Verkehrspsychologie finden sich in Echterhoff (1991) und Häcker und Echterhoff (1999). Möser (2002) bietet einen Überblick über die Geschichte des Automobils.
1.4 Zentrale Fragestellungen der Verkehrspsychologie
Die wichtigsten Teilgebiete der Verkehrspsychologie sind:
Fahrerverhalten, Fahrerfehler und Unfälle:
In diesem Gebiet wird versucht, das Verhalten von Verkehrsteilnehmern möglichst präzise zu beschreiben, zu erklären und vorherzusagen. Wie wählen Fahrer z. B. ihre aktuelle Geschwindigkeit und welchen Abstand halten sie zu vorausfahrenden Fahrzeugen? Inwieweit hängt dies von der Verkehrsumwelt (Straßenzustand, Licht, usw.) ab? Welche Rolle spielen dabei Fahrereigenschaften wie z. B. die Risikofreudigkeit? Sind der Zustand (Müdigkeit) und aktuelle Ziele (Zeitdruck) wichtig? Welche Faktoren sind bei Unfällen entscheidend? Je besser man das Fahrerverhalten erklären kann, umso besser kann man Fahrer schulen, informieren, die Straße gestalten oder auch den Fahrer durch Assistenzsysteme beim Fahren unterstützen. Dabei sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
Allgemeine Handlungs- und Fehlermodelle: Die Grundlage für ein entsprechendes Verständnis liefern allgemeine Handlungsmodelle des Menschen, die auf das Fahren übertragen werden. Diese Fahrermodelle beschreiben beispielsweise, wie Fahrer Geschwindigkeit und Abstand wählen. Insbesondere durch die Unfallforschung wurde zusätzlich eine Vielzahl von Ansätzen entwickelt, um zu erklären, unter welchen Umständen Menschen Fehler begehen, die dann zu Unfällen führen. Diese Fehlermodelle sind ein zweiter grundlegender Schwerpunkt.
Persönlichkeitseigenschaften, Alter und Fahrerfahrung: Die Verkehrspsychologie hat sich lange mit der Frage beschäftigt, ob es den typischen »Unfäller« gibt, also Personen, die in besonderer Weise dazu prädestiniert sind, in Unfälle verwickelt zu werden. So plausibel es auf den ersten Blick erscheint, dass es eine entsprechende Unfalldisposition geben könnte, in empirischen Untersuchungen konnte ein stichhaltiger Beleg bislang nicht gefunden werden (vgl. Hoyos, 1982). Eine andere Frage ist, ob bestimmte Persönlichkeitsmerkmale mit Fahrerverhalten zusammenhängen, beispielsweise ob überdurchschnittlich intelligente, gewissenhafte oder emotional gefestigte Personen sicherer und weniger riskant fahren. Hier gibt es einige Hinweise, dass entsprechende Eigenschaften (z. B. Sensation Seeking – Risikobereitschaft) eine Rolle spielen. Wesentlich deutlichere Zusammenhänge zeigen sich jedoch mit zwei anderen Aspekten, die mit der Person des Fahrers zusammenhängen. Die Fähigkeit, ein Fahrzeug sicher im Verkehr bewegen zu können, hängt in hohem Maße von der Erfahrung und der psychischen und physischen Leistungsfähigkeit ab. Die Leistungsfähigkeit ist im Alter zwischen 18 und 25 Jahren sehr hoch. Gleichwohl besitzen Fahrer in dieser Lebensspanne ein deutlich erhöhtes Unfallrisiko. Die jungen, unerfahrenen Fahrer bilden die besonders gefährdete Altersgruppe. Offenkundig kann der Vorteil in der Leistungsfähigkeit die mangelnde Erfahrung und wohl auch die höhere Risikobereitschaft nicht kompensieren. Aber auch bei älteren Verkehrsteilnehmern ist ein spezifisches Unfallprofil zu beobachten, das möglicherweise auf eine reduzierte Leistungsfähigkeit zurückgeht, die nur teilweise durch langjährige Erfahrung bzw. durch Strategien (z. B. Fahren nur bei vergleichsweise geringer Verkehrsdichte) kompensiert werden kann.
Besondere Gruppen im Verkehr: Es ist bezeichnend für unsere Gesellschaft und Mobilitätskultur, dass bei »Verkehr« immer zuerst an »Autofahren« gedacht wird. Die meisten Wege legt man trotz der extrem hohen Auto-Mobilität dennoch als Fußgänger zurück. Auch Fahrräder werden glücklicherweise immer häufiger genutzt. Unter Umweltgesichtspunkten wäre auch eine bessere Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel wünschenswert. Und schließlich: Für viele Fahrer ist das Fahren nicht Mittel zum Zweck, sondern Beruf. Diese unterschiedlichen Gruppen bringen für die Verkehrspsychologie ganz eigene Fragestellungen mit sich, die zum Teil mit der Frage nach bestimmten Personengruppen verbunden sind (z. B. Fahrradfahren bei Kindern und Jugendlichen).
Fahrerzustand: Unter diesem Stichwort werden aktuelle, sich vergleichsweise schnell ändernde Eigenschaften des Fahrers untersucht, die unmittelbare Auswirkungen auf sein Fahrverhalten haben. Wichtige Einflussgrößen sind: Ermüdung oder Erschöpfung, physische Beeinträchtigung (z. B. Krankheit), Überforderung und natürlich Medikamente, Drogen und Alkohol. Unmittelbare Konsequenz der wissenschaftlichen Analyse dieser Zusammenhänge sind juristische oder technische Maßnahmen. Diese reichen von der Festlegung von Grenzwerten (Wie viel Alkohol im Blut gilt als unbedenklich?) über valide und möglichst einfach durchzuführende Testverfahren (»ins Röhrchen blasen«) bis hin zu technischen Systemen, die kritische Fahrerzustände automatisch erkennen und gegebenenfalls warnen. Ein Beispiel dafür sind Müdigkeitswarnsysteme, die bereits käuflich erworben werden können.
Ausbildung, Aufklärung und Verhaltensformung:
Dieser Bereich hängt unmittelbar mit dem ersten zusammen. Es geht um »Verkehrserziehung«, bei der verschiedene pädagogische Methoden eingesetzt werden, um ein Verhalten zu erreichen, das zur Unfallvermeidung beiträgt und die Verkehrssicherheit erhöht. Hierzu gehören die schulische und außerschulische Aufklärungsarbeit durch Behörden (z. B. Polizei), Kampagnen in den Medien und Informationstafeln an den Autobahnen (durch die Deutsche Verkehrswacht). Als Interventionsstrategien werden häufig die 4 E’s genannt: Enforcement (Gebote und Verbote), Education (Ausbildung, Aufklärung, Information), Engineering (nutzergerechte Gestaltung von Verkehrsmitteln und Verkehrswegen) und Encouragement (Anreizsysteme).
Fahreignungsdiagnostik, Beratung, Nachschulung und Rehabilitation:
Im Mittelpunkt dieses Teilgebiets steht der auffällige Kraftfahrer. Die Diagnose der Fahreignung mit dem Ziel, Personen zu identifizieren, die zur Führung eines Fahrzeugs nicht geeignet sind, ist wahrscheinlich das älteste Teilgebiet der Verkehrspsychologie. Inzwischen wurde eine Reihe von standardisierten Verfahren entwickelt, die in der Beurteilung der Fahreignung zum Einsatz kommen. Neben der Fahreignung sind Fahrtüchtigkeit und Fahrtauglichkeit wesentliche Komponenten. Während die Fahreignung die allgemeine Fähigkeit umfasst, ein Fahrzeug gemäß geltender gesetzlicher Bestimmungen zu führen, betrifft die Fahrtüchtigkeit eher den momentanen Zustand des Fahrers. Dieser kann durch Alkoholisierung, hochgradige Ermüdung, psychische Störungen etc. ein risikofreies Fahren ausschließen. Fahrtauglichkeit schließlich bezeichnet die physisch-körperlichen Voraussetzungen (z. B. Sehvermögen), die gegeben sein müssen, um als Fahrer am Verkehr teilnehmen zu können. Eine Zusammenfassung der Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahrereignung wurde von einem Beirat für Verkehrsmedizin beim Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen und beim Bundesministerium für Gesundheit veröffentlicht (Gemeinsamer Beirat für Verkehrsmedizin, 2000; für eine Fortschreibung s. Gräcmann & Albrecht, 2010). Wenn die Fahreignung fraglich erscheint oder in Frage gestellt wurde, geht es darum, diese wieder herzustellen. Ganz praktisch geht es darum, wie man möglichst effektiv Maßnahmen zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis gestaltet nach Fahrten unter Drogen- oder Alkoholeinfluss oder nach anderen massiven oder wiederholten Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung.
Ingenieurpsychologische Aspekte – Gestaltung der Fahrer-Fahrzeug-Interaktion und der Fahrumgebung:
Bei diesem Teilgebiet steht die nutzergerechte Gestaltung des Fahrzeugs und der Fahrumgebung im Mittelpunkt. Die Schnittstelle des Mensch-Maschine-Systems Fahrer–Fahrzeug ist so auszulegen, dass Personen mit möglichst geringem Aufwand das Fahrzeug möglichst effizient und fehlerfrei bedienen und ohne Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer bewegen können. Dies betrifft zunächst anatomisch-physiologische Aspekte, etwa in der Anordnung von Instrumenten im Greifraum (inklusive der Möglichkeiten, individuelle Einstellungen vorzunehmen, beispielsweise in der Veränderung der Sitzposition), oder in den Kräften, die eingesetzt werden müssen, um bestimmte Funktionen (z. B. Bremsen) auszuführen. Insbesondere wahrnehmungspsychologische Aspekte sind von zentraler Bedeutung, etwa in der Gestaltung von Anzeigen. Hierzu liegen inzwischen Normen und Designvorgaben vor. So findet sich im Europäischen Grundsatzkatalog zur Mensch-Maschine-Schnittstelle (Europäische Kommission, 2000, S. 4) der folgende Grundsatz: »Optische Informationen müssen vom Fahrer mit wenigen kurzen Blicken erfasst werden können, ohne dass das Führen des Fahrzeugs dadurch beeinträchtigt wird.« Die ergonomische Gestaltung von Fahrzeugen hat ein hohes Niveau erreicht. Beispielsweise wird bei vielen Bedienelementen inzwischen das Prinzip der Funktions- und Richtungskompatibilität eingehalten (etwa Fensterheber, die bei Druck des Schalters die Fenster nach unten bewegen und sie bei Zug wieder nach oben heben). Neue Fragestellungen entstehen mit der zunehmenden Einführung von Fahrerassistenz- und -informationssystemen. Zu den Informationssystemen gehören beispielsweise Navigationssysteme, die einerseits den Fahrer bei der Routenplanung und Zielfindung entlasten, andererseits aber eine zusätzliche Quelle der mentalen Belastung und Ablenkung während des Fahrens darstellen. Wesentlich grundlegendere Veränderungen entstehen durch Fahrerassistenzsysteme. Ein Beispiel ist ACC (Adaptive Cruise Control), ein Assistenzsystem, das die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit vorausfahrender Fahrzeuge aktiv reguliert. Dieses wird inzwischen von einer Reihe von Herstellern als Sonderausstattung angeboten. Das System entlastet den Fahrer vor allem auf Autobahnen oder Landstraßen erheblich bei der Geschwindigkeitskontrolle. Dies kann aber dazu führen, dass er kaum mehr in das Geschehen eingreifen muss, dadurch evtl. dazu verleitet wird, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen und in kritischen Situationen möglicherweise nicht mehr Herr der Lage ist. Eine zentrale verkehrspsychologische Herausforderung wird sein, diese Systeme so zu gestalten, dass die gewünschten positiven Wirkungen (Entlastung, vielleicht sogar Vermeidung von Fehlern) erreicht werden, aber keine neuen negativen Wirkungen (z. B. zu starkes Vertrauen in das System, Ablenkung vom Fahren) entstehen. Schließlich sollte nicht vergessen werden, dass das sichere Fahren wesentlich von der Verkehrsumwelt abhängt, in der sich der Fahrer mit seinem Fahrzeug bewegt. Je nach Straßentyp (Autobahn, Landstraße, städtischer Bereich) sind die Anforderungen an den Fahrer unterschiedlich. Dabei spielt die Gestaltung der Straßen (z. B. Anzahl der Fahrstreifen) und Knotenpunkte (z. B. Ampelregelungen, rechts vor links) eine wichtige Rolle. Die Art (PKW, LKW, Fußgänger, Radfahrer) und die Menge der anderen Verkehrsteilnehmer führen ebenfalls zu einer unterschiedlichen Beanspruchung des Fahrers. Das psychologische Wissen über Informationsverarbeitungsprozesse und Handlungssteuerung des Fahrers kann bei der Gestaltung der Verkehrsumwelt entsprechend genutzt werden. So wird beispielsweise bei den Richtlinien für Straßengestaltung der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) als allgemeines Prinzip gefordert, dass der Fahrraum nach den Regeln der Gestaltpsychologie als optisches Reizmuster zu gestalten ist. In den Richtlinien wird weiter darauf hingewiesen, dass die subjektive Wahrnehmung durch die Verkehrsteilnehmer eine ganz wesentliche Größe ist, die berücksichtigt werden muss. Aktuell wird das Konzept der »Selbsterklärenden Straßen« verfolgt. Dabei wird versucht, z. B. eine Straße so zu gestalten, dass der Fahrer automatisch eine sichere Geschwindigkeit einhält. Die Straße »fordert dazu auf«, entsprechend langsam zu fahren. Für diese Ansätze ist das Wissen um kognitionspsychologische Grundlagen (Punkt 1) ganz wesentlich – von welchen Faktoren hängt zum Beispiel die Geschwindigkeitswahl ab?
Mobilität – Verkehrsplanung:
Dieses vergleichsweise junge Teilgebiet gewinnt zunehmend an Bedeutung. Es geht um sehr grundsätzliche Fragen der Mobilität in modernen Lebensformen (z. B. arbeitsplatzbedingtes Pendeln zwischen Umland und städtischen Zentren, Schul- und Ausbildungswege, Ortsveränderung bei Urlaubs- und Privatreisen etc.). Darauf bauen Ansätze zur Steuerung des Mobilitätsverhaltens auf, beispielsweise zur Wahl ökologisch besonders geeigneter Verkehrsmittel. Auch die Integration von Systemkomponenten ist zu einem zunehmend wichtigen Thema geworden. Beispielsweise könnte die Verknüpfung der in ein Navigationssystem eingegebenen Reiseziele mit einem Vergabesystem, das Parkflächen zuweist, zu einer Verringerung des Parksuchverkehrs und damit zu verkürzten Fahrzeiten und weniger Kraftstoffverbrauch führen. Auch Fragen, wie man neue Formen der Mobilität (z. B. Elektrofahrzeuge) gestalten muss, damit sie von Fahrern akzeptiert und genutzt werden, werden in Zukunft sicherlich immer wichtiger.
1.5 Berufsbild »Verkehrspsychologe« – Praxisfelder
Box 1.2: Rechtliche Grundlagen
Im Straßenverkehrsgesetz heißt es im § 4, Absatz 9: In der verkehrspsychologischen Beratung soll der Fahrerlaubnisinhaber veranlasst werden, Mängel in seiner Einstellung zum Straßenverkehr und im verkehrssicheren Verhalten zu erkennen und die Bereitschaft zu entwickeln, diese Mängel abzubauen. … Die Beratung darf nur von einer Person durchgeführt werden, die hierfür amtlich anerkannt ist und folgende Voraussetzungen erfüllt:
Persönliche ZuverlässigkeitAbschluss eines Hochschulstudiums als Diplom-PsychologeNachweis einer Ausbildung und von Erfahrungen in der Verkehrspsychologie nach näherer Bestimmung durch RechtsverordnungGenauere Festlegungen sind in der Fahrerlaubnis-Verordnung in der Fassung vom 01.09.2009 im § 71 enthalten:
Für die Durchführung der verkehrspsychologischen Beratung nach § 4 Abs. 9 des Straßenverkehrsgesetzes gelten die Personen im Sinne dieser Vorschrift als amtlich anerkannt, die eine Bestätigung nach Abs. 2 der Sektion Verkehrspsychologie im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e. V. besitzen.Die Sektion Verkehrspsychologie im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e. V. hat die Bestätigung auszustellen, wenn der Berater folgende Voraussetzungen nachweist:Abschluss eines Hochschulstudiums als Diplom-Psychologe oder eines gleichwertigen Master-Abschlusses in Psychologie,eine verkehrspsychologische Ausbildung an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule oder einer Stelle, die sich mit der Begutachtung oder Wiederherstellung der Kraftfahreignung befasst, oder an einem Ausbildungsseminar, das vom Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e. V. veranstaltet wird,Erfahrungen in der Verkehrspsychologie…Teilnahme an einem vom Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e. V. anerkannten Qualitätssicherungssystem, soweit der Berater nicht bereits in ein anderes, vergleichbares Qualitätssicherungssystem einbezogen ist…Der Berater hat der Sektion Verkehrspsychologie des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen e. V. alle zwei Jahre eine Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an der Qualitätssicherung vorzulegen.Neben den psychologischen Psychotherapeuten sind die Verkehrspsychologen derzeit die einzige Berufsgruppe aus der Psychologie, die im Gesetz verankert ist (s. Box 1.2). Unabdingbare Voraussetzung für die berufliche Tätigkeit ist der Diplom- oder Master-Abschluss in Psychologie und eine fachpsychologische Zusatzausbildung, die im Wesentlichen vom Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e. V. (BDP) geregelt wird. Die Sektion Verkehrspsychologie des BDP umfasst derzeit ca. 400 Mitglieder. Den Titel »Fachpsychologe Verkehrspsychologie« haben aktuell ca. 600 Psychologen erworben. Beruflich tätig sind aber sicherlich deutlich mehr Psychologen in dem gesamten Bereich der Verkehrspsychologie. Davon sind die meisten im Automobil- bzw. Straßenverkehrsbereich beschäftigt.
Aber auch die Flugpsychologie, die eine lange Tradition besitzt, ist nach wie vor ein wichtiges Arbeitsgebiet für Verkehrspsychologen. Sowohl in der militärischen als auch in der zivilen Luftfahrt (Fluglinien und Flugsicherung) sind Psychologen im Einsatz. Die drei wichtigsten Einsatzgebiete sind:
Personalauswahl:
Psychologisches Knowhow spielt in Eignungsprüfungen für Piloten und Fluglotsen eine sehr wichtige Rolle. Dabei sind Psychologen nicht nur unmittelbar im diagnostischen Prozess tätig, sondern sie wirken auch an der Erstellung von Verfahren (Testbatterien) federführend mit. Entsprechende Einrichtungen werden in Deutschland vom DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.), der DSF (Deutsche Flugsicherung, Langen) und von den Fluglinien (Lufthansa-Ausbildungscenter, Hamburg) betrieben.
Team-Ressource-Management bzw. Crew-Ressource-Management:
Darunter sind Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung und auch der Personalentwicklung zusammengefasst. Es geht dabei um Trainingsverfahren, in denen die Kooperation in Teams, die Optimierung der Nutzung von technischen Komponenten u. ä. trainiert werden.
Kriseninterventionsmaßnahmen:
Dazu zählen Programme und Maßnahmen, die für Personen angeboten werden, die massiven Konflikt- oder Krisensituationen ausgesetzt waren (z. B. Kampfeinsätze, Unfälle).
Im Automobil- bzw. Straßenverkehrsbereich sind drei wichtige Praxisfelder zu nennen:
Der Fahrer – der Mensch als Verkehrsteilnehmer (Auswahl, Schulung, Verkehrserziehung, Rehabilitation etc.),
das Verkehrsmittel (z. B. Ergonomie und Design des Fahrzeugs, Informations- und Assistenzsysteme),
die Umgebung (z. B. Straßenbau, Verkehrsleitsysteme).
Der konkrete Berufsalltag zeigt, dass es sich bei diesen Anwendungsfeldern nicht um klar getrennte Bereiche handelt, sondern dass an vielen Arbeitsstellen einzelne Aufgaben häufig miteinander verknüpft vorkommen. Diese drei Bereiche werden im Folgenden kurz im Überblick dargestellt.
1.5.1 Der Fahrer
In diesem Bereich finden sich vier Schwerpunkte der Berufstätigkeit:
Fahreignungsdiagnostik:
Die Begutachtung der Fahreignung nach Auffälligkeiten ist wahrscheinlich das Anwendungsgebiet, in dem derzeit die meisten Arbeitsstellen (hauptsächlich beim TÜV bzw. DEKRA) für Verkehrspsychologen vorhanden sind. Psychologen sind dabei in erster Linie bei der Negativauslese beteiligt: Das Hauptklientel sind Trunkenheits- und Punktetäter, die sich an die Behörde wenden. Nach Entzug der Fahrerlaubnis bzw. nach massiver Auffälligkeit im Verkehr wollen sie nachweisen, dass sie ein Kraftfahrzeug (wieder) führen können. Im Jahr 1995 mussten sich ca. 150 000 Personen einer Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) unterziehen. Diese Zahl nahm bis 2002 auf etwa 120 000 ab, steigt seither aber wieder an. Beim erstmaligen Erwerb der Fahrerlaubnis (Fahrschulen) sind Psychologen in der Regel nicht beteiligt, außer bei Problemfällen (z. B. mehrmaliges Versagen in der Fahrprüfung).
Klinische Verkehrspsychologie:
Hierbei geht es hauptsächlich um die »Nachschulung« verkehrsauffälliger Kraftfahrer in Rehabilitationsmaßnahmen. In Einzel- und Gruppengesprächen wird versucht, eine Verhaltensänderung zu bewirken. Diese Maßnahmen werden besonders bei alkoholauffälligen Kraftfahrern, bei Drogenkonsumenten und auch bei besonders risikofreudigen und wiederholt rücksichtslosen Verkehrsteilnehmern (»Punktesünder«), meistens aufgrund gerichtlicher Auflagen, durchgeführt. Ein zunehmend wichtiges Klientel bilden Personen, deren Fahrtauglichkeit nach Unfällen oder Krankheit geprüft werden muss. Damit sind häufig auch Empfehlungen zu Rehabilitationsmaßnahmen verbunden. Das Arbeitsgebiet Klinische Verkehrspsychologie hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen, da die Dienstleistung nicht ohne Weiteres von kassenfinanzierten Psychotherapeuten erbracht werden kann (die Wiederherstellung der Fahreignung gehört nicht zum Leistungsumfang des Gesundheitswesens).
Verkehrserziehung:
Ziel der »Pädagogischen Verkehrspsychologie« ist die Veränderung des Verhaltens von Verkehrsteilnehmern, um Unfälle zu verhindern und die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Es geht um das Erlernen adäquater verkehrsbezogener Verhaltensweisen, etwa um »vorausschauendes Fahren«. Eine wichtige Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche (wie werden Gefahrensituationen altersspezifisch wahrgenommen?). Aber auch die lernpsychologische Optimierung der Fahrausbildung gehört in diesen Bereich. Zur »Verkehrserziehung« tragen auch Aktionen in den Massenmedien (z. B. Inserate in Zeitungen zur Gefahr von Trunkenheitsfahrten), Informationsschilder an Autobahnen (z. B. zur Anpassung der Geschwindigkeit) oder Aktionen in Schulen (z. B. zum Verhalten auf dem Schulweg) bei. Immer wichtiger werden in diesem Zusammenhang aber auch umweltpolitische Ziele wie die Vermeidung unnötiger Fahrten und ein kraftstoffsparendes Fahrverhalten.
Verkehrspsychologische Forschung:
Dieses Berufsfeld ist sicherlich das kleinste der vier beschriebenen Berufsfelder. An Universitäten, an Forschungseinrichtungen (z. B. Bundesanstalt für Straßenwesen, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), bei Verbänden (z. B. Deutscher Verkehrssicherheitsrat DVR, ADAC), bei Versicherungen und nicht zuletzt bei Kraftfahrzeugherstellern und -zulieferern sind Verkehrspsychologen in der Forschung tätig, um wie oben beschrieben die Grundlagen für die Gestaltung von Fahrzeugen und der Verkehrsumwelt zu erarbeiten. In der verkehrspsychologischen Forschung steht der Fahrer im Vordergrund. Wenn man versteht, warum bestimmte Fahrer sich in bestimmten Situationen in einer bestimmten Weise verhalten und möglicherweise Fehler begehen, kann dieses Wissen einerseits in den beschriebenen Anwendungsfeldern genutzt werden, andererseits aber auch für die Gestaltung von Fahrzeugen und der Verkehrsumwelt eingesetzt werden.
1.5.2 Verkehrsmittel-bezogene Anwendungsfelder
Fahren kann als Arbeit und das Fahrzeug als Arbeitsplatz betrachtet werden. Dies gilt jedenfalls für Berufskraftfahrer. Aber auch bei Fahrten, die nicht unmittelbar im Kontext von Arbeitstätigkeit stattfinden, ist eine ergonomisch möglichst günstige Gestaltung des »Cockpits« offensichtlich wünschenswert. Eine ergonomisch optimierte Gestaltung soll bei hohem Komfort eine möglichst beanspruchungsarme und damit sichere und situationsangepasste Bedienung ermöglichen. Neben physiologisch-anatomischen Erkenntnissen (z. B. Sitzgestaltung) sind in diesem Zusammenhang psychologische Forschungsergebnisse zur Wahrnehmung (z. B. Gestaltung von Anzeigen), zur Motorik (z. B. Gestaltung von Bedienelementen) und zur Aufmerksamkeitssteuerung relevant. Neue Anforderungen entstehen durch Systeme, die durch natürlich-sprachliche Ein- und Ausgaben oder durch Gesten gesteuert werden. In Zukunft wird sich die Fahraufgabe grundlegend ändern, wenn immer mehr Teile des Fahrens durch Fahrerassistenzsysteme unterstützt oder sogar übernommen werden. Automatisches Fahren erscheint zumindest für bestimmte Szenarien (z. B. auf der Autobahn) nicht mehr unrealistisch. Hier liegen neue Herausforderungen für die Verkehrspsychologie – nämlich bei der Gestaltung dieser Systeme mitzuwirken, so dass sie von Menschen beherrschbar sind und Komfort und Sicherheit verbessert werden. Inzwischen haben sich Psychologen in den Entwicklungsteams der Automobilhersteller und der Zulieferer fest etabliert. Nach unserer Überzeugung wird ihre Bedeutung in den nächsten Jahren noch wachsen.
1.5.3 Gestaltung des Verkehrsumfeldes
Das Verhalten von Verkehrsteilnehmern wird neben den individuellen Fertigkeiten (Ausbildung und Erfahrung) und den Eigenschaften des Verkehrsmittels (Sportwagen versus Kleinwagen) erheblich von der Gestaltung des Verkehrsumfeldes beeinflusst. Hier ist eine Vielzahl von relevanten Faktoren zu nennen: Breite der Straße, Straßenverlauf, Knotenpunkte, die Ortslage (in Städten, auf Landstraßen und Autobahnen), Markierungen, Oberflächenbeschaffenheit etc. Diese Elemente können die Orientierung und Bahnführung erleichtern (z. B. Straßenbegrenzungspfosten). Sie können zu einem vorsichtigen, langsamen Fahren »auffordern« (z. B. durch Verengung der Fahrbahn oder durch Erhöhungen, »optische« Bremsen) und natürlich auch das Gegenteil bewirken. Beispielsweise kann eine breite, gut ausgebaute Straße den im Einzelfall falschen Eindruck des Vorfahrtrechts hervorrufen. Verkehrspsychologen arbeiten beim Entwurf von Straßen und der Diagnose sowie Umgestaltung von Unfallschwerpunkten mit. Gerade in der menschengerechten Gestaltung des Verkehrsumfeldes liegt ein weites, enorm wichtiges Praxisfeld.
1.6 Ausblick
In modernen Gesellschaften werden Fragen der Mobilität, der Nutzung und Gestaltung von Verkehrssystemen und der wirtschaftlichen und ökologischen Ressourcen, die dafür erforderlich sind, weiter an Bedeutung gewinnen. Der Individualverkehr ist trotz Wirtschaftskrise weiterhin auf einem gewaltigen Wachstumspfad. Das Automobil scheint auch zukünftig nicht nur der Deutschen liebstes Kind zu sein. Leider hat auch diese Medaille zwei Seiten: Einerseits die hohe individuelle Mobilität, ohne die moderne Gesellschaften offensichtlich nicht mehr auskommen; andererseits gewaltige ökologische (Umweltverschmutzung) und auch ökonomische (»Verkehrsinfarkt«) Belastungen, die zwangsläufig mit Personenverkehr verbunden erscheinen. Der simple Spruch »Freie Fahrt für freie Bürger«, der schon im letzten Jahrhundert nicht stimmte, wird die zukünftig erforderliche Einstellung zum Verkehrsverhalten nicht bestimmen können.
Die zukünftige Entwicklung wird neben den quantitativen auch qualitative Veränderungen umfassen. Dazu gehört die wachsende Bedeutung der Tertiärfunktionen in Verkehrssystemen. Am Beginn der Entwicklung der modernen Verkehrsmittel (Automobil, Eisenbahn, Flugzeug) im 19. Jahrhundert stand der Transport als Primärfunktion im Mittelpunkt. Diese wurde vor ca. 50 Jahren zunehmend durch Sekundärfunktionen (»Freude am Fahren«, Prestige usw.) ergänzt, die über die reine Transportaufgabe hinausgingen. Seit der Einführung von modernen Informations- und Assistenzsystemen vor etwa 20 Jahren wird das Funktionsspektrum um Aufgaben erweitert, die wir üblicherweise mit Büroarbeitsplätzen oder auch mit dem Freizeitbereich verbinden: Beispielsweise wird das Fahrzeug durch Ausstattung mit Fax, Telefon und Internet zunehmend zum mobilen Büro, in dem mit Kunden gesprochen wird, Bankgeschäfte erledigt werden und mit Mitarbeitern per Video konferiert wird. Auch der Einkauf von Waren des persönlichen Bedarfs (Mobile Commerce), das Reservieren von Hotelzimmern oder der Abruf von Wettervorhersagen aus dem Internet ist bei entsprechender Ausrüstung ohne weiteres auch während der Fahrt möglich.
1.7 Inhalt und Ziele des Lehrbuchs
Mit einer fast 100-jährigen Geschichte gehört die Verkehrspsychologie zu den ältesten Anwendungsgebieten der Psychologie. Angesichts steigender Mobilitätsbedürfnisse in modernen Gesellschaften ist anzunehmen, dass die Bedeutung der Verkehrspsychologie als Forschungsgebiet und als Berufsfeld weiter zunehmen wird. Dies gilt sowohl für Eignungsdiagnostik, Schulung, Rehabilitation als auch für Ergonomie, Design und für die öffentliche Meinungsbildung. Vor diesem Hintergrund ist es umso erstaunlicher, dass kein aktuelles deutschsprachiges Lehrbuch der Verkehrspsychologie existiert. Die Lehrbücher der 1970er bis 1990er Jahre können eine Vielzahl neuer Erkenntnisse und insbesondere technischer Entwicklungen nicht berücksichtigen (Echterhoff, 1991; Hoyos, 1982; Huguenin, 1988; Klebelsberg, 1982; Spoerer, 1979). Eine aktuelle Darstellung verschiedener Anwendungsfelder findet sich in einem Band der Enzyklopädie der Psychologie (Krüger, 2009). Eine eher stichwortartige Einführung für den Bereich der Fahreignung findet sich im Lehrbuch von Kranich, Kulka und Reschke (2008). Außerdem liegt eine Reihe von Sammelwerken vor, in denen aktuelle Forschungsarbeiten berichtet werden (z. B. Schade & Engeln, 2008; Schlag, 2004). Ein aktuelles Lehrbuch der Verkehrspsychologie fehlt damit im deutschsprachigen Raum.
Das vorliegende Buch will diese Lücke schließen. Es soll ein Überblick gegeben werden über die wesentlichen Inhalte der Verkehrspsychologie. Einem Lehrbuch entsprechend steht nicht die Anwendung (Verkehrserziehung, Schulung, Eignungsdiagnostik, Rehabilitation) im Vordergrund. Vielmehr geht es uns darum, ein für die verschiedenen Gebiete der Verkehrspsychologie wichtiges psychologisches Grundwissen zu vermitteln. Das zweite Kapitel gibt deshalb zunächst einen Überblick, welche psychischen Prozesse beim sicheren Fahren beteiligt sind. Das dritte Kapitel beschäftigt sich damit, warum Fahrer manchmal nicht sicher fahren. Hier werden Theorien und Modelle von Fehlern und Unfällen im Verkehr dargestellt. Das vierte Kapitel zeigt die Methoden der Verkehrspsychologie auf, da diese die Grundlage der verkehrspsychologischen Forschung sind. In den folgenden Kapiteln werden dann die wichtigsten Einflussgrößen näher betrachtet. Kapitel 5 diskutiert den Einfluss von Alter und Fahrerfahrung. In Kapitel 6 werden unterschiedliche Arten der Verkehrsteilnahme (Fußgänger, Radfahrer) und besondere Umstände von Fahrten (private und berufliche Fahrten) beschrieben. Ein Überblick über die Auswirkungen verschiedener Fahrerzustände (Kap. 7) beschließt diesen Block.
In den folgenden beiden Kapiteln wird die Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug vor dem Hintergrund neuer technischer Entwicklungen für Informationssysteme (Kap. 8) und Assistenzsysteme (Kap. 9) dargestellt. Das Buch schließt mit einer kurzen Übersicht über den Bereich der Verkehrseignung und Schulung (Kap. 10).
Dem aufmerksamen Leser fällt auf, dass bestimmte oben genannte Themen nicht in diesem Lehrbuch vertreten sind. Der Bereich der psychologischen Mobilitätsforschung ist noch relativ jung, so dass es aktuell schwerfällt, hier einen grundlegenden Überblick zu geben. In späteren Auflagen ist dies sicherlich zu ergänzen. Das Lehrbuch beschränkt sich weiter auf den Straßenverkehr.
Beide Autoren sind seit Jahrzehnten in der verkehrspsychologischen Forschung im Bereich Straßenverkehr tätig und beide Autoren vermitteln im Rahmen der Diplom- bzw. aktuell der Bachelor- und Masterstudiengänge verkehrspsychologische Inhalte als integralen Baustein der psychologischen Ausbildung (in Braunschweig und Chemnitz). In der Forschung, aber auch in der Lehre lebt diese Ausrichtung ganz wesentlich von interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen Psychologen, Ingenieuren und Informatikern. Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung fehlt ein Lehrbuch, mit dem ein grundlegendes Verständnis psychologischer Prozesse und deren Anwendung im Verkehr vermittelt werden kann. Aus unserer Sicht ist es dabei entscheidend wichtig, diese Anwendung einerseits in einer soliden experimentalpsychologischen Methodik, andererseits in kognitionspsychologischen Ansätzen zu fundieren. Die wesentlichen Ziele des Lehrbuchs sind damit:
Die Vermittlung wesentlicher methodischer und kognitionspsychologischer Grundlagen, die für die Anwendung im Verkehr wichtig sind,
eine einfache und verständliche Darstellung, die auch Interessierten anderer Fachrichtung ein Grundverständnis verkehrspsychologischer Ansätze ermöglicht,
die Erarbeitung einer Grundlage für entsprechende verkehrspsychologische Lehrveranstaltungen.
Die wesentlichen verkehrspsychologischen Themen, die in diesem Lehrbuch behandelt werden, wurden oben bereits dargestellt. Für eine einfache und verständliche Darstellung wurde darauf verzichtet, jede Aussage mit einer Fülle wissenschaftlicher Untersuchungen zu belegen, wie es in Zeitschriftenartikeln oder anderen Sammelwerken (z. B. Krüger, 2009) üblich ist. Vielmehr wurde Wert darauf gelegt, wichtige Punkte durch eigene oder besonders interessante oder originelle Einzeluntersuchungen zu illustrieren. Diese sind in den einzelnen Kapiteln in eigenen Kästen zu finden. Diese Art der Darstellung führt natürlich dazu, dass eine Differenzierung und Vertiefung nur in beschränktem Maß möglich ist. Es handelt sich damit um einen Einstieg in die entsprechenden Themen. Wenn man in diesem Bereich selbst forschen möchte, bietet dies eine Grundlage, um sich über entsprechende Originalarbeiten schnell in das Thema einzuarbeiten. Diese vertiefte Einarbeitung bleibt die Aufgabe des Lesers.
Schließlich ist das Lehrbuch so angelegt, dass es als Basis einer Lehrveranstaltung verwendet werden kann. In Zukunft werden auch entsprechende Foliensätze vorbereitet, die Interessierten zur Verfügung gestellt werden können. Es ist auch geplant, weiterführende Literatur kontinuierlich zu ergänzen. Wir hoffen, dass auf diese Weise das Buch noch besser genutzt werden kann.
2 Fahren
2.1
Was muss der Fahrer tun? Die Fahraufgabe
2.2
Kognitive Prozesse
2.2.1
Fahren ist Sehen – visuelle Wahrnehmung und Aufmerksamkeit
2.2.2
Was ist hier eigentlich los? Das Situationsbewusstsein
2.2.3
Aktionsauswahl und -kontrolle
2.3
Menschen können sicher fahren – Zusammenfassung
Fahren ist eine komplexe Tätigkeit! Fahrer müssen ihr Gefährt auf Kurs halten, dürfen anderen Verkehrsteilnehmern nicht zu nahe kommen, müssen Verkehrszeichen erkennen und sich nach ihnen richten, die Straßenverhältnisse und das Wetter in ihrem Verhalten berücksichtigen, müssen Entscheidungen zu ihrer Fahrstrecke treffen und so weiter. Einen Eindruck davon, was man beim Fahren alles falsch machen kann, vermittelt die Liste der Beurteilungskriterien, die bei einer Fahrprüfung berücksichtigt wird. Sie umfasst ca. 60 unterschiedliche Kriterien (z. B. Kurvenfahren, Abstand vom Straßenrand, Bremsbereitschaft, Schaltvorgang, Überholen).
2.1 Was muss der Fahrer tun? Die Fahraufgabe
Die Teilaufgaben, die mit dem Fahren an sich zu tun haben (Spurhaltung, Abstandsregulierung, Navigation etc.), werden als primäre Fahraufgabe bezeichnet. In Fahrzeugen werden weitere Aufgaben erledigt, die Sekundäraufgaben genannt werden. Einige davon haben mit dem Fahren direkt zu tun. Dazu zählt der Blick in den Rückspiegel, das Ablesen von Verkehrsschildern oder auch die Kommunikation mit anderen Verkehrsteilnehmern etwa durch Betätigung des Blinkers. Auch die Eingabe einer Zieladresse bei einem Navigationssystem gehört dazu. Eine zweite Kategorie sekundärer Aufgaben umfasst Tätigkeiten, die nichts mit dem Fahren direkt zu tun haben. Dazu gehört beispielsweise die Kommunikation mit dem Beifahrer oder mit einem externen Gesprächspartner via Telefon. Auch die Bedienung des Radios oder Audio-Players, die Einstellung der Temperatur oder der Gebrauch des Zigarettenanzünders gehören dazu. Derartige Aufgaben, die nicht unmittelbar Teil der primären Fahraufgabe sind, diese sogar empfindlich stören können, entstanden in erster Linie durch die Ausweitung von Komfortfunktionen und die damit verbundenen Bedienanforderungen. Sie werden in der Klassifikation von Bubb (1993) als tertiäre Aufgaben bezeichnet. Auf diese sekundären bzw. tertiären Fahraufgaben und ihre Auswirkungen wird in Kapitel 8 ausführlicher eingegangen.
Technisch besteht die primäre Fahraufgabe aus der Vorgabe von Geschwindigkeit und Richtung zur Erreichung des Fahrziels unter Berücksichtigung der Verkehrsumgebung und weiterer Randbedingungen. Zu diesen gehören die Fahrzeugphysik und hier insbesondere die für die Fahrsicherheit entscheidende Beachtung des Reibwerts zwischen Reifen und Fahrbahn, der die maximal erreichbaren Beschleunigungen in Längs- und Querrichtung und somit die Manövrierfähigkeit des Fahrzeugs bestimmt. Ebenso dazu gehören die zur Verfügung stehenden Teilsysteme bzw. die Eigenschaften des benutzten Fahrzeugs, die Verkehrsregeln und die wirtschaftlichen Aspekte der Fahrzeugnutzung. Bei der Fahrzeugbedienung werden Querführung (d. h. Vorgabe des Spurverlaufs) und Längsführung (d. h. Vorgabe der Geschwindigkeit) unterschieden. Betrachtet man den Verlauf einer längeren Fahrt, kommen zu der eigentlichen Fahraufgabe noch Regulationsaufgaben im Zusammenhang mit den energetischen Prozessen wie Belastung/Beanspruchung und Ermüdung hinzu (s. Kap. 7). Als weitere Teilaufgaben, die sich aus den Randbedingungen der Fahraufgabe ergeben, können außerdem noch genannt werden: Kollisionen vermeiden, Verkehrszeichen überwachen, Verkehrsregeln einhalten, verbrauchseffizient fahren, geplante Fahrzeit einhalten und Fahrzeugsysteme überwachen.
Abb. 2.1: Das Drei-Ebenen-Modell des Fahrens (modifiziert und erweitert nach Michon, 1985)
In einer aufgabenanalytischen Beschreibung der primären Fahraufgabe wird häufig ein hierarchisch organisiertes Mehr-Ebenen-Modell herangezogen (s. Abb. 2.1): Michon (1985) – und ähnlich für die Flugzeugführung Bernotat (1970) – unterschied ursprünglich die strategische Ebene (Planung, Navigation), die Manöverebene (Anpassung an die aktuelle Verkehrssituation) und die Kontrollebene (Spurhaltung, Geschwindigkeitskontrolle). Inzwischen werden Navigation (Routenplanung, Streckenwahl etc.), Bahnführung (Geschwindigkeitswahl, Abstandsregulierung, Beachtung von Verkehrsvorschriften etc.) und Stabilisierung (Beschleunigen, Bremsen, Lenken etc.) als die typischen, hierarchisch gegliederten Anforderungsformen der Fahraufgabe genannt (vgl. Johannsen, Boller, Donges & Stein, 1977; Gstalter, 1988). Den aufgabenbedingten Anforderungen entsprechen fahrerseitig die Organisation, Koordination und Regelung als Aktivitäten (vgl. Hoyos, Fastenmeier & Gstalter, 1995). An der Schnittstelle zwischen der Stabilisierungsebene und dem Fahrzeug steht die Vorgabe von Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung des Fahrzeugs über die klassischen Bedienelemente Lenkrad, Gaspedal und Bremse. Interessant ist hier noch der charakteristische Zeitbedarf für die Aktionen auf den drei Ebenen.
In einem neueren Modell von Hollnagel und Woods (2005) werden vier Ebenen unterschieden (ECOM: Extended Control Model):
»Tracking« entspricht der Stabilisierungsebene
»Regulating« entspricht der Bahnführungsebene
»Monitoring« beinhaltet Überwachungsaktivitäten wie z. B. den Vergleich der aktuellen Geschwindigkeit des Fahrzeugs mit der gerade geltenden Geschwindigkeitsbegrenzung, aus denen sich dann Vorgaben für die Regulierungsebene ableiten
»Targeting« beinhaltet das globale Ziel der Fahrt und ist der Navigationsebene ähnlich
Aus verkehrspsychologischer Sicht ist festzustellen, dass diese »Fahrermodelle« keine Modelle der Informationsverarbeitungsprozesse des Menschen, des Fahrers sind. Vielmehr werden in diesen Modellen die verschiedenen Aufgaben beschrieben, die der Fahrer lösen muss. Die Modelle geben keine Antwort auf die Frage, wie der Fahrer dies tut. Eigentlich müsste man diese Modelle »Fahrmodelle« nennen. Sie sind von der technischen Seite her sehr hilfreich, um Ansatzpunkte für eine Unterstützung des Fahrers durch Informations- und Assistenzsysteme zu finden (s. Kap. 8 und 9). Die Modelle sind damit für die Funktionsdefinition dieser Systeme nützlich. Einen Überblick über diese und weitere Modellvorschläge findet man bei Cacciabue (2007).
2.2 Kognitive Prozesse
Betrachtet man die kognitiven Prozesse, die in der Fahrzeugführung wichtig sind, dann ist es zweckmäßig, die Stufen Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung und Aktionsausführung zu unterscheiden. Für die Fahraufgabe von entscheidender Bedeutung ist bei der Informationsaufnahme die Umweltwahrnehmung, die in erster Linie visuell erfolgt (vgl. Rockwell, 1988). Durch selektive Aufmerksamkeit wird aus den insgesamt verfügbaren Informationen jener Teilbereich ausgewählt, den die Person augenblicklich für besonders bedeutend hält (für eine detaillierte Darstellung der Informationsverarbeitungsprozesse s. Groeger, 2000). Mittels bottom-up- und top-downgesteuerter Prozesse wird aus der Integration von Umweltwahrnehmung, Zielen und dem Vorwissen einer Person ein mentales Modell der aktuellen Situation entwickelt (Situationsbewusstsein). Dieses Situationsmodell – die mentale Repräsentation der aktuellen Situation, eingeschlossen die eigene Person – steuert die weitere Informationsaufnahme und -verarbeitung. Es ist Grundlage für fahrrelevante Vorhersagen (»Wird der Lastwagen vor mir nach links ausscheren?«) und für Handlungspläne, in die auch die aktuellen Ziele (»Möglichst rasch eine Tankstelle finden«) eingehen. Daraus ergeben sich Entscheidungen zur Auswahl und Ausführung von Handlungen (»Jetzt nicht überholen, sondern auf der rechten Spur bleiben, um die Ausfahrt nicht zu übersehen«).
Bei der Handlungsausführung sind Bedienhandlungen, die direkt zur Fahrzeugführung beitragen (z. B. Betätigung von Lenkung, Gaspedal und Bremse), von Handlungen zu unterscheiden, die der Kommunikation dienen (z. B. Blinkerbetätigung). Sowohl für die Dauer der Informationsaufnahme (ein Verkehrsschild verstehen) als auch für die Dauer motorischer Reaktionen (bremsen) wurden in experimentellen Untersuchungen Durchschnittswerte und Streuungsmaße ermittelt. Aber wegen der enormen Bandbreite der Verkehrsteilnehmer (Alter, Erfahrung, Stressniveau etc.), der Verkehrssituationen (Autobahnfahrt, dichter innerstädtischer Verkehr, Alpenstraße etc.) und der Verkehrsmittel (Sportwagen, Kleinwagen etc.) sind diese »absoluten« Maße der Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit von eher geringem Wert. Wichtiger sind Befunde zum »relativen« Einfluss von einzelnen Faktoren auf die Leistungsfähigkeit des Fahrers: Wird die Spurhaltung durch Telefonieren erheblich beeinträchtigt? Werden Verkehrsschilder eher übersehen, wenn Sekundäraufgaben ausgeführt werden? Wie wird die Geschwindigkeitsregulation durch Ermüdung beeinträchtigt? Im Folgenden werden die einzelnen Stufen des Informationsverarbeitungsprozesses genauer beschrieben.
2.2.1 Fahren ist Sehen – visuelle Wahrnehmung und Aufmerksamkeit
An dieser Stelle sollen nicht die allgemeinen Grundlagen und Prinzipien der menschlichen Wahrnehmung dargestellt werden. Diese findet man in vielen Lehrbüchern der Allgemeinen Psychologie (z. B. Goldstein, 2009, oder die sehr kompakte Darstellung von Gegenfurtner, 2003). Vielmehr sollen einige Besonderheiten aufgegriffen werden, die für den Fahrkontext bedeutsam sind bzw. dort untersucht wurden. Hills (1980) schätzte, dass 90 % der für die Fahraufgabe relevanten Informationen visuell aufgenommen werden. Auch wenn derartige Angaben im Prinzip unsinnig sind (Wer legt fest, welche Informationen »fahrrelevant« sind? Wie sollte man das messen?), geben sie doch die Größenordnung korrekt wieder: Das visuelle System ist sicherlich der wichtigste Wahrnehmungskanal (vgl. Sivak, 1996) in der Fahrzeugführung.
Das visuelle Wahrnehmungsfeld hat horizontal eine Größe von circa 180 Grad, wobei nur ein vergleichsweise kleiner Ausschnitt detailreich und präzise erfasst werden kann – der foveale Bereich, der nur 0.01 % der Retina bzw. nur 2 Grad des Gesichtsfeldes ausmacht. Die Leistungsfähigkeit des menschlichen Auges ist im Bereich der Fovea am größten und nimmt zur Peripherie hin ab. Das gilt für die räumliche Auflösung, die Farb- und auch die Kontrastsensitivität.
Das im Fahrkontext verfügbare Informationsangebot außerhalb und innerhalb des Fahrzeugs übersteigt bei weitem die Kapazitätsgrenzen des visuellen Systems. Es findet deshalb eine Selektion statt, bei der der Fahrer seine Aufmerksamkeit auf relevante Objekte bzw. Ausschnitte des Wahrnehmungsfeldes richtet. Dies geschieht in erster Linie durch Blicksprünge (Sakkaden), die dazu führen, dass nacheinander wichtige Objekte fixiert und in den fovealen Bereich gebracht werden (Fixationen). Die Aufmerksamkeitszuwendung erfolgt entweder automatisch. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Person auf Warnlichter oder Warntöne (Martinshorn) reagiert. Diese Signale ziehen die Aufmerksamkeit unwillkürlich auf sich (»bottom-up«), ohne dass dazu eine willentliche Anstrengung des Fahrers erforderlich ist. Oder die Aufmerksamkeit wird willentlich gesteuert (»top-down«). Dies ist gegeben, wenn der Fahrer seinen Blick absichtlich auf den Tacho lenkt oder die Szene vor dem Fahrzeug beachtet (Egeth & Yantis, 1997). Im Fahrkontext erfolgt die Aufmerksamkeitsverlagerung überwiegend reizgesteuert, wenn beispielsweise die gerade vorausfahrenden oder querenden Fahrzeuge an einer Kreuzung beachtet werden. Im Unterschied zu anderen Aktivitäten – wenn man beispielsweise am PC ein Kapitel für das Lehrbuch »Verkehrspsychologie« verfasst – macht es die hohe Dynamik der Fahrsituation erforderlich, dass sich der Fahrer praktisch permanent der Fahrumgebung zuwendet.
Nach Rockwell (1972) entfallen circa 90 % der Fixationen während des Fahrens ohne zusätzliche Aufgabe auf eine kleine Region von +/–4° um den sogenannten »Focus of Expansion« oder »Punkt des Auseinanderfließens«. Auf diesen Punkt scheint man sich während des Fahrens zuzubewegen. Er liegt direkt in Blickrichtung vor dem Fahrer und wird als ruhender Punkt wahrgenommen, um den sich die restliche Welt auszudehnen scheint. Allerdings muss auch beachtet werden, dass etwa 30–50 % der visuellen Aufmerksamkeit Objekten gelten, die irrelevant für die Bewältigung der primären Fahraufgabe sind (Hughes & Cole, 1986). Fahrer scheinen sich aber des Risikos bewusst zu sein, welches ein längeres Wegblicken von der Straße mit sich bringt und wenden sich fahrirrelevanten Objekten nur kurze Zeit zu, durchschnittlich maximal etwa 1.6 sec (Wikman, Nieminen & Summala, 1998: Rösler et al., 2004, 307f.). Auch Versuche mit Okklusionsbrillen (Senders et al., 1967) zeigten, dass Blickabwendungen von der Straße von mehr als 1.7 Sekunden als kritisch und unangenehm empfunden werden (s. auch Zwahlen, Adams & DeBald, 1988). Daraus ist auch abzuleiten, dass Aktivitäten, die Blickzuwendungen erfordern, die über dieser Grenze liegen, möglichst zu vermeiden sind (s. Kap. 8). Foveales Sehen wird in erster Linie zur Wahrnehmung von Eigenschaften und Details genutzt, z. B. zum Ablesen von Verkehrszeichen.
Neben fovealem Sehen spielt auch peripheres Sehen beim Fahren eine wichtige Rolle. Bei der Annäherung an ein Ziel, das in Blickrichtung (focus of expansion, s. o.) liegt, findet eine Bewegung der peripher liegenden Objekte über die Retina statt. Dieser von Gibson (1950) als »optischer Fluss« bezeichnete Vorgang ermöglicht es Personen, auch in unbekannten Umgebungen erfolgreich navigieren zu können. Es scheint auch aufgrund von Übung und Fahrerfahrung möglich zu sein, durch peripheres Sehen Leistungseinbußen in der Spurhaltung, die durch die Blickabwendung entstehen können, zu kompensieren (Summala, Nieminen & Punto, 1996). Dies gilt aber nur für einfache Teile der Fahraufgaben wie die Spurhaltung, nicht aber für die Objektidentifikation, beispielsweise das Reagieren auf die Bremslichter des vorausfahrenden Fahrzeugs (Summala, Lamble & Laakso, 1998). Außerdem wichtig ist aber auch das Entdecken von Veränderungen und Bewegungen im peripheren Bereich. Diese Entdeckung ist die Voraussetzung dafür, dass dann die Aufmerksamkeit auf die entsprechenden Objekte gerichtet werden kann, um so zu entscheiden, ob diese handlungsrelevant sind. Wenn beispielsweise beim Fahren in der Peripherie ein bewegtes Objekt erkannt wird, wird die Aufmerksamkeit darauf gerichtet, um zu erkennen, ob es sich um einen Fußgänger handelt, der gerade die Straße betreten will.
Foveales und peripheres Sehen haben beim Fahren damit zusammenfassend folgende Funktionen:
Beobachtung des Punkts des Auseinanderfließens vor dem Fahrzeug, um den Straßenverlauf zu erkennen, Geschwindigkeit und Abstände zu regulieren und Hindernisse vor dem Fahrzeug zu erkennen (zentrales Sehen)
Erkennung von Objekten in der Peripherie, Richtung der Aufmerksamkeit auf diese und Einleiten entsprechender Handlungen, wenn dies nötig ist (periphere Wahrnehmung)
Foveales und peripheres Sehen werden durch zusätzliche Aufgaben während des Fahrens unterschiedlich beeinflusst. Das foveale Sehen wird beim Fahren beispielsweise beeinträchtigt, wenn eine Anzeige abzulesen ist. Dieser Vorgang erfordert, dass die Wahrnehmung von der Straße weg hin zum Display gewendet wird und in diesem Moment folglich keine Informationen der Verkehrssituation über foveales Sehen aufgenommen werden können. Beim peripheren Sehen können zusätzlich kognitiv beanspruchende Aufgaben dazu führen, dass es zur Abnahme der Aufnahmefähigkeit im peripheren Bereich des Sehfeldes kommt. Dieser Effekt wird von Williams (1985) als »tunnel vision« bezeichnet.
Die Leistungsfähigkeit des visuellen Systems garantiert allerdings noch nicht sicheres und unfallfreies Fahren. Bei jüngeren Personen ist sie deutlich größer als bei alten. Wie ist es dann zu erklären, dass junge Fahrer sehr viel häufiger in Unfälle verwickelt sind als ihre älteren Kollegen (s. Kap. 5)? Bei Kreuzungen mit vorfahrtsberechtigten Verkehrsteilnehmern wird häufig berichtet, dass in die Richtung dieser Verkehrsteilnehmer geblickt, diese aber nicht gesehen wurden. »Looked but failed to see« ist inzwischen zu einem Schlagwort geworden, das verdichtet diesem Umstand Rechnung trägt. Offensichtlich sind es nicht die basalen perzeptiven Fähigkeiten, die den Ausschlag für die sichere Fahrzeugführung geben, sondern Verarbeitungsprozesse, die einen hohen Anteil an Vorwissen und Erfahrung erfordern.