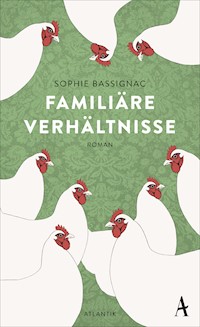9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Adélaïde ist verzweifelt Nicht genug, dass sie unglücklich in Ivan, den Nachbarn ihres Kollegen verliebt ist. Jetzt wurde auch noch aus dem Museum, dessen Direktorin sie ist, ein wertvolles Gemälde gestohlen. Verdächtig ist Adélaïdes Assistent Étienne, um dessen Ehe es wiederum nicht gut steht. Weshalb er aber auch nicht merkt, dass die Schauspielerin Héloïse sich Hals über Kopf in ihn verliebt hat. Ein Liebeswirrwarr, das nur eine Frage zulässt: Warum verlieben wir uns überhaupt noch? Und wenn, dann immer in genau die Person, die uns schlichtweg nicht zu sehen scheint? Erst als ein weiterer Kunstraub geschieht und Étienne verhaftet wird, geraten die Dinge plötzlich in Bewegung ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 303
Ähnliche
Sophie Bassignac
Verkettung glücklicher Umstände
Roman
Aus dem Französischen von Claudia Steinitz
Atlantik
Für Catherine
»Er war ein sanftmütiger Mann. Und er erinnerte sich sehr gut an die Frauen, die ihn abgewiesen hatten.«
Michelangelo Antonioni, Der Horizont der Ereignisse
1
»Nein, Monsieur Ba! Nein! Ich bin keine Rassistin! Das dürfen Sie nicht sagen!«
Die Stimme von Adélaïde Ozenfant schwankte zwischen vibrierenden Bässen und dem schrillen Gackern erschrockener Hühner. Étienne saß vor ihrem Schreibtisch und sah zu, wie sie ungeduldig das Gesicht verzog, während sie den Hörer ans Ohr presste. Sie lauerte darauf, beim kleinsten Zögern ihres Gesprächspartners loszulegen, während sie wie eine Langstreckenschwimmerin auf ihrer schmalen Bahn unermüdlich an einer unsichtbaren Linie auf und ab lief. Plötzlich hielt sie an, kritzelte etwas in ihr Notizbuch und reichte es ihrem Assistenten. »Sein Vorname?«, hatte sie auf das weiße Blatt geschmiert. »Joseph«, flüsterte er.
»Joseph, hören Sie mir zu«, sagte sie versöhnlich.
Der Wachmann am anderen Ende der Leitung ließ nicht locker. Adélaïde Ozenfant musste in einer Minute erkennen, woran sich die ganze Belegschaft allmählich gewöhnt hatte, weil sie Tag für Tag mit Joseph Ba zu tun hatte. Hinter den maßgeschneiderten schwarzen Anzügen und den tadellosen Oberhemden, der Größe von fast zwei Metern und vollendeter Eleganz verbarg sich der pingelige Buchhalter des Respekts, den man ihm schuldig war. Die Museumsdirektorin brachte diese Erkenntnis völlig aus der Fassung.
»Hören Sie, ich brauche heute Abend jeden«, versicherte sie. »Ich kann einen so unentbehrlichen Mitarbeiter wie Sie nicht einfach ersetzen.«
Étienne merkte, dass sie schnell verstanden hatte und dem empfindlichen Joseph Ba deshalb Honig ums Maul schmierte.
»Also, ich rechne in spätestens einer Stunde mit Ihnen«, verkündete sie zuversichtlich. »Und um zehn lasse ich Sie gehen. Ihre Frau …«
Als ihr Gesprächspartner sie erneut unterbrach, blieb sie mitten im Raum stehen und sank dann in ihren Sessel. Étienne fragte sich, womit der Wachmann geschossen hatte, auf jeden Fall hatte er ins Schwarze getroffen. Sie knallte das Telefon auf den Tisch und starrte ihren Assistenten an. Ihr finsterer Blick zitterte vor Verzweiflung.
»Mir steht’s bis hier«, sagte sie und streifte mit der Handfläche ihre Wasserwelle.
Sie schloss die Augen und seufzte, dann legte sie wieder los.
»Ehrlich, die Wehen von Madame Ba sind mir piepegal! Mein Gott, hätte ich wissen müssen, dass sie am Tag der Vernissage von Paul Albrecht entbindet? Haben Sie das gewusst?«
»Ich wusste, dass es kurz bevorsteht. Mehr nicht. Zwillinge, glaube ich.«
Étienne kannte das Lied. Adélaïde, ledig und ohne Nachkommen, verabscheute Familien und ihre Sprösslinge, die mit allen Mitteln ihre überaus wichtige Agenda zu boykottieren suchten. Manchmal bedauerte sie ihre Strenge, wenn man ihr ein Neugeborenes oder einen liebenswürdigen Ehepartner vorstellte, aber sobald sie wieder in ihrem Büro saß und über den unlenkbaren Saustall wütete, gewann das Unverständnis schnell die Oberhand.
Sie holte eine Schachtel Zigaretten aus der Tasche und hielt sie ihrem Assistenten hin. Dann genossen sie in andächtiger Stille gemeinsam das Verbotene, eine willkommene Pause, die das Drama für kurze Zeit unterbrach. Étienne lächelte, plötzlich packte ihn große Sympathie für die kräftige, vor Ungeduld bebende Frau, die rauchend aus dem Fenster starrte. Wenn sie so tief in Gedanken versunken war, als wäre sie allein, ertappte er sich manchmal dabei, sie schön zu finden. Wenn sie sich mitten in dem Chaos, das sie verursachte, eine Pause gönnte, erhellte ein schelmisches Kleinmädchenlächeln ihr teigiges Gesicht. Adélaïde besaß die Anmut der Pummeligen, die immer aussehen, als würden sie tanzen, und den mitreißenden Charme derer, die vom nächsten Tag alles erwarten.
Er liebte sie vorbehaltlos, seitdem sie ihn acht Monate zuvor in genau diesem Büro völlig unerwartet eingestellt hatte. Die Erinnerung an ihre erste Begegnung stand ihm oft vor Augen wie eine glückliche Halluzination. Vom Jobcenter geschickt, hatte er sich an jenem Tag schwitzend und mit dem heftigen Wunsch, woanders zu sein, in Espadrilles und schmuddeligem Polohemd zu dem Vorstellungsgespräch geschleppt. Die Direktorin des Kunstmuseums ignorierte beflissentlich, mit wem sie es zu tun hatte, und erklärte ihm, dass sie jemanden suche, um ihre »kleine Mannschaft« zu beaufsichtigen. Er brachte keinen sinnvollen Satz heraus und bewunderte Adélaïde, die vor Energie sprühte und genug Motivation für sie beide zu haben schien. Ohne zu zögern, stellte sie die Fragen, gab die Antworten und füllte alle Gesprächspausen. Sie entschlüsselte seinen lückenhaften Lebenslauf wie ein Horoskop, das auf wundersame Weise genau ihren Anforderungen entsprach, und vollbrachte an jenem Tag das Kunststück, ihm in kaum dreißig Minuten gegen seinen Willen das Leben zu retten.
Als er sein neues Amt antrat, verstand Étienne bald, warum Adélaïde ihn ausgewählt hatte und nicht einen anderen, ganz sicher qualifizierteren. Ihre »Mannschaft«, vom Garderobenmädchen bis zu den Museumsaufsehern, vom Techniker bis zu den Buchhaltern, war eine vielsagende Ansammlung von Drückebergern und Depressiven, überforderten kleinen Angestellten, die die großmütige Adélaïde geborgen hatte. Ebenso schnell stellte er fest, dass sie für ihre Direktorin keinerlei Dankbarkeit zeigten. Die Mitarbeiter nannten sie hinter ihrem Rücken boshaft »Mutter Ozenfant«. Anfänglich sorgte sich der Neuankömmling wegen des Abgrunds, der seine Kollegen von ihrer Wohltäterin trennte, und er war schockiert von so viel Undank. Im täglichen Umgang begriff er bald, dass die Angestellten in Adélaïdes Argot und ihrem Marktweibgeschrei eine Falle, eine Hinterlist sahen, die sie des hierarchischen Leidens beraubte, das ihnen zustand. Dann hörte Étienne, der ihr direkt unterstellt war und so zwischen beiden Polen dieser unmöglichen Konstruktion feststeckte, die bösen Gerüchte, die Adélaïdes anfälligen Ruf jeden Tag bedrohten. Er erfuhr, dass sie eng mit dem Bürgermeister verbunden sei, dass sie Beziehungen ausgenutzt habe, dass sie trinke, dass sie mit dem Trinken aufgehört habe, dass sie jeden Sonntag zum Gottesdienst gehe, dass sie Mitglied der Kommunistischen Partei sei, dass sie früher schlank gewesen sei, dass sie sich in ihr Arbeitszimmer einschließe, um zu schlafen, und ansonsten nur Wind mache und sich auf fremde Kosten vollstopfe. Man gab ihr die Schuld am überraschenden und katastrophalen Rückzug von Frédéric Malte, dem Konservator der Albrecht-Ausstellung, der einen Tag vor dem Eintreffen des Künstlers hingeschmissen hatte. Manche Leute behaupteten sogar, sie werde sich auch verdrücken. Über die Persönlichkeit und das geheime Leben von Adélaïde Ozenfant zu tratschen, war ein unerschöpflicher Zeitvertreib, der den Leerlauf angenehm überbrückte. Wie ein Geheimpakt gab diese harmlose Auflehnung den Museumsmitarbeitern das Gefühl, gemeinsam gegen einen Feind vorzugehen.
Aber nach acht Monaten einer hemdsärmeligen, unausgesprochenen Freundschaft kannte Étienne die Frau, die in ihrem Chefsessel träumte und rauchte, besser als jeder andere. Schamlos manipulierte Adélaïde die Instanzen, denen sie unterstellt war, frisierte Lebensläufe und war in Wirklichkeit weder naiv noch ahnungslos, sondern wusste bestens über die ständigen Missverständnisse Bescheid, die sie wie widerliche Dämpfe umwaberten. Sie war eine leidenschaftliche Liebhaberin der Malerei und eine echte linke Katholikin. Eingeschnürt in ihre zeitlosen Kostüme, liebte sie die Menschen und versuchte eine Atmosphäre der Vertraulichkeit zu schaffen und sich ihre Macht als Direktorin des winzigen Museums zu verdienen.
Adélaïde schien die Gegenwart ihres Assistenten nicht zu bemerken. Dabei dachte sie über ihn nach. Sie bereute, dass sie in seinem Beisein über die zweifelhafte Anstellung von Joseph Ba gesprochen hatte. Was für eine Dummheit, dachte sie, denn Étienne konnte das Gesagte durchaus auf sich beziehen. Ohne Zweifel waren Effizienz und Autorität ihres Rekruten sehr wechselhaft. Deshalb mied sie das Thema Kompetenz, wenn er in der Nähe war. Sie geißelte sich kurzzeitig wegen ihrer bedauernswerten Neigung zu vergessen, dass ihr Protegé Schlimmes durchgemacht hatte und noch sehr anfällig war. Als sie ihn diskret ansah, fiel ihr auf, dass er eine andere Brille trug. Die neue verbarg vorteilhaft sein schlechtes Aussehen und verlieh seinem Gesicht Ebenmäßigkeit und Spannung. Étienne sieht immer noch hilflos aus, aber ein Mann, der sich das Leben nehmen will, kauft sich keine Wayfarer à la Mastroianni, dachte sie und drückte ihre Kippe aus.
Es klopfte an der Bürotür, und ohne zu warten, betrat die Herrin über die Audioguides den Rauchsalon. Jäh aus ihren Träumen gerissen, starrten Adélaïde und Étienne sie an. Anne-Laure Bessonneau trug einen Minirock aus granatfarbenem Satin, blickdichte Leggings mit breiten Streifen und unter einer kurzen, taillierten Jacke aus gemustertem Samt die durchsichtige Bluse einer lustigen Witwe über einem schwarzen Spitzen-BH. Der Gesamteindruck erinnerte an die Ausstattung für einen Junggesellinnenabschied am Körper eines Skeletts im Schaufenster eines Scherzartikelladens. Anne-Laure stellte sich breitbeinig mitten ins Zimmer und gab ein langes gelangweiltes Stöhnen von sich.
»Hinter dem Schalter der Audioguides gibt’s einen großen Fleck an der Wand«, sagte sie. »In der Toilette im ersten Stock ist was undicht. Soll jemand den Klempner rufen?« Adélaïde brauchte einen Moment, um zu begreifen, was sie da hörte.
»Klar soll jemand den Klempner rufen!«, brüllte sie nach kurzem Atemstillstand. »Und holt irgendeinen Schinken aus dem Keller, um den Fleck zu verbergen.«
»Außerdem will der Partyservice mit Ihnen sprechen«, fügte Anne-Laure hinzu und machte kehrt.
»Gibt es ein Problem?«, fragte Adélaïde mit Tremolo in der Stimme.
»Nein, ich glaube nicht«, antwortete die junge Frau, ohne sich umzudrehen.
Adélaïde hatte nur noch wenig Zeit, um sich vor dem großen Wirbel der Vernissage zu fangen. Seit dem Morgen ging alles schief. Jetzt musste sie für das Wagnis büßen, das sie mit der Albrecht-Ausstellung eingegangen war. Die vielen Sitzungen mit ihren Mitarbeitern hatten sehr dazu beigetragen, sie nervös zu machen. Ablaufproben wie für moderne Choreographien bestätigten ihr nur die Unfähigkeit des Personals, im Fall eines Problems zu reagieren. Ebenso wenig vertraute sie dem Helden des Abends, Paul Albrecht, dem genialen Heuchler, dessen Gegenwart sich als verheerend erweisen konnte. Ausraster, Paranoia oder demonstrative Verachtung der Öffentlichkeit und der Honoratioren – bei diesem Künstler musste man mit dem Schlimmsten rechnen. Auch vor einem der spektakulären multiphobischen Krämpfe, die Étienne Bellamy mit seinen Angststörungen und Depressionen häufig packten, war sie nicht sicher. Ganz zu schweigen von der frühzeitigen Entbindung von Madame Ba, der Entdeckung eines verheerenden Druckfehlers auf dem Umschlag des Katalogs, der Abwesenheit des Bürgermeisters, einer Überschwemmung in der ersten Etage oder der massiven Ablehnung von Albrechts Werken durch ein entsetztes Publikum. Zu all diesen Ängsten kamen auch noch die verdammten Hitzewallungen, die sie von Kopf bis Fuß zum Sieden brachten, als lebte sie in einem Backofen. Adélaïde lehnte jede Behandlung ab, obwohl ihr der Arzt die Freuden der Menopause aufgezählt und ihr lächelnd versichert hatte, das Ganze könne ein Jahr oder auch zehn dauern. Sie steckte in ihrem Körper wie in einem gefütterten Anorak und erstickte unter ihrer Zwangsjacke aus Fett. Mehrmals am Tag und die halbe Nacht wurde sie für ein paar Minuten aus dem Gang der Welt hinausgeschleudert. Dann musste sie gegen den heftigen Drang ankämpfen, sich die Kleider vom Leib zu reißen und sich nackt in den Wind zu stellen. Der Hitzewelle folgte ein Gefühl von Polarkälte, ihre Haut überzog sich mit einer feinen Schicht von eisigem Schweiß, und sie klapperte mit den Zähnen. Adélaïde wurde bewusst, dass die meisten Frauen ihres Alters unter den Qualen eines gestörten Temperaturhaushalts litten, dass sie alle von heftigen Stürmen gebeutelt wurden und von derselben beschämenden Erkrankung befallen waren, über die niemals gesprochen wurde. Sie war ihren Geschlechtsgenossinnen immer mit Herablassung begegnet und verachtete das Kokettieren der einen und die Verführungskunst, die bei anderen die Intelligenz ersetzte. Überrascht von dieser Gemeinsamkeit, begegnete sie den Frauen um sie herum mit neuer Anteilnahme. Die Hexen, die sie jahrelang ausgegrenzt hatten, indem sie ihr ihre Bälger, die Überlebenden grotesker Entbindungen, vor die Nase hielten, waren zu Leidensgefährtinnen geworden.
Trotzdem stufte sie sie in drei Kategorien ein, weil sie fand, dass nicht alle den gleichen Mut aufbrachten. Für diejenigen, die ihr Verfallsdatum freiwillig vorzogen, empfand Adélaïde eine gewisse Zuneigung. Sie schienen ihr ganzes Leben auf den Moment gewartet zu haben, sich endlich von dem Zwang zu befreien, den Männern zu gefallen, und nutzten die Gelegenheit, um auszusteigen. Befreit von den Blicken der anderen, betrachteten sie die letzte Etappe ihres Lebens wie eine neue Jugend, eine aufregende Exkursion. Die Frauen der zweiten Kategorie boten das erbärmliche Bild eines Schiffbruchs. Sie unterwarfen sich kampflos der Natur und trugen das Alter wie ein Bettelgewand. Schlaff schlurften sie durch die Gegend und erstickten in aller Öffentlichkeit und ohne Zurückhaltung. Sich selbst stufte Adélaïde in die dritte Gruppe ein, bei den Kämpferinnen, die das Alter, seine deprimierende Ästhetik und seine vermeintlichen Zwänge herausforderten. Wie einen kostbaren Schmuck, den man nicht trägt, über dessen Besitz man sich jedoch freut, bewahrte sie in sich ein warmes Plätzchen für die Liebe. Obwohl sie ganz mit ihrer Karriere beschäftigt war, hatte sie in dem Fischteich, in dem sie selbst schwamm, ein paar Liebhaber geangelt, die einzelne Lebensabschnitte markierten, leider ohne je den von der Vorsehung gesandten Mann zu treffen.
Sie fächelte sich mit einem Ordner Luft zu, betrachtete den rötlichen Hallux valgus, der ihren rechten Fuß entstellte, und holte aus einer Schublade eine Packung Sandgebäck. Nachdem sie mehrere Kekse verschlungen hatte, versank sie in einem süßen Frieden. Adélaïde hatte in wenigen Jahren sehr zugenommen und machte sich allmählich Sorgen. Ihre Kilos hatten sich ganz leise vermehrt, ihre Gestalt war lange unverändert geblieben. Ihre Formen hatten sich gerundet, ohne zu erschlaffen, und das Ergebnis vor dem Spiegel war nicht unangenehm. Seit einigen Monaten aber schenkte ihr die Erdanziehung nichts mehr. Ihr Fleisch war weicher, schwerer geworden, und wenn sie durch die Hitzewellen schweißnass wurde, spürte sie erst recht, wie dick sie war. Sie stellte sich mühsam hin und zog die Schuhe an. In jeder Etappe unseres Lebens müssen wir die passende Ethik und Ästhetik finden, dachte sie und schloss das Fenster. Ihr fiel die extravagante Kleidung von Anne-Laure Bessonneau ein, und sie dachte, eher belustigt als verärgert, dass der jungen Frau in zwanzig oder dreißig Jahren auch gewisse Änderungen bevorstanden.
Nachdem sie ihre Ängste abgeschüttelt hatte, verließ Adélaïde ihr Büro. Vor dem orientalischen Saal trat ihr der technische Direktor, Arnaud Stip, mit dem Blick eines Sterbenden in den Weg.
»Geht es Ihnen nicht gut?«, fragte sie in böser Vorahnung.«
»Es gibt ein Problem mit der Alarmanlage. Wir haben sie eine Weile nicht mehr geprüft, und ich habe den Eindruck, sie geht, wie sie Lust hat.«
Adélaïde stieß einen langen schmerzlichen Seufzer aus, der den technischen Direktor davon abhielt, in seiner Erklärung fortzufahren.
»Himmelherrgott!«, schrie sie und stampfte mit dem Fuß. »Das sagen Sie mir jetzt, eine Stunde vor der Invasion der Barbaren?«
Stip verzog das Gesicht und schob seine Brille mit dem Finger zurecht.
»Niemand weiß davon außer uns beiden. Wir müssen nur Étienne Bellamy und Joseph Ba sagen, sie sollen etwas wachsamer sein.«
Adélaïde betrachtete Stip fassungslos. Der Blondschopf hielt sich für MacGyver, hatte aber in den drei Jahren im Museum nichts als Unfähigkeit gepaart mit Willensschwäche an den Tag gelegt. Sie durchbohrte ihn mit dem Blick, und er verstummte. Beschämt und niedergeschlagen wie zwei Diebe, die in einer leergeräumten Ferienwohnung zufällig aufeinandertreffen, trennten sich die beiden Komplizen am Ende des Flurs.
Adélaïde dachte kurz daran, die Polizei über die Mängel im Sicherheitssystem zu verständigen. Dann malte sie sich aus, wie die Polizisten mitten in der Vernissage im Beisein der Honoratioren und eines manisch-depressiven Künstlers vor versammeltem Publikum hereinplatzen würden. Und da sie die Wahrscheinlichkeit eines Zwischenfalls auf eins zu einer Million schätzte, beschloss sie, nichts zu unternehmen.
Étienne fand im Lager eine Altstadt im Schnee von Henri de Sennezard mit den Maßen des Wasserflecks. Nachdem er das Gemälde dem technischen Direktor übergeben hatte, ging er ins Untergeschoss, um sich ein letztes Mal zu vergewissern, dass bei der Sonderausstellung alles in Ordnung war. Im ersten Saal, der den Monumentalwerken des Künstlers, einer Serie von zehn post-atomaren Riesen aus weißlichem Silikon, gewidmet war, las er noch einmal alle Bildunterschriften, die am Morgen in Eile neu gedruckt worden waren, und fand immer noch Druckfehler. Offensichtlich eine letzte Würdigung der Museumsmitarbeiter für den schwierigen Charakter von Paul Albrecht, dachte er niedergeschlagen. Während der fünfzehn Tage des Ausstellungsbaus war die im Museum herrschende Wurstigkeit durch die Psychose des Künstlers noch geschürt worden. Dass er nur mit Adélaïde kommunizieren wollte, hatte Bessonneau, Stip und die anderen verletzt, sie rächten sich mit ihrer Engstirnigkeit. Étienne ärgerte sich umso mehr über die erbärmlichen Manöver seiner Kollegen, da er das Werk des Künstlers schätzte. Ihn auszustellen war eine echte Herausforderung, ein Sieg, der Ozenfants Beharrlichkeit zu verdanken war; sie hatte an allen Fronten gekämpft, um die sagenhaften Riesen des Künstlers durchzusetzen. Albrecht war schlecht gelaunt und affektiert, ein williger Sklave seines extrem reichen Universums. Er durfte sich alles leisten und verdiente trotzdem jeden Respekt.
Étienne kontrollierte, ob in den Gängen nichts herumlag, und machte einen Umweg über die Toilette, um vor dem Spiegel ein letztes Mal sein Aussehen zu prüfen. »Werfen Sie sich in Schale, Étienne«, hatte ihm Adélaïde am Ende ihrer letzten Versammlung zugeflüstert. Also hatte er für diesen Anlass aus den Ruinen seines früheren Lebens einen eleganten nachtblauen Anzug ausgegraben. Aber der Spiegel zeigte ihm hartnäckig das Bild einer Bohnenstange mit strohigen Haaren, eines für den Fotografen herausgeputzten Clochards. Seine Hässlichkeit widersetzte sich der Aufmachung, und die hartnäckige Traurigkeit trübte seinen Blick hinter den Gläsern seiner neuen Brille. Da er die Symptome des Bleimantels aufsteigen spürte, der sich ohne Vorwarnung um seinen Körper legte, rückte er den Krawattenknoten zurecht und wandte seinem Bild den Rücken zu.
Das Geräusch einer Wasserspülung ließ ihn auffahren. Er fragte sich, ob er vielleicht laut gedacht hatte. Paul Albrecht beachtete ihn nicht, ging zum Waschbecken und drehte gedankenverloren den Wasserhahn auf. Aus Verlegenheit tat Étienne es ihm gleich. Er war porös – der Ausdruck stammte von ihm –, er spürte die Emotionen von Leuten, die ihm nahe kamen, wie Vibrationen, die er auf sich bezog. Jetzt empfing er die negativen Wellen dumpfen Ärgers, der die geschlossene Atmosphäre der Toiletten ausfüllte. Im Verlauf ihrer kurzen Gespräche hatte Étienne versucht, die Verantwortungslosigkeit seiner Kollegen wiedergutzumachen. Seine doppelte Funktion als Assistent der Direktorin und Teil des Personals zwang ihn ständig, sich zu rechtfertigen. Albrecht hatte seine Bemühungen offensichtlich nicht bemerkt und schien ihn zu denen zu zählen, die seine Ermordung anzettelten.
»Wissen Sie, was Montherlant sagte?«, fragte Étienne etwas zu schrill. »Er sagte, ich verzeihe, weil es mir scheißegal ist.«
Der Künstler war durch die Betrachtung seiner Hände unter dem Wasserstrahl gefesselt, Étienne, sich selbst überlassen, spürte, wie die Unruhe als warmer Schaum von seinen Eingeweiden zur Stirn aufstieg. Albrecht kicherte und schritt zum Trockner.
»Ich werde von allen beschissen«, schrie er, gegen den Krach des Gerätes an. »Ich verzeihe nicht, weil es mir nicht scheißegal ist.«
Étienne, zugleich erleichtert, dass der Künstler reagierte, und empört über die Heftigkeit, die er nicht verdient hatte, fand seine frühere Schlagfertigkeit wieder, die ihm mit der Lebenslust abhandengekommen war.
»Ich versuche, diese Überlegung auf mein eigenes Leben zu übertragen«, fuhr er fort. »Es ist wie ein Programm, eine Disziplin, eine Berechnung für die Zukunft.«
Paul Albrecht sah ihn mit einem gewissen Interesse an, wie ein Passant, der plötzlich auf ein Plakat aufmerksam wird.
»Wem verzeihen? Was soll einem scheißegal sein? Nichts ist mir scheißegal, und ich habe kein Interesse zu verzeihen.«
Étienne spürte, dass der Moment wichtig war. Zum ersten Mal ließ der Mann sich in seiner Gegenwart gehen, und selbst Adélaïde, überlegte er sehr angespannt, war es wahrscheinlich nicht gelungen, ihn so offen zum Reden zu bringen. Er musste das Blei, das den Fluss seiner Gedanken bedrohte, ignorieren. »Man muss den Menschen verzeihen, dass sie Ihre Arbeit nicht verstehen, und es muss einem scheißegal sein, damit man weitermachen kann.«
»Das ist unmöglich!«, schimpfte Albrecht. »Kein Künstler ist dazu fähig.«
Er hatte schon die Hand auf dem Türgriff und starrte Étienne an. Er schien zu zögern, betrachtete ihn einen Moment schweigend.
»Und Sie? Wem müssen Sie was verzeihen?«
»Meiner Frau, dass sie mich verlassen hat«, antwortete er wie aus der Pistole geschossen.
Albrecht verdrehte die Augen und verließ wortlos den Raum.
Étienne sah sein bleiches Abbild im Spiegel, niedergeschmettert durch die Wucht des »zu spät«, die ihn mehrmals am Tag traf. Albrecht verachtete sein Leiden, aber damit hatte er unrecht. Die zwölf Jahre mit Sylvana waren erhaben gewesen wie ein Kunstwerk. Künstler sind Dreckskerle flüsterte er seinem Bild zu. Sie sind ebenso dünkelhaft wie die braven Bürger und machen ihre Verzweiflung zu Gold, dachte er, während er einen widerspenstigen Wirbel glatt strich, der wie eine fixe Idee auf dem höchsten Punkt seines Schädels stand.
2
Unter dem Kronleuchter des großen Foyers standen wartende Journalisten mit griffbereiten Kameras in Grüppchen zusammen und unterhielten sich. Die aufgeregte Adélaïde hatte Paul Albrecht im Schlepptau und grüßte, ohne stehen zu bleiben. Als sie Étienne am Kassenschalter lehnen sah, gab sie ihm mit einem Blick zu verstehen, dass sie seine Untätigkeit angesichts von dreihundert Personen, die sie in einem Museum ohne Alarmanlage erwarteten, entschieden missbilligte. Er blieb ungerührt und sah ihr nach, als sie durch die Halle eilte. Vor dem Buffet warf sie einen Gastgeberinnenblick auf die Petits Fours, die in geraden Reihen auf dem langen, mit japanischen Blumenmotiven geschmückten Brettertisch angeordnet waren. Sichtlich zufrieden zog sie Albrecht für ein Vieraugengespräch beiseite. Während die Direktorin redete, starrte der Künstler auf seine Tennisschuhe, offenkundig verstört von der Verpflichtung zur Liebenswürdigkeit, die sie ihm behutsam auferlegte.
Étienne beobachtete sie aus einiger Entfernung und stellte fest, dass Adélaïde der mütterlichen thronenden Madonna ähnelte, die die Renaissancemaler mit einer Schar von Miniaturheiligen unter ihrem Umhang dargestellt hatten. Albrecht selbst war die Inkarnation des Künstlers, des strahlenden Magiers, der sich von der Welt abwandte, die er in seinen Bann zog. Étienne nahm es ihm nicht mehr übel, dass er auf sein Liebesproblem herabgeschaut hatte. Ihm war selbst klar, was für ein erbärmliches Bild seine Verzweiflung abgab.
Die Halle füllte sich binnen weniger Minuten. Trotz der Absperrungen herrschte das blanke Chaos. Die Treppe nach unten zur Ausstellung wurde zum Engpass, die Walkie-Talkies der gestressten Museumswärter knisterten unentwegt, und der Vizepräsident des Regionalrates war, so hieß es, in der Halle stecken geblieben. Anne-Laure Bessonneau stand am Eingang, unerschütterlich in ihrer »Nuttenaufmachung«, wie der technische Direktor sagte, und hatte die Anweisung, auf der Gästeliste Namen abzuhaken. Neben ihr stand Étienne und übergab jedem das Faltblatt zur Ausstellung. Adélaïde hatte ihn gebeten, die VIPs zu umgarnen und ihnen mit kleinen persönlichen Sätzen zu zeigen, dass man sie sehr wohl erkannte. Anne-Laure, die schon länger im Haus war, sollte sie ihm diskret vorstellen, was sie natürlich nicht tat. Stattdessen zog Madame Audioguide die Aufmerksamkeit auf sich und optimierte ihren Look durch beängstigende Hüftschwünge. Auch wenn sie ihr eigenes Spiel spielte, wirkte die Selbstsicherheit der jungen Frau auf Étienne wie eine Stütze an einem kranken Baum. Sie leitete die Menschenströme mit dem Know-how einer Pfadfinderführerin.
»Wow!«, flüsterte Anne-Laure und wies mit dem Kopf Richtung Eingang. »Siehst du die Blonde im schwarzen Mantel? Das ist Héloïse Gassien.«
Er suchte in der Menge eine Gestalt in Schwarz, bemerkte eine, die etwas bemerkenswerter war als die anderen, und zeigte fragend auf sie. »Ja. Erkennst du sie nicht?«
Anne-Laures ungeduldiger Ton verunsicherte Étienne.
»Nein«, sagte er und schüttelte nervös den Kopf.
»Sie ist Schauspielerin und gibt demnächst ein Gastspiel am Stadttheater. Es kann nicht sein, dass du sie nicht kennst. Sie war in diesem Film, Scheiße, ich habe den Titel vergessen. In Ouest France war letzte Woche ein Artikel über sie.«
Die Schauspielerin passte sich folgsam der Bewegung der Menge an. Er erkannte sie tatsächlich, aber die Vertrautheit ihrer Züge verband sich mit keiner Erinnerung. Sie hätte ebenso die Kassiererin im Supermarkt sein können, in dem er täglich einkaufte. Héloïse Gassien war apart und zierlich, wie eine als Dame verkleidete Halbwüchsige. Der weite Mantel, der kleine Mund und die leicht gewellten blonden Haare verströmten einen altmodischen Charme. Als sie bei ihnen angekommen war, holte sie ihre Einladung aus einem Samttäschchen, das so platt wie ein Briefumschlag war. Étienne überreichte ihr ein Faltblatt, sie sah ihn an und bedankte sich mit einem Kopfnicken. Dann wurde sie wieder vom Sog ergriffen und ließ einen Hauch ihrer seidigen Aura zurück. Etwas war geschehen, was Étienne nicht benennen konnte, etwas hatte ihn erschüttert. Er teilte mechanisch seine Broschüren aus und überlegte, dass ihm die Schauspielerin eine wichtige Botschaft übermittelt hatte, die sich nur an ihn richtete und die er entschlüsseln musste.
»Nicht übel, oder?«, fragte Anne-Laure.
Étienne hatte keine Zeit zu antworten. Aus dem Nichts war der Kopf von Joseph Ba aufgetaucht und nahm ihm die Sicht. Der Wärter stützte sich mit gespreizten Händen auf den Tisch, beugte sich vor und schnaufte wie ein Marathonläufer im Ziel.
»Wo ist sie?«
»Unten mit Albrecht«, antwortete Anne-Laure unbeteiligt und warf Étienne einen Blick zu.
Madame Audioguide mochte Durcheinander, spöttische Seitenhiebe und kleine Bosheiten gegen die Kollegen. Étienne sah dem Riesen nach, der sich kopfschüttelnd einen Weg durch die Menge bahnte.
Nachdem ihn Anne-Laure verlassen hatte, um im Untergeschoss herumzuscharwenzeln, empfing Étienne die letzten Gäste allein, dann gesellte er sich zu Adélaïde, die mit dem Bürgermeister plauderte, einem schönen Mann mit tiefer, ein wenig spöttischer Stimme, der seine eigene Show abzog, sich als Konkurrent von Paul Albrecht und seinen Werken positionierte und seinen Gesprächspartnern hemmungslos schmeichelte. Man sagte dem Schönling ein Abenteuer mit Adélaïde nach, das sie ausgenutzt habe. Dem Bürgermeister hing ein Ruf als Frauenheld der alten Schule an. Genervt von seinen Blicken, wandte sich Adélaïde seiner Kulturdezernentin zu. Étienne sah, wie erschöpft sie war, er hätte ihr gerne geholfen, indem er hier und eine Klarstellung oder einen Standpunkt äußerte. Aber er fand keine Worte. Also schaltete er allmählich ab und ließ sich von den Stimmen und Gesichtern tragen. Die schwarze Wellblechmähne der Kulturdezernentin erinnerte ihn an die Schönheiten, die Fernand Léger als erhabene Arbeiterinnen mit einem Zwölferschlüssel in der Hand dargestellt hatte. Vor den Fotografen, deren Blitzgewitter ihn blendete, trat Paul Albrecht entnervt von einem Fuß auf den anderen. Als Adélaïde eine weitere Runde drehte, machte sich Étienne diskret aus dem Staub. Während er zwischen den Gästen herumlief, stellte er fest, dass Albrechts Riesen auf wohlwollende Neugier stießen. Er freute sich darüber und erinnerte sich an das, was Adélaïde ihm beim Einstellungsgespräch anvertraut hatte. Sie hatte ihm erklärt, dass man das Provinzpublikum sehr behutsam behandeln müsse. Fern von Paris hätten die Leute immer das Gefühl, man wolle ihnen unverkäufliche Objekte und zweitrangige Künstler andrehen, alles, was die Hauptstadt unbeachtet ließ. Sie hatte hinzugefügt, dass ihr Publikum ein wenig paranoid sei und ihr Job darin bestehe, Vorurteile zu bekämpfen, die so hartnäckig waren wie Aberglauben. Aber es lohne sich, sagte sie, denn die Provinzler besäßen eine künstlerische Empfänglichkeit und eine Tiefe, die die allzu umworbenen und verwöhnten Pariser seit langem verloren hätten.
Im zweiten Saal entdeckte Étienne die Schauspielerin. Sie war von einer kleinen Gruppe geschwätziger Damen umzingelt und verteilte mit rührender Höflichkeit Autogramme. Sie spielte ihre Rolle mit dem gleichen Ernst wie eine blaublütige Prinzessin, die sich den Regeln ihres Standes unterwarf. Als sie seinen Blick bemerkte, winkte sie ihm freundschaftlich zu und verabschiedete sich von ihren Bewunderinnen. Als sie beim ihm war, trat er vorsichtig wie ein Kind, das immer mit einer Backpfeife rechnet, einen Schritt zurück. »Ich habe ihnen erzählt, wir seien alte Bekannte«, flüsterte sie ihm ins Ohr.
Étienne vernahm eine Spur von Schüchternheit in der heiteren Stimme der jungen Frau.
»Die Leute können sich nicht vorstellen, dass wir uns wie Betrüger fühlen«, sagte sie. »Ihre Bewunderung hat überhaupt keinen Sinn. Verstehen Sie?«
»Ich glaube«, stammelte er.
Er stellte fest, dass Héloïse Gassiens Schönheit wandelbar war. Ein Passfoto hätte nur die etwas fade Gleichmäßigkeit ihrer Züge gezeigt, ohne etwas von der Intensität ahnen zu lassen, die sie zu einer Seltenheit machte. Ihre Zähne standen ein wenig auseinander, die Lippen waren geschwollen wie nach der Liebe. Das ärmellose Kleid entblößte ihre schönen runden Schultern.
Er holte tief Luft.
»Gefällt Ihnen die Ausstellung?«
»Ja. Wunderbar. So richtig kann ich mich bei diesen Riesen nicht entscheiden. Was zeigen sie uns? Den Menschen vor uns, der mit der Natur im Einklang war, oder den nach uns, den die Natur wieder zu sich genommen hat? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind sie grandios.« Héloïses Stimme war sanft und musikalisch, ihr Ton eine winzige Spur irritiert.
»Ja, wirklich grandios«, wiederholte er.
Étienne liebte dieses Wort, grandios, das er früher oft benutzt hatte, als viele Dinge es noch waren.
»Wie ist er?«
»Albrecht?«
»Ja.«
»Möchten Sie, dass ich Sie bekannt mache?«
»Nein, nein«, antwortete sie eilig. »Er wirkt nicht sehr freundlich.«
Sie schien jede Einzelheit ihrer Umgebung einzusammeln, während ihre zusammengekniffenen Augen aussahen, als würde sie gegen den Wind ankämpfen. Étienne fragte sich, ob sie nicht ein bisschen übergeschnappt war.
»Wissen Sie«, verkündete sie schließlich, »ich finde, bestimmte Künstler sollten geheim bleiben, sonst wird ihre Kunst leicht missverstanden. Man muss sich ihren Werken mit besonderer Behutsamkeit nähern, sie sind so subtil, dass grelles Licht sie zerstört.«
Héloïse Gassien schaute sich um und überlegte.
»Vielleicht würde ich all das gerne als Einzige mögen, und das, was ich empfinde, als Einzige empfinden«, überlegte sie. »Ich hätte das alles gern für mich.« Wie eine Zauberin ihren Stab streckte sie den Zeigefinger aus.
»Verschwindet!«, befahl sie den Besuchern und lachte.
Étienne senkte den Blick. Er war baff. Mit drei Sätzen und ein bisschen Theater hatte Héloïse Gassien gerade zusammengefasst, was er täglich im Museum ertrug, wenn die Besuchergruppen ihn in seinen Träumereien störten.
»Sie haben recht. Und ich bin sicher, dass Paul Albrecht darunter leidet, dass er seine Arbeit zugleich verstecken und zeigen möchte.«
Héloïse zog den Mantel an und holte aus ihrer kleinen Tasche ein Tuch, das sie um den Hals band.
»Ich muss los.«
Aber sie ging nicht.
»Ich habe eine Idee. Könnten Sie mir vielleicht Ihr Museum zeigen? Ich sitze hier fest und weiß nicht, was ich mit meinen Sonntagen anfangen soll.«
Er stimmte sofort zu. Das war ein guter Weg, dieses komplizierte Gespräch würdig zu beenden.
»Übermorgen um sechzehn Uhr? Im Foyer? Passt Ihnen das?«, fragte sie und reichte ihm die Hand, wie man einen Deal besiegelt.
Étienne sah ihr nach, während sie sich zwischen den Gästen hindurchschlängelte. Sie strahlte inmitten der Menge wie ein Solitär an einer nackten Hand. Eine hektische Bewegung unterbrach seinen Gedankengang. Das Buffet war eröffnet, und die Besucher stürzten wie eine Herde zur Treppe.
Étienne suchte im Foyer nach Adélaïde. Er hörte ihr explosives Lachen, aber die kompakte Menge, die ihn von ihr trennte, schreckte ihn ab, und er beschloss, sich ein halbes Stündchen an einem ruhigen Platz auszuruhen. Das Antidepressivum, das ihm seine Therapeutin verordnet hatte, gab ihm oft das Gefühl, keine Muskeln mehr zu haben. Er bahnte sich einen Weg bis zur großen Treppe und ging hinauf in die erste Etage, die während der Vernissage für das Publikum gesperrt war. Er gab den Code ein, schloss die gepanzerte Tür hinter sich und durchquerte mehrere Räume bis zu seinem Lieblingssaal, dem japanischen, seinem Hafen. Dort ließ er sich auf ein Sofa fallen, streckte die schmerzenden Beine aus und tauchte allmählich in die ganz besondere Stille des Raumes ein. Er hatte irgendwo gelesen, dass die Japaner ihren Frieden fanden, indem sie eine Schale von vollendeter Form betrachteten. Er entspannte sich, indem er die mit Gold überzogenen Wandschirme, offene Fächer mit Miniaturzeremonien und Seidenrollen mit den liegenden Schönheiten aus der Edo-Zeit bewunderte. Er liebte es, sich in die bunten Stoffe der Kimonos zu versenken, die mit offenen Fenstern vor bukolischen Szenen oder hypnotischen Illusionen von trügerischer Tiefe bemalt waren. Besonders liebte er eine bestimmte Kurtisane von Utamaro, eine unendlich geduldige Vertraute, die seine zahllosen Geheimnisse unter den Faltenschichten ihres Mantels verbarg. So traf man Étienne Bellamy an manchen Abenden, wenn das Museum schloss, wie er mit halb geschlossenen Augen seine Geisha anbetete.
Er wusste nicht, dass ihn seine Kollegen »König des Unglücks« nannten. Überrascht hätte es ihn nicht. Alle um ihn herum bedienten sich einfacher Mittel, um die Kanten ihrer Leben abzuschleifen, Étienne aber klammerte sich starrsinnig an sein Leid. Alle Mitarbeiter waren sich irgendwann einig, dass der Assistent von Ozenfant sein Unglück wie eine unverdiente Medaille trug und sich aufspielte.
Andererseits hatte er ihrer Phantasie reichlich Stoff geboten. Wenige Wochen nach seiner Einstellung hatte Adélaïde in der Cafeteria zum Umtrunk eingeladen, um die Anschaffung eines Fontana zu feiern, der in ihrer Sammlung der Gegenwartskunst noch gefehlt hatte. Étienne war an dem Abend ziemlich angetrunken und noch deprimierter als sonst gewesen und hatte der Direktorin sein Drama erzählt. Dank Anne-Laure Bessonneau, die in der Nähe saß, wurde ihr Gespräch öffentlich. Nichts war ihr entgangen, von Étiennes gescheiterter Ehe bis zum Bankrott seines Designladens, von seinem Schuldenberg bis zur Notlandung in der Provinz. Er erzählte vor allem über seine Frau, die ihn nach zwölf Jahren Ehe wegen eines anderen verlassen hatte. Anne-Laures ausgestreckte Antennen hatten auch den Namen seiner Ex registriert, und diese absolute Sensation teilte sie schleunigst den anderen mit. Der Assistent von Ozenfant war mit Sylvana Bellamy-Hussel verheiratet, der bekannten Nachrichtensprecherin. Dass sie ihn sitzengelassen hatte, war nicht verwunderlich, unglaublich war vielmehr, dass sie ganze zwölf Jahre mit diesem Loser hatte leben können. Umso verrückter also, dachten die Neugierigen, dass Étienne von einem Missverständnis sprach, einer schweren Zeit in seiner Ehe, aber auf keinen Fall einem endgültigen Bruch mit seinem früheren Leben. Die Zeit ist mein Verbündeter, sagte er zu Ozenfant. Früher oder später werde er nach Paris zurückkehren und den Platz an der Seite seiner Frau wieder einnehmen.
Eine Weile hofften alle, dass die Nachrichtensprecherin im Museum auftauchen würde, dann gaben sie die Illusion auf. Mehrere Monate nach seinem Coming out schien sich Étiennes Situation nicht verändert zu haben. Im Gegenteil, er ging allmählich unter, wie eine Muschel am Felsen, die langsam in der steigenden Flut verschwindet. Man hatte allen Grund, seine Zukunft pessimistisch zu sehen. Er starb geräuschlos an Sylvanas Abwesenheit, während ihn ihre permanente, wenn auch nur eingebildete Gegenwart an seiner Seite abseits der anderen, in einer eigenen Welt leben ließ, die seine ganze Aufmerksamkeit erforderte. Der Lebensschmerz wurde zu seiner Daseinsberechtigung gegenüber allen und gegen alle, die sich bemühten, ihn davon zu befreien.
An diesem Abend hinderte ihn allerdings etwas Ungewöhnliches daran, sich gänzlich seinem Kummer hinzugeben. Das noch frische Bild von Héloïse Gassien drängte sich immer wieder in sein Bewusstsein. Wie alt mochte sie sein? Dreißig? Etwas älter? Er erinnerte sich genau an ihre zarten Züge. Sie hatte einen gewölbten Leberfleck im Nacken und duftete nach Parfumpuder. Bestimmt war sie eine mutige, willensstarke Frau. Er wies ihr Bild von sich, es würde den folgenden Tag nicht überleben. Bald würde es sich in den Grenzregionen seines Gedächtnisses zu den Erinnerungen gesellen, die von seinem Willen, sich zu schaden, erstickt worden waren. Seit er allein lebte, übermannte ihn manchmal heftiges Begehren, aber der Impuls scheiterte, denn nichts durfte seine Sylvana-Träume stören. Als hartnäckiger König des Unglücks blieb Étienne ein Reisender im Transit, besessen von der Angst, den Anschluss zu verpassen, der ihn nach Hause zurückbringen würde.
3
»Was treiben Sie da?« Adélaïdes Stimme zerstörte die wohlige Stille des japanischen Saals.
Étienne sah sie rennen, hinter ihr Arnaud Stip. Er stand auf, verabschiedete sich ausführlich von seiner Geisha und folgte den anderen in den Lichtersaal.
Dort starrten Ba, Stip und Adélaïde wortlos auf den hellen Fleck, den das Stillleben von Chardin auf der Wand hinterlassen hatte. Das Verschwinden des Glanzstücks des Museums war nicht zu leugnen. Während die drei Angestellten darauf warteten, dass Adélaïde sie entweder fertigmachte oder rehabilitierte, ermaß sie die möglichen Folgen ihrer eigenen Leichtfertigkeit. Sie war wahnsinnig gewesen, die Vernissage ohne Sicherheitsvorkehrungen stattfinden zu lassen. Während ihr die nun bevorstehenden Scherereien bewusst wurden, stellte sie mit Schrecken fest, dass sie keine andere Wahl hatte, als auf die drei instabilsten Spieler ihres Teams zu setzen.
»Ich werde die Polizei verständigen«, verkündete sie in dramatischem Ton und starrte sie nacheinander an. »Sie über die gewaltige Verantwortungslosigkeit unseres Vorgehens zu informieren, würde uns nur schaden. Wir hätten die Polizei verständigen müssen. Ich sollte nicht von ›wir‹ sprechen, da ich die ganze Verantwortung trage. Dennoch sage ich ›wir‹, weil wir vier heute Abend wussten, wie extrem einfach es war, während der Vernissage im Museum einzubrechen. Der Clou ist, dass kein Mitarbeiter außer Ihnen und mir weiß, wie man die Überwachungskameras abschaltet. Aus Sicht der Polypen werden wir deshalb die perfekten Verdächtigen sein. Also halten wir das Maul. Eine Frage noch.«
Sie durchbohrte die drei mit dem Blick.
»Hat einer von Ihnen jemandem von den Aussetzern der Alarmanlage erzählt?« Stip, Ba und Étienne schüttelten den Kopf.
»Den Zustand des Sicherheitssystems werden sie als Erstes überprüfen«, sagte Stip.
»Natürlich«, antwortete Adélaïde wie aus der Pistole geschossen. »Schlimmstenfalls werden sie feststellen, dass etwas nicht stimmte. Bestenfalls werden sie denken, dass der Dieb selbst das Ding deaktiviert hat. Was vielleicht auch stimmt. Daher müssen wir unbedingt das Maul halten. Noch eine Frage.«
Die Direktorin lief in einem merkwürdigen Stechschritt auf und ab.
»Hat einer von Ihnen den Chardin gestohlen?«
Stip verdrehte die Augen, Ba lächelte, und Étienne seufzte.