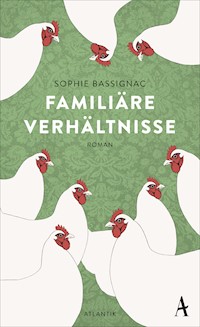16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Paris kurz vor Weihnachten. Es schneit unaufhörlich. Doch sehr weihnachtlich ist es bei Max und Raphael nicht. Die Cousins, die als Filmausstatter und Restaurator arbeiten, leben erst seit kurzem in der Wohnung, haben sie aber im Handumdrehen in eine originelle Rumpelkammer und Party-Zone verwandelt. Bei ihnen geht die Pariser Bohéme ein und aus, die sich von ihrem kreativen Chaos angezogen fühlt. Nach allerlei Liebeswirren - warum verliebt man sich eigentlich immer in die Falschen? - markiert das nahende Silvesterfest einen Neuanfang für alle. Eine charmante Komödie mit Tiefgang, die über die Liebe, das Leben und die Wärme in einer kalten Winternacht erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Ähnliche
Sophie Bassignac
Das Leben ist zu bunt für graue Tage
Roman
Aus dem Französischen von Claudia Steinitz
Atlantik
Für Éric und Alban
1
Ein leichter, aber eisiger Sprühregen bedeckte die Schultern der Passanten mit silbernen Pailletten. Cécile kam es so vor, als klebte ihr die duftende Föhnfrisur wie nasses Papier an den Schläfen, und sie blieb vor dem Schaufenster eines Immobilienmaklers stehen. Beruhigt, dass die rotbraune Lockenpracht noch unversehrt war, ging sie weiter und hüstelte, um ein winziges Haarknäuel loszuwerden, das ihr Zäpfchen reizte. Das dürftige Trinkgeld im Sparschwein der Praktikantin, die ihr die Haare gewaschen hatte, war ein zusätzliches Ärgernis. Sie fragte sich, woher diese gelegentliche Knausrigkeit kam, die sie jedes Mal bereute. Das war umso schäbiger, da sie die zwei Stunden liebte, die sie jede Woche in dem überheizten Boudoir verbrachte, wo Claude, der Figaro des Viertels, nie vergaß, über ihr »unglaubliches Haar« in Verzückung zu geraten. Während sich die blau tätowierten Arme des Friseurs wie Schlangen um ihr Gesicht wanden, durchblätterte sie, geschmeichelt von diesen seltenen Komplimenten, faszinierende Zeitschriften, die dem Leben ihr unbekannter Berühmtheiten gewidmet waren, und schlürfte dabei grünen Tee. Im Zustand totaler Entspannung lauschte sie dem Friseur, der sich jedes Mal über ihre »unglaubliche« Unkenntnis amüsierte und die Bildunterschriften mit Anekdoten aus erster Hand ergänzte.
Vor sich erkannte sie Max, der über ihr wohnte, an seiner nervösen Gestalt. Er war mit einer Tanne beladen, deren Spitze wie ein Pfauenschwanz den Bürgersteig fegte, außerdem schleppte er einen großen Supermarktbeutel und einen verbeulten Lampenschirm. Sie folgte ihm, wie man an einer Tür lauscht, amüsiert und ein wenig verlegen, ihn heimlich zu beobachten. Die Passanten drehten sich nach ihm um, mit der Tanne konnten sie etwas anfangen, nicht aber mit dem gefalteten Lampenschirm, den er wie ein Armband trug. Sicher wunderten sie sich auch über seine exaltierten Bewegungen, die selbst die schwerste Last nicht gerechtfertigt hätte. Max sah immer so aus, als wollte er sich ein brennendes Kleidungsstück vom Leib reißen. Armer, armer Max, seufzte sie und wandte den Kopf ab. Eine Aufwallung heftiger Sympathie zwang sie, tief die eisige Abendluft einzuatmen. Sie rannte fast bis zum Hauseingang, betrat hinter dem jungen Mann den Innenhof und schob sich nach ihm in den Fahrstuhl.
»Cécile!«, sagte Max, überrascht und halb hinter der Tanne versteckt.
Ihr fiel auf, dass er von vorne etwas ruhiger wirkte.
Obwohl sie sich schon drei Jahre kannten, ergötzte sich Cécile immer noch an der dekadenten und ungewöhnlichen Schönheit ihres Nachbarn. Die eindringlichen schwarzen Augen mit von feinem Pinsel gezeichneten Brauen unter der dunklen, lockigen Mähne, der blasse Teint und der kleine, zarte Mund verströmten, wenn er ruhig war, die Mattigkeit eines schwindsüchtigen Dichters. Doch wenn er sich aufregte, und Max regte sich oft auf, ließ ein unerwarteter, eiserner Wille urplötzlich und wie ein teuflischer Trick die weibliche Sanftheit seiner Züge verschwinden.
Cécile wandte den Kopf ab, wie immer berührt von der Verzweiflung, die sich in der beunruhigenden Zwischenwelt des jungen Mannes offenbarte.
Max drückte auf den Knopf der dritten Etage. An den Spiegel gelehnt, schaute er Cécile von unten an und lächelte freudlos.
»Neue Fundstücke?«, fragte sie und zeigte auf den Beutel, den er vor sich abgestellt hatte.
»Ja, diese Übergardinen habe ich in einem Container auf dem Boulevard gefunden.« Er hielt Cécile den zerknitterten ockergelben Stoff, der mit einer goldenen, stellenweise abgelösten Posamentenborte gesäumt war, unter die Nase. »Riechen Sie das?«
»Was?«, fragte Cécile, etwas angewidert von den schimmeligen Ausdünstungen, die aus der Tasche kamen.
»Frankreich vor fünfzig Jahren! Bürgerliche Einrichtung, vielleicht ein Notar. Der Lampenschirm stammt bestimmt aus derselben Wohnung. Man denkt gar nicht, wie hartnäckig sich Gerüche halten. Sie hängen in der Tiefe von Koffern und Schränken und warten geduldig, dass man sie rauslässt.«
Der Fahrstuhl blieb stehen. Max stieg als erster aus.
»Läuft es gut mit eurer neuen Mitbewohnerin? Ich habe ihren Namen vergessen«, sagte Cécile, während sie in ihrer Tasche nach den Schlüsseln suchte.
»Sie heißt Louise Brouillard. Ich glaube, sie gewöhnt sich an uns und wir uns an sie. Sie ist nett, nur ein bisschen gestopft.«
»Was heißt gestopft?«, fragte Cécile, die ihre Tasche neben dem Ohr schüttelte, um das Klimpern der Schlüssel zu hören.
»Sie verbringt ihre Nächte damit, sich mit offenem Mund alte amerikanische Filme anzusehen. Sie hält sich für Rita Hayworth. Ich übertreibe ein bisschen. Sagen wir, sie vermischt manchmal.«
Cécile verstand nicht immer, was Max sagte. Er erlaubte sich sprachliche Freiheiten, nahm Abkürzungen, die seine Beziehungen zu anderen nicht eben leichter machten. Aber er redete viel, und was man heute nicht verstand, würde er bestimmt am nächsten Tag anders und klarer wiederholen.
»Und Raphael?«
»Es geht.«
Max hatte gezögert. Cécile fragte nicht nach.
»Willst du reinkommen?«
Er schüttelte den Kopf, nuschelte ein hastiges »Guten Abend« und stieg zu Fuß mit seiner Tanne, dem Beutel und dem nicht mehr sehr ansehnlichen Lampenschirm hoch zur vierten Etage.
Cécile schloss die Tür, schleuderte im Flur die Schuhe von sich, ging ins Wohnzimmer und rekelte sich.
»Ich bin kaputt. Total kaputt«, verkündete sie, als müsste sie jemanden in der leeren Wohnung davon überzeugen.
Noch in Mantel und Handschuhen eilte sie in die Küche, riss den Gefrierschrank auf und holte die vereiste Ginflasche heraus. Sie nahm einen ordentlichen Zug und schnalzte mit der Zunge. Dann schlitterte sie auf dem Parkett zum Fenster, von dem sie den besten Blick auf den kleinen Park und auf Raphael hatte, den sie jeden Abend beobachtete, eine Gewohnheit, die in der dunklen Wohnung zum Ritual geworden war.
In der winterlichen Dämmerung glich der erstarrte Garten einem Schwarzweißbild aus den Zeiten der Analogfotografie. Die schwachen, von fahlen Lichthöfen umhüllten Laternen dämpften die Kontraste. Eisiger Nebel verwischte wie ein Schleier die Umrisse der Beete und Bäume. Raphael, Max’ Cousin, saß immer auf derselben Bank und starrte mit äußerster Konzentration ins Leere. Er hatte die Hände tief in die Taschen seiner bis zum Kragen zugeknöpften Jacke gesteckt und verfolgte wohl eine Idee, die vor seinen Füßen kreiste, wie ein Blatt im Wind. Seine langen Haare verdeckten das ausdruckslose Gesicht. Mit dreißig Jahren sah er aus wie zwanzig. Seine etwas groben, kindlichen Züge erweckten bei Cécile stets den Eindruck, er arbeite sorgfältig den Rosenkranz der Gewissensbisse ab, die er später hinter sich lassen würde. Sie hatte ihn genauso gern wie Max. Der altmodische poetische Riese bestreute die Welt mit seiner feinen Intelligenz wie mit Konfetti. Er hatte den Mut, anders zu sein, und sie hatte allen Grund, darin etwas Kostbares zu sehen.
Während sie am Fenster stand, zog Cécile den Mantel aus, ohne Raphael aus den Augen zu lassen. Sie fragte sich, ob Max auch am Wohnzimmerfenster stand und darauf wartete, dass sein Cousin endlich nach Hause kam. Als ihn der Parkwächter ansprach, klappte Raphael seinen langen, gebeugten Körper auseinander, ging langsam zum Zaun und verschwand aus ihrem Blickfeld. Wenige Minuten später hörte sie in der vierten Etage die Tür knallen und verfolgte Raphaels Schritte, dumpfer als die von Max, auf dem Flurparkett bis in sein Zimmer, das über ihrem Schlafzimmer lag.
Sie ging wieder in die Küche, nahm sich ein Fertiggericht aus dem Gefrierschrank und stellte es in die Mikrowelle, dann packte sie einen Stapel Hausarbeiten aus, den sie widerwillig betrachtete.
»Ich bin kaputt!«, wiederholte sie in Richtung Decke, den Kopf in den Nacken gelegt und mit hängenden Armen.
Seit ein paar Monaten wollte Cécile immer nur schlafen. Immer und überall verspürte sie das Bedürfnis, alles sausen zu lassen, das sie zu ihrem Ärger in ein schlaffes, unnützes Etwas verwandelte. Sie schämte sich ihrer Mattigkeit und widerstand, so gut sie konnte, dem Schlaf, jenem dunklen und hinterlistigen Kontinent, dem man seine Seele nicht mehr als sechs oder sieben Stunden pro Nacht überlassen durfte, wie sie meinte.
An jenem Abend hielt sie das Schwarzweißbild von Raphael in der Dezemberdämmerung mehr als sonst gefangen. Sie klebte förmlich an der Seele des jungen Mannes, dachte lange über ihn nach, versuchte ihn zu verstehen, gab auf. Das Ballett von Max’ rhythmischen Schritten über ihrem Kopf und die Hammerschläge, die sie aus Raphaels Zimmer vernahm, lenkten sie endgültig ab. Sie legte die Füße auf die Hausarbeiten, die ihre Schreibunterlage bedeckten, und ließ sich zum x-ten Mal die Anfänge ihrer unglaublichen und wunderbaren Freundschaft durch den Kopf gehen. Sie liebte diese Erinnerungen, die immer abrufbereit waren und die sie sich wie Bonbons auf der Zunge zergehen ließ, ohne je genug davon zu bekommen. Auch Max kam gerne auf ihre erste Begegnung zurück. Er liebte es, von der Bekanntschaft mit der »Durchgeknallten im Morgenrock« zu erzählen, eine Anekdote, die er jedes Mal mit denselben Worten schloss, »das ist nochmal gutgegangen«, die sie als Würdigung empfand. Ihre Geschichte hatte tatsächlich sehr schlecht angefangen.
Max und Raphael waren drei Jahre zuvor in die Wohnung der sehr alt gestorbenen Madame Valette gezogen. Ohne Vorwarnung veranstalteten sie am Abend ihres Einzugs eine wilde Einweihungsparty. Um drei Uhr morgens zog Cécile den Morgenrock an, den Kopf voller Drohungen, die sie sich schon den ganzen Abend wiederholt hatte, und klingelte im vierten Stock. Max erklärte ihr ganz ruhig, sie solle besser darauf verzichten, die Polizei zu rufen, da eine große Menge Betäubungsmittel in der Wohnung im Umlauf seien. Cécile war wie vor den Kopf gestoßen von der Dreistigkeit des zarten und verführerischen jungen Mannes mit seinen merkwürdigen Zuckungen, die sie den Aufputschmitteln zuschrieb. Sie kehrte in ihre Wohnung zurück, ohne von ihm irgendeine Zusage erhalten zu haben. Als am folgenden Sonntag aus der Wohnung Baulärm und laute Rockmusik kam, wiederholte sie ihre Bemühungen, ohne großen Erfolg, diesmal über die Sprechanlage, um sich nicht vom Charme der neuen Hausbewohner einlullen zu lassen. Niedergeschlagen von deren Unnahbarkeit dachte sie schon daran, Immobilienmakler in der Umgebung anzurufen, um ihre Wohnung zu verkaufen und dem Chaos zu entfliehen.
Eine an ihre Tür geklebte Einladung zum Abendessen mit einer kleinen Zeichnung, die sie selbst mit einem Lächeln darstellte, änderte die Situation. Misstrauisch, aber voller Neugier nahm sie die Einladung der Ruhestörer an.
Als sie mit einer Flasche Champagner bewaffnet und fest entschlossen, die Burschen zu zähmen, deren Wohnung betrat, hielt sie verblüfft inne. Die neuen Bewohner hatten sie gründlich verändert. Schon in der Diele fiel ihr entsetzter Blick auf ein großes, mit Tusche geschmiertes Gesicht an der teuren japanischen Tapete der letzten Bewohnerin. Den Salon der alten Dame hatte Cécile als geräumigen, vor Sauberkeit blitzenden Raum in Erinnerung, der das ganze Jahr nach Bohnerwachs und Suppe roch. Nun waren die in Blattgold gerahmten Bilder, die polierten Möbel und die handgestickten Deckchen unter dem unglaublichen Durcheinander eines Schrotthändlers oder Trödlers, unter Bergen von Plunder und ausgeleerten Werkzeugkästen verschwunden. Das Parkett und die Teppiche, früher sorgfältig gepflegt, hatten ihren Glanz und ihre Farben verloren und waren mit einer dicken Schicht aus grauem Staub und Hobelspänen bedeckt. Das gemütliche und altmodische Heim der alten Valette hatte sich in eine Hobbywerkstatt verwandelt und war nicht wiederzuerkennen.
Beim Essen erfuhr Cécile, dass die jungen Männer Cousins waren und die alte Valette ihre Großmutter mütterlicherseits. Ruhig und viel erwachsener, als Cécile erwartet hatte, stellten sie sich nacheinander vor. Sie versuchte, die Zuckungen zu ignorieren, die Max’ Gesicht entstellten, während er ihr seinen Beruf als Filmrequisiteur erklärte. Für Raphaels Beruf gab es keine Bezeichnung. Als Allroundbastler arbeitete er für Antiquitätenhändler und Privatpersonen. Mit sanfter Stimme, wie früh am Morgen, wenn man gerade aufgestanden ist, erklärte er ihr den Mechanismus einer wundervollen Puppe aus einem Parfümgeschäft der zwanziger Jahre, die sich ohne Pause mit einer Puderquaste über das Gesicht strich. Danach hob er eine Glaskugel hoch, damit sie mit dem Finger winzige ausgestopfte Vögel berühren konnte, die auf zarten, zierlichen Zweigen saßen. Endlich erkannte sie Sinn, Ursache und Notwendigkeit der Geräusche, die sie seit Wochen ertrug. Bis zum Ende der Mahlzeit hörten die beiden ihr aufmerksam zu und hielten sich selbst nicht zurück. Um Raphaels leisen, sorgfältig formulierten und poetischen Sätzen, seiner ruhigen Dreistigkeit und der absoluten Einmaligkeit seiner Ansichten zu folgen, musste man gut aufpassen. Als sie Max beobachtete, wurde ihr klar, dass sie bei ihm jeden Zynismus unterdrücken und seine ambitionierten und heiteren Äußerungen, seine mädchenhafte Erscheinung und seine jungenhafte Gestik einfach hinnehmen musste. Cécile erzählte von ihrem Beruf. Sie verschonte sie mit ihrem Wissen, aber die beiden begriffen, dass hinter der Bescheidenheit eine brillante und gefragte Dozentin steckte, die nur die Doktorarbeiten der Besten betreute. Beim Nachtisch und ohne Grund verkündete sie ihnen, dass sie vierundfünfzig sei.
Ehe sie aufbrach, schenkte ihr Raphael eine kleine Mandarinente aus Jade, das Symbol ewiger Liebe, erklärte er, als er sie ihr mit beiden Händen überreichte.
An jenem Abend, der ihr Dreierbündnis besiegelte, beschloss sie, den Krach zu überhören, und schwor ihren Nachbarn insgeheim die Treue. Sie hatten einen eigenwilligen Charme, und das war für eine Frau, die seit Jahrzehnten gegen die Klischees und Phrasen von Generationen konturloser Studenten ankämpfte, schon etwas wert. Sie passten nicht zu der selbstverliebten, zynischen Jugend, deren Reden denen von Teleshop-Verkäufern ähnelten und die sie ebenso hasste wie ihr amerikanisches Lächeln. Max und Raphael erahnten ihrerseits die keineswegs harmlosen Winkel und Windungen hinter dem dunstigen Gingeruch, der ihre Nachbarin begleitete.
Und so entstand aus der Zufälligkeit einer Nachbarschaft und der städtischen Magie, die Wege ändern und alle Pläne durchkreuzen kann, plötzlich eine unverhoffte Freundschaft.
Cécile legte sich leicht betrunken in ihr Gästezimmer, den Zufluchtsort für Abende, an denen es bei den Nachbarn laut war.
Wie ein Mantra flüsterte sie ihren alten Säuferschwur, zurückhaltender mit dem Gin umzugehen, dann wurde sie von Raphaels fernen Hammerschlägen und dem gleichmäßige Klappern der Absätze von Louise Brouillard in den Schlaf gewiegt.
2
Der lautlos über Nacht gekommene Schnee hatte eine dichte, blendend weiße Decke über die Bänke des kleinen Parks gelegt, Fahrbahn und Bürgersteig eins werden und alle Feinheiten verschwinden lassen. Louise stand am Fenster und bereute, dass sie ihre Schneestiefel in Bordeaux gelassen hatte. Nachdem sie sich ein paarmal gedehnt hatte, fiel ihr auf, dass die Wohnung völlig still war. Das beunruhigte sie, weil sie sich noch nicht berechtigt fühlte, allein dort zu sein. Ihr Vater, ein alter Bekannter von Max’ Mutter, hatte sie geradezu genötigt, dort einzuziehen, bis die Untervermietung zustande käme, die ein Freund aus ihrem Stepptanzkurs versprochen hatte. Schon bei der Ankunft wurde Louise klar, dass man den beiden Bewohnern ihre Anwesenheit aufgezwungen hatte. Sie hatte sich sehr unbehaglich gefühlt und mehrere Tage gewartet, ehe sie sich entschloss, ihre Koffer auszupacken. Außerdem, und das machte die Sache nicht besser, waren Max und Raphael äußerst irritierende Persönlichkeiten. Raphael lebte schweigsam und konzentriert in seinem eigenen, unzugänglichen Bereich. An seine Tischplatte gefesselt und über seine oft minutiöse Arbeit gebeugt, war er ein regungsloser Pfeiler, den nichts von seinem Platz lösen konnte. Max hingegen rannte von früh bis spät in alle Richtungen, ein Kreisel in ständiger Bewegung. Mitgerissen von seiner koboldhaften Leichtigkeit und dem elektrisierenden Schwung hatte Louise ihn zunächst für etwas gehalten, das er nicht war. Für einen jungen Mann von beunruhigender Schönheit, ein Kind seiner Zeit, mit dem sie ihre Abende plaudernd in den umliegenden Bars verbringen würde. Sie war aber rasch ernüchtert, denn der gelockte Erzengel war noch seltsamer als sein Cousin. Der schöne Max, mit Koks gedopt und durch nervöse Zuckungen entstellt, unterwarf sich diversen Ritualen, die er nicht mal zu verbergen suchte. Seine Energie floss in akzeptierte Neurosen, die sein ganzes Leben beherrschten. Er war heiter aus Trotz und großmäulig aus Verzweiflung. Erst wenn ihn die Müdigkeit überwältigte und er nichts mehr für sich selbst tun konnte, schien er die Anwesenheit der anderen zu bemerken und widmete sich ihnen mit einer Hingabe, die sie rührend fand.
So lernte Louise seit mehreren Wochen, sich zwischen der schweigsamen Reglosigkeit des einen und dem unsinnigen Gezappel des anderen zu bewegen. Meistens kommunizierten sie, ohne miteinander zu reden und ohne sich anzuschauen, nach einer festgelegten, aber unlesbaren Choreographie. Louise war in einer lärmenden Familie aufgewachsen, wo die Sätze ohne Belang und ohne Folgen herausschossen, hier musste sie improvisieren und bei den Cousins auch das plötzliche, unangekündigte Verlangen nach Einsamkeit entschlüsseln. Manchmal ertrug sie das Schweigen nicht länger und öffnete die Schleusen, ohne sich um die Folgen zu kümmern, aus reinem Selbsterhaltungstrieb. Die Männer lauschten ihrem Monolog nicht völlig gleichgültig, aber mehr höflich als interessiert. »Ich langweile euch«, sagte sie lachend, und sie wandten sich ihr zu, als bemerkten sie plötzlich ihre Anwesenheit im Raum. Louise hatte sich das alles anders vorgestellt und fühlte sich sehr einsam.
Dennoch bewahrte sie die Hoffnung auf eine mögliche Verständigung, weil eine unausgesprochene Gemeinsamkeit sie vereinte. Alle drei waren verfehlte Künstler, Satelliten im Schlepptau der Fantasie von anderen, die begabter waren als sie. Louise wusste, dass ihren Mitbewohnern das Künstliche ihrer Projekte ebenso wenig entgangen war wie die Zweifel, die sie schlecht hinter ihrer armseligen Hartnäckigkeit verbarg, und sie setzte auf die Gemeinsamkeit ihrer Mühsal, um ihren Platz in dieser Wohngemeinschaft zu finden.
Sie machte ein paar pas chassés bis zur Küche, wo sie auf Raphael stieß, der dösend seinen Kaffee trank. Überrascht, ihn dort zu treffen, entschied sich Louise, die alles bedenken musste, für diskrete Zurückhaltung und bereitete lautlos ihr Frühstück zu. Max’ Schönheit war erträglich, die von Raphael, der an jenem Morgen in hartnäckiger Träumerei verharrte, jedoch von einschüchternder Seltsamkeit. Bei ihm machte Louise zum ersten Mal im Leben die Erfahrung des absoluten Andersseins. Kein Bezugspunkt konnte sie leiten, es gab kein Muster, keine brauchbare Erinnerung, um zu wissen, wie sie mit ihm umgehen sollte.
Raphael schaute auf den fallenden Schnee, als wäre er allein. Louise, zum Schweigen verurteilt, beobachtete ihn verstohlen und dachte, dass die große Sanftmut dieses Mannes seine Absenzen erträglich machte. Er war da, offen und ungeschützt, ohne Boshaftigkeit, ohne Hinterlist. Seine langen Hände mit den knochigen Fingergliedern hingen an zu dünnen Handgelenken. Seine Finger streiften, ohne zu berühren, und nahmen, ohne zu halten. Aber sobald er sich an die Arbeit setzte, verwandelten sich seine Hände in unerbittliche Präzisionsinstrumente. Raphael war für Louise ein fremdartiges, elegantes Wesen, das die trivialen Pflichten der Realität nur erledigte, um sich am Leben zu halten.
Plötzlich nahm er ihre Anwesenheit wahr und drehte sich um, allmählich bezog sein friedliches Lächeln Louise in sein Umfeld ein. Sie spürte sofort die Wichtigkeit und Zerbrechlichkeit dieses ungewöhnlichen Gesprächs unter vier Augen und zwang sich, durchsichtig zu werden, ihm den Raum zu überlassen, den er brauchte, um zu sprechen.
An jenem Morgen erzählte er ihr fast ohne Pause von seiner Kindheit mit Max. Sie waren wie Brüder bei ihren Müttern aufgewachsen, unzertrennlichen Zwillingen, austauschbaren Frauen ohne jeden Besitzinstinkt. Die Valette-Schwestern waren mehr als dreißig Jahre lang als Gewandmeisterinnen beim Film ein unverzichtbares Paar gewesen. Max und Raphael, ebenfalls austauschbar und nie getrennt, lebten zwischen Kostümen, Stoffballen und Notizbüchern, an deren Seiten Stoffmuster geheftet waren. Raphael redete lange, und Louise hörte ihm zu, ohne ihn zu unterbrechen. Dann schloss er den zauberhaften Exkurs, wie er ihn eröffnet hatte, sanft und ohne richtigen Abschluss.
Cécile fragte sich, wie man bei den Fortschritten der Orthodontie noch so ein Gebiss haben konnte. Die neue Mitbewohnerin, die sie ziemlich hübsch fand, wurde, sobald sie lächelte, durch ein furchtbares Pferdegebiss entstellt.
»Eigentlich liebe ich den Schnee, das ist immer ein Ereignis. Aber heute passt es nicht!«, sagte Louise. »Ich gebe sie Ihnen heute Abend zurück«, fügte sie hinzu und stellte Céciles Wanderschuhe neben sich. »Es ist wirklich nett, dass Sie sie mir borgen. Das Casting ist sehr wichtig für mich, und ich möchte nicht mit Eisfüßen tanzen.«
»Kein Problem«, sagte Cécile, die von den Erklärungen und Entschuldigungen der jungen Frau allmählich genug hatte. »Ich brauche sie nicht. Ich habe sie mir vor zehn Jahren gekauft, um nach Compostela zu gehen.«
Louise war auf Anraten von Raphael zu Cécile gekommen. Sie kannte sie kaum, aber die Dringlichkeit ihres Anliegens hatte sie schließlich bewogen, ihr diesen Besuch abzustatten. Am Tag nach ihrem Einzug hatte Max die beiden an der Haustür kurz einander vorgestellt, und Louise war nicht sehr angetan gewesen von der dicklichen rothaarigen Frau, die im Fahrstuhl einen berauschenden und altmodischen Geruch hinterließ. Seither hatten sie sich fast jeden Tag mit einem floskelhaften »Guten Morgen« oder »Guten Abend« begrüßt. Nun war sie ganz überrascht von der entwaffnenden Liebenswürdigkeit der Nachbarin, die sie für arrogant gehalten hatte. Cécile hatte sie in ihrem Wochenendlook, einem eleganten cremefarbenen Jogginganzug, empfangen. Ihre üppige Sinnlichkeit und leichte Körperfülle wirkten wie eine Wärmequelle auf Louise, die sich nicht losreißen konnte. Die Nachbarin sprach temperamentvoll und schüttelte dabei ihr lockiges Haar. Muntere Augen und unzählige Sommersprossen belebten die etwas schlaffen Gesichtszüge. Max hatte ihr erzählt, dass Cécile allein lebte, das wunderte sie. Sie hat den Charme einer Frau, die geliebt wird, dachte sie.
»Sind Sie gläubig?«, fragte Louise.
»Gläubig! O nein! Ich habe mich höchstens dem Sport zuliebe auf diese Wandergeschichte eingelassen. Wie schrecklich! Ich würde es um keinen Preis wiederholen«, sagte sie lachend. »No Sports! sagte schon Churchill.« Sie warf ihren schweren Pony zurück und zündete sich eine Zigarette an. »Läuft’s gut da oben?«, fragte sie und verdrehte die Augen in Richtung Decke.
»Ja, ja. Ich merke allmählich, dass sie die ganze Zeit arbeiten.«
»Ach so! Umso besser!«
»Max hat einen Auftrag für die Ausstattung eines Kurzfilms, und Raphael ist heute Nachmittag mit jemandem verabredet, der ein Gemälde restauriert haben möchte.«
»Bestens«, sagte Cécile mit einer Zufriedenheit, als hätte sie für Ordnung gesorgt.
»Machen Sie sich Gedanken um sie?«, fragte Louise.
»Ja und nein. Wie geht es mit Raphael?«
»Er fängt gerade erst an, mit mir zu reden. Sie sind beide etwas seltsam«, sagte Louise lachend. »Sie leben in dieser Wohnung wie auf einer winzigen Insel mitten im aufgewühlten Meer. Wenn sie die Tür aufmachen, habe ich immer den Eindruck, dass sie von einem Kriegsschauplatz zurückkommen.« Sie lächelte. »Ich verstehe ihre Beziehung nicht richtig. Sie sind wie Tag und Nacht. Aber ich könnte Ihnen nicht sagen, wer der Tag ist und wer die Nacht. Ich wollte Sie etwas fragen.«
»Was denn?«, ermunterte sie Cécile.
»Haben sie keine Freundinnen? Ich meine richtige Freundinnen?«
Das Liebesleben von Max und Raphael war für Cécile unergründlich. Sie hatte im Fahrstuhl zwei oder drei Mal Mädchen getroffen, aber Max hatte sich nicht die Mühe gemacht, sie ihr vorzustellen. Sie verschwanden mit dem Morgen, und man sah sie nicht wieder. Raphael hingegen schien wie ein Mönch zu leben. Cécile hatte keine Lust, Louise zu verraten, dass sie auch nicht mehr wusste, und entschied sich für eine sibyllinische Antwort.
»Mit der Zeit werden Sie es verstehen. Es steht mir nicht zu, Ihnen zu antworten. Und Sie? Erzählen Sie von sich!«, bat sie fröhlich.
Louise gefielen die funkelnden Augen und die ehrliche Aufmerksamkeit der Nachbarin. Sie erzählte ihr, dass sie an Castings für Werbespots teilnahm. Ermutigt durch Céciles Nicken, kam sie auf ihren Traum: eine musikalische Komödie über Rita Hayworth, ihr Idol und ihre fixe Idee.
»Rita Hayworth?«, fragte Cécile überrascht.
Zu der amerikanischen Schauspielerin fiel ihr nicht viel ein. Sie erinnerte sich vage, dass sie mit Ali Khan verheiratet und an Alzheimer gestorben war. Sonst war Cécile immer diejenige, die alles wusste, und sie freute sich über diesen Rollenwechsel.
»Die Lady von Schanghai, Gilda. Erinnern Sie sich an Gilda?«
»Dunkel«, gab sie zu und verzog etwas ratlos das Gesicht.
»Put the blame on Mame, boys«, trällerte Louise fröhlich mit einer sehr annehmbaren englischen Aussprache und kratzte dabei auf den Saiten einer unsichtbaren Gitarre.
Sie stand auf und stellte sich mitten ins Wohnzimmer, nachdem sie mit dem Fuß den Kelim beiseitegeschoben hatte, der das Parkett bedeckte.
»Haben Sie fünf Minuten?«
»Ich habe alle Zeit der Welt!«
»Dann zeige ich es Ihnen.« Louise spreizte leicht die Beine und stemmte die Hände in die Hüften. Sie überlegte mit gesenktem Kopf. »Nein, ich werde Ihnen nicht Gilda vorspielen, das kennen alle. Aber Rita Hayworth war eine unglaubliche Tänzerin, das wird leicht vergessen und genau das interessiert mich.« Louise bauschte ihre langen schwarzen Haare auf, schüttelte den Pony und holte mit geschlossenen Augen tief Luft. »Versuchen Sie, sich die Szene vorzustellen«, sagte sie. »Latino Swing, Xavier Cugat und sein Orchester, Fred Astaire und Rita. Er cool, ganz in Weiß, sie in kurzem Plisseerock, Socken und Schuhe zweifarbig. Stellen Sie sich die vierziger Jahre vor, die Lust, sich zu amüsieren, um den Krieg zu vergessen.«
Cécile hatte es sich auf dem Sofa bequem gemacht und versuchte, sich zu konzentrieren.
»Ich leg los«, sagte Louise.
Sie trat auf der Stelle, um in den Rhythmus zu kommen, dann fing sie an, über das Wohnzimmerparkett zu steppen.
Etwas besorgt sah Cécile sie durch das Zimmer wirbeln und in wenigen Sekunden verblüffende Schrittfolgen ausführen. Sie trommelte mit Händen und Füßen, zeigte ihr Pferdelächeln und strahlte vor Glück.
»Jetzt«, sagte sie und warf den Kopf zurück, »muss man sich ein Pas de deux mit Fred vorstellen.«
Louise umschlang ihren imaginären Partner und drehte sich in seinen Armen um das Sofa, beide in perfektem Einklang. Sie ließ ihn los, steppte wild auf der Stelle, die Knie tief gebeugt, eine komplizierte und brillante Tanzfigur. Wie in einem Trickfilm blieb ihr Oberkörper reglos, während die Beine virtuose Figuren ausführten.
»Ritas Arme sind ihre Schwäche, aber auch das, was sie menschlich macht«, flüsterte Louise, während sie ihre ausgebreiteten Arme leicht anwinkelte. »Rita tanzt, als wäre es ganz einfach. Ich weiß nicht, ob Sie das spüren«, fügte sie hinzu, während sie sich auf der Stelle drehte. »Sie ist sehr talentiert, denn eigentlich lähmt sie das Lampenfieber, aber Fred ist mit ihr zufrieden, er findet sie toll. Man sieht ihr weder die Angst noch die Überwindung an, sie ist einfach nur ein Mädchen, das sich amüsiert. Da nimmt er sie wieder in die Arme. Eng umschlungen gleiten sie gemeinsam von der Bühne.«
Louise hielt inne. Atemlos stützte sie die Hände in die Hüften.
»Wunderbar!«, rief Cécile und klatschte.
Louise schüttelte den Kopf.
»Es fehlen die Musik und die Steppschuhe, das ändert alles. So ist es wie ein Film ohne Ton.«
»Sie haben Talent«, versicherte Cécile.
»Ja, ich glaube.« Louise seufzte. Sie griff nach den Wanderschuhen, dankte Cécile und ging, immer noch außer Atem, Richtung Tür. »Gilda zeige ich Ihnen ein anderes Mal.« Schon im Treppenhaus sagte sie: »Beinahe hätte ich es vergessen. Die Mütter von Max und Raphael kommen heute Abend zum Essen. Die Jungs wollen wissen, ob Sie auch kommen.«
»O nein! Nicht die Hanni-Bannis«, sagte Cécile und fasste sich an die Stirn.
»Die was?«
»Hanni-Bannis. Das ist der Spitzname, den sie ihren Müttern verpasst haben.«
»Tag und Nacht und Hanni-Bannis. Das ist komisch! Haben Sie keine Lust zu kommen?«