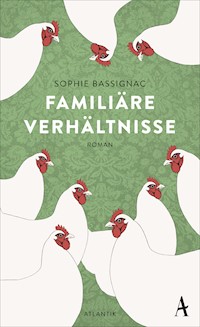10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
"Wer Sophie Bassignac liest, geht das Risiko ein, in den eigenen Augen liebenswert zu werden." Grégoire Delacourt Ein spannender und feinfühliger Roman über die Kunst, mitten im Leben neu anzufangen und die Dinge mutig zu verändern. Was antwortet man einem Unbekannten, der einen um den einen Grund bittet, am Leben zu bleiben? Lucies erste Reaktion ist die Flucht. Doch dann entschließt sie sich, Alexandre, wie der Unbekannte heißt, ein richtig gutes Angebot zu machen: Sie, die ein weltweit erfolgreiches Marionettentheater leitet, nimmt den lebensmüden Alexandre als Stimme für ihre Star-Marionette in ihr Theater auf. Aber kann man jemandem vertrauen, der nicht mehr leben will? Lucies Entscheidung hat weitreichende Folgen, die ihr Leben schon bald aus den Fugen geraten lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 208
Ähnliche
Sophie Bassignac
Verrückt genug fürs Leben
Roman
Aus dem Französischen von Claudia Steinitz
Atlantik
1
Nie im Leben wäre ich freiwillig und ohne Grund in diesen amerikanischen Blockbuster gegangen. Aber der Grund war da. Es war sogar sehr dringend. Mein Freund Dominique André hatte an den Spezialeffekten dieses Hollywoodschinkens mitgearbeitet, und wir würden uns ein paar Tage später bei einem Kolloquium treffen. Ich konnte ihm wahrhaftig nicht unter die Augen treten und zugeben, Venus backwards noch nicht gesehen zu haben, das war der Film seines Lebens, der die Hauptstadt seit zwei Monaten wie eine ansteckende Krankheit fiebern ließ. Ich konnte mich auch schlecht damit herausreden, dass ich die Menschenmassen nicht mehr ertrug, die sich in Museen, Theatern und Kinos drängten. Dabei war da durchaus etwas dran. Ich habe ein echtes Problem mit Pflichtterminen. Schlange stehen demütigt mich, und die fröhliche Menge stört mich. Einhelligkeit nervt mich ebenso wie kalkulierter Erfolg, Lärm und Popcorn. Alle regen sich über meine Verweigerung auf und erinnern mich bei jeder Gelegenheit daran, dass ich mich über so eine allgemeine Begeisterung freuen sollte, weil ich als Erste davon profitiere. Das stimmt, ich bin eine Künstlerin, die seit Jahren die Theatersäle mit genau dem Publikum füllt, das sie unter anderen Umständen geflissentlich meidet. Wenn die wüssten, wie ich mich nach dem Zufall zurücksehne, der früher kleine, ziellose Grüppchen in den schlecht beleuchteten und schlecht beheizten Kaschemmen stranden ließ, wo ich mich mit meinen Marionetten produzierte. Alle denken, der Erfolg sei ein sicheres Guthaben, und wenn man es einmal ergattert habe, müsse man es nur noch gewinnbringend anlegen, ohne an irgendetwas zu zweifeln. Inzwischen lasse ich sie reden, ich habe mir angewöhnt, solche Erwägungen gegenüber den Kritikern für mich zu behalten. Ich muss den Leuten nicht mehr begreiflich machen, dass die ambivalenten, nie geklärten, nie beruhigten Gefühle zwischen Leidenschaft und Hass, die ein Künstler der Menge entgegenbringt, kein Spleen reicher Leute sind.
Vielleicht ist es blöd, aber ich gehe nicht mehr ins Theater oder ins Konzert, ich kaufe mir die Kataloge der Ausstellungen, anstatt sie zu besuchen, und habe mir angewöhnt, Kinofilme zu Hause anzuschauen, wenn sie endlich im Fernsehen laufen. Ich pfeife darauf, gleich am ersten Tag im großen Saal dabei zu sein. Im Gegenteil. Der Abstand entlastet sie von den hochtrabenden Bewertungen, die beim Filmstart auf sie niedergehen. Er beraubt sie ihrer Superpower, befreit sie von der Aufgabe, mein Leben zu verändern, und ich sehe in ihnen das, was sie sind.
Wie dem auch sei, mir Venus backwards anzutun war eine Pflicht, die ich mir aus Freundschaft zu meinem alten Freund auferlegte. Ich hatte es zwei Monate lang hinausgeschoben und schließlich beschlossen, die 18-Uhr-Vorstellung am 31. Dezember sei eine erträgliche Notlösung. Ein paar Stunden vor Silvester hatte ich wenigstens die Gewissheit, meinen Film in einem leeren Kino zu sehen. Wie erwartet war ich allein im Saal. Das endlose Werbechaos war dadurch noch absurder, wie ins Leere geschossene Pfeile. Zwischen zwei für niemanden gebrüllten Spots kam eine Gestalt in dunklem Mantel den Gang herunter und setzte sich neben mich. Auf einen Schlag begann mein zweites Herz anzuschwellen und hart zu werden. Das sitzt bei mir im Magen und erwacht, wenn ich in Panik gerate. Im Halbdunkel, von der Welt abgeschnitten, war ich ganz offenkundig einem Perversen ausgeliefert, einem Avatar der modernen Phantasmen, von denen es in Serien nur so wimmelt und über die ich normalerweise nur lachen kann.
Ich weiß immer noch nicht, was mich in diesem Moment an meinen Sitz neben dieser beunruhigenden Person gefesselt hat. Irgendwas, das nichts mit Angst zu tun hatte, hinderte mich daran, meinen Mantel und meine Tasche zu nehmen und den Platz zu wechseln. Ein Überrest der in der Kindheit erlernten guten Manieren vielleicht, die unverbesserliche Höflichkeit, die uns zwingt, unter allen Umständen den Anschein zu wahren, um die Menschen um uns herum nicht zu verletzen. Und dann, auch wenn es total bescheuert ist, hatte er ein vertrautes Parfum, das wie ein Lockstoff funktionierte. In konzentrischen Kreisen schuf sein Zitronengeruch allmählich eine relative Vertrautheit, eine geradezu schwelgerische Blase. Ständig sortierte der Typ seine Beine neu. Sein Atem pfiff leise. Aus dem Augenwinkel nahm ich ein rundes Gesicht wahr, große dunkle Augen, eine glänzende, hohe Stirn, ein undefinierbares Alter. Seine Person strahlte einen seltsamen Anspruch aus. Als hätte ich mich an ihn geheftet und nicht umgekehrt. Dieser alte junge Mann hielt mich in unwiderstehlicher Abhängigkeit und ignorierte mich dabei total. Ich entspannte mich und überlegte mir, dass unser Duo im Grunde weniger absurd war als zwei Einsamkeiten, die in respektabler Entfernung in einem leeren Saal saßen. Der Film begann mit der blendenden Explosion eines im Weltall verlorenen Raumschiffs, die meine Unruhe, meine Fragen und meinen Nachbarn mit sich fortriss.
Nach dreißig Minuten quälender Achterbahnfahrt durch die Abgründe schwarzer Löcher stand mein Urteil fest. Venus backwards war ein Kinderfilm, ein Videospiel, in dem die Geschichte und die Personen nur dazu dienten, verblüffenden Spezialeffekten Geltung zu verschaffen. Ich hatte genug lobende Kommentare gesammelt, um sie Dominique zu servieren. Ich griff nach meiner Tasche und zog meinen Mantel an, doch als ich aufstand, um zu gehen, packte eine feste Hand meinen Unterarm und verpasste mir vom Kopf bis zu den Zehen einen gewaltigen Adrenalinschub.
»Wir hatten es doch gut, oder? Warum gehen Sie?«
Mein Nachbar sah mich lächelnd an.
Mit einem Ellbogenstoß befreite ich mich aus seiner Umklammerung. Da rief er mit außergewöhnlicher, tiefer und theatralischer Stimme: »Nennen Sie mir einen guten Grund, einen einzigen, mich heute Nacht nicht umzubringen!«
Ohne Witz, solche Sachen passieren im wahren Leben. Und im wahren Leben ist kein Schriftsteller, kein Regisseur da, der dir erklärt, wie du dich verhalten sollst, oder dir sagt, ob es sich um einen Horrorfilm oder eine Komödie, einen Abenteuerroman oder eine Liebesgeschichte handelt. Da uns die Wirklichkeit nur selten die entsprechenden Hinweise unter die Nase hält, wenn wir sie brauchen, fehlte es mir an Schlagfertigkeit. Fassungslos rannte ich hinaus.
Nennen Sie mir einen guten Grund, mich heute Nacht nicht umzubringen! Der Satz des Unbekannten hatte mich wie eine Bombe getroffen und einen alten, unerträglichen Schmerz wieder aufgeweckt. Schweißnass und fassungslos stand ich eine Weile vor dem Kino auf dem Boulevard herum. Ich war nicht mehr da. Ich war nicht mehr in Paris, am Silvesterabend, sondern dreißig Jahre zurückkatapultiert, ins elterliche Wohnzimmer, zum 291987
Ich erinnere mich an die Hitze des Sommeranfangs. Alle Fenster waren geöffnet, um Zugluft zu erzeugen, meine Schwester und ich sahen ungefähr zum zehnten Mal Die tollen Abenteuer des Monsieur L. von Philippe de Broca. Dieses vergessene Juwel hatte neben anderen Qualitäten die erstaunliche Macht, zwei hyperaktive Mädchen länger als eine Stunde zusammen und völlig reglos in einem Zimmer zu halten. Bereit, meine Lachsalve abzufeuern, wartete ich auf meinen Lieblingssatz, den des alten chinesischen Weisen, der Jean-Paul Belmondo fast täglich daran hindert, sich umzubringen. Vor einem nebligen Panorama und nachdem er ihm ein weiteres Mal das Leben gerettet hat, erinnert ihn der Buddha im Zweireiher an die Schönheiten des Daseins und deklamiert mit stark übertriebenem chinesischem Akzent: »Das Leben ist herrlich. Die Frauen, die Vögel, die Dichter, die kandierten Früchte.« Ich liebte diese ebenso absurde wie meisterhafte Aufzählung, die perfekt zu meinen hochtrabenden Teenageransprüchen passte. An jenem Juniabend stürmte kurz vor meiner Kultszene mein Vater ins Zimmer. Seinen weißen Laborantenkittel bis zum Hals geschlossen, stellte er sich neben den Fernseher und sagte lächelnd: »Was könnte mich daran hindern, mich heute Abend umzubringen?«
Er lachte über den guten Witz, dessen Pointe er allein kannte. Dann blieb er noch einen Moment stehen und tanzte von einem Fuß auf den anderen, bevor er hinausging, um sich wieder in seinem Labor einzuschließen. Gebannt von den Bildern hatten wir den Satz meines Vaters für ein Zitat aus dem Film gehalten. Aber er war von ihm. Als meine Schwester Agnès eine Stunde später ihren Roller holte, um sich auf dem Platz mit ihrer Clique zu treffen, fand sie ihn aufgehängt in der Garage.
Ich denke, ich habe diese entsetzlich morbide, im Abstand von dreißig Jahren zweimal gehörte Frage nur ertragen, weil ich fest daran glaube, dass so etwas kein Zufall ist, und weil nirgends geschrieben steht, dass ich sie nicht ein drittes Mal hören werde, morgen oder in zwanzig Jahren. Trotzdem muss ich zugeben, dass ich, die Füße im schmelzenden Schnee aneinandergedrückt, im ersten Moment einen gewaltigen, dumpfen Erdrutsch in mir spürte. Ich konnte mich nicht rühren und blieb auf einer Bank in der Nähe des Kinos sitzen. Die Erinnerungen fielen auf den Boulevard wie trockenes Laub.
Mein Vater war ein kleiner, dunkelhaariger, redseliger und geschäftiger Mann. Er war eine lokale Größe und konnte sich neben dem Bürgermeister als Einziger brüsten, alle Paare unseres Dorfes getraut zu haben. Er hatte ein Geschäft, in dem er Fotoapparate verkaufte und Filme entwickelte. Er machte auch Hochzeitsalben und stellte die besten Abzüge in seinem Schaufenster aus. Ich sehe ihn noch wie ein Gesellschaftsfotograf um seine Königspaare für einen Tag herumwirbeln. Er verlieh den Menschen eine Wichtigkeit, die sie nie wieder erlangen würden, und kam von seinen Hochzeiten so erschöpft nach Hause wie ein Schauspieler nach dem x-ten Vorhang. Manchmal frage ich mich, ob es ihn nicht auf die Dauer verdorben hat, jeden Samstag den schönsten Tag der anderen mitzuerleben.
Meine Schwester und ich hadern seit dreißig Jahren mit dem Tod unseres Vaters. Aber niemals erwähnen wir die möglichen Gründe für seinen Selbstmord. Das liegt wohlgemerkt nicht an mir. Agnès und meine Mutter haben daraus ein Tabu gemacht, einen Taschenspielertrick, ein Illusionswunder, das meinen Vater von der Verantwortung für seinen Tod freispricht, genau so, als wäre er an einer Herzattacke gestorben. Also keine Autopsie und keine schmerzhaften, eingefrorenen Bilder, Gewissensbisse, lästigen Schuldgefühle, kein Bedauern. Die Umstände, einfach nur die Umstände. Kleinigkeiten, Termine, das Wetter, die Umgebung und nichts anderes. Das Leben eines Mannes zwischen Wohnzimmer und Garage auf ein Theaterstück von dreißig Minuten reduziert, und das für immer. Ich habe den Deal akzeptiert, weil es um das Überleben meiner Schwester ging. Auch wenn dieser schändliche Raub der Erinnerungen, die von zwei Verrückten unterschlagene Vergangenheit mich empörten.
In diese Raumzeit gezwungen, drehen sich meine Schwester und ich seither im Kreis. Agnès hört nicht auf, Alternativszenarien zu entwickeln und sich an Drehbuchfragen zu berauschen. Sie sagt, wenn wir an jenem Abend einen anderen Film gesehen hätten, hätten wir den Satz meines Vaters vielleicht ernst genommen. Sie spielt mit unseren Erinnerungen, wirft ihre Knöchelchen in die Luft, fängt sie im Flug auf und schließt die Faust darum. Wer hatte darauf bestanden, dass meine Mutter Die tollen Abenteuer kaufte und nicht Crocodile Dundee? Wer hätte wissen müssen, dass dieser Satz im Film nicht vorkam? Wer hätte am Gesicht meines Vaters ablesen müssen, dass es ihm nicht gut ging? Warum hat er sich nicht am Vortag oder am Tag darauf umgebracht? Weil er wusste, dass der Film die Geschichte eines Mannes erzählt, der sterben wollte? Und so weiter. Wir kommen nicht raus. Eine Verzweigung von aber und wenn, die einen meschugge macht.
Ich hingegen habe eine Theorie, die ich lieber für mich behalte. Sie ist verquer, aber das Leben ist nun mal verquer. Ich habe manchmal das seltsame Gefühl, Sachen auszusprechen, bevor ich sie denke. Mein Gehirn wird zum Resonanzraum, der mich sprechen hört und auf meine Worte reagiert. Warum also sollte mein Vater nicht beschlossen haben sich umzubringen, nachdem er mitten im Wohnzimmer Jean-Paul Belmondo zunächst mit der Absicht imitiert hatte, uns zum Lachen zu bringen? Warum nicht? Solche Sachen kann ich nicht zu meiner Schwester sagen. Sie nimmt alles zu ernst, und ich weiß, dass sie monatelang am selben Knochen nagen kann, bis ihre Zähne stumpf werden.
Noch eine andere, ebenso wichtige Frage wurde nie gestellt. Was hätten wir ihm geantwortet, wenn wir ihn ernst genommen hätten? Wie hätten wir ihn überzeugt, sich nicht in der Garage aufzuhängen? Schnell, schnell! Los, Lucie, Agnès, das Erste, was euch einfällt! Wie ein Geschwindigkeitsspiel, das deine Neuronen durcheinanderwirbelt. Gegen die Uhr antreten, ihn von seinem skandalösen Vorhaben abbringen. Egal was, Hauptsache er lacht. Was hätten wir gefunden? Die Frauen? Die Vögel? Die Dichter? Die kandierten Früchte? Er erwartete etwas von uns, was wir ihm verweigert haben: unsere Aufmerksamkeit. Das ist ein entsetzlicher Gedanke.
Ich habe ihn sofort wiedererkannt, als er an mir vorbeigegangen ist. Er hat sich umgedreht und mich ebenfalls erkannt. Nach meinem blitzartigen Abstieg in die Hölle der Vergangenheit brannte ich vor Neugier auf denjenigen, der mich rücksichtslos hinabgestoßen hatte. Ich nickte ihm zu. Nach kurzem Zögern kam er auf mich zu. Ein Blinzeln lang sah ich seinem Blick an, dass er enttäuscht war. In der Dunkelheit des Kinos hatte er sich mich anders vorgestellt. Kein Zweifel. Ich erkenne in den Gesichtern den jäh zerbrochenen Traum, die davonfliegende Hoffnung, eine schöne Frau vor sich zu haben. Das ist ein Kindertraum, den die Männer ihr Leben lang bewahren, und keiner ist imstande, seine Enttäuschung gänzlich zu verbergen.
Ich bin keine Schönheit, das stimmt, und ich bin fünfundvierzig. Wenn ich mir ein bisschen Mühe geben würde, könnte ich sie hinters Licht führen. Zumindest eine unechte Schöne sein wie meine Schwester oder meine Cousinen, die wie ich den Knochenbau eines Möbelpackers und den platten Hintern geerbt haben, die das Familienwappen auf der mütterlichen Seite zieren, seit es Fotos gibt, um es zu bezeugen. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt: »Lächle, das ist dein größter Trumpf.« Gipfel der Taktlosigkeit. Die Arme ist keine Leuchte, und der Takt war ihr nicht in die Wiege gelegt. Es stimmt, ich habe ein schönes Lächeln, aber ich habe auch schöne Augen, das ist schon etwas. Zum Glück ist das Halbdunkel der Freund der Marionettenspielerin, auf der Bühne leide ich nicht unter meinem fehlenden Charme. Ich nahm seine Enttäuschung zur Kenntnis. Verführung kam also nicht infrage, was mir im Grunde nicht unrecht war.
Etwas verlegen setzte er sich neben mich. Er trug einen marineblauen Mantel, einen schönen bronzefarbenen Schal und am Ringfinger einen erstaunlichen Siegelring mit einem Spiegel. Er war rund. Nicht dick. Eher massiv und wie Männer von früher ein bisschen üppig, ein bisschen bäuerlich und vor Manneskraft strotzend.
Der Körper eines anderen ist eine reich verzierte Festung, von der ich mich ständig inspirieren lasse, um meine Figuren zu entwickeln. Ich beobachte die Körper und ihre Mechanik, denn meine Marionetten sollen die Gesten der Lebenden so getreu wie möglich nachahmen. Manche Menschen wiederholen endlos dieselben Bewegungen, zeichnen die Form ihrer Gefühle in die Luft. Andere verschanzen sich in ihrem Körper, als wollten sie einem Heuschreckenansturm widerstehen. Dann gibt es die, die sich in einem beschränkten Raum bewegen. Ein unsichtbares Gewicht oder eine lästige Zwangsjacke schränken ihre Bewegungen ein. Aus der Sicht des Marionettenspielers sind das die Interessantesten, denn die Feinheit der Geste ist unser Gral. Der Mann aus dem Kino gehörte zu einer anderen, selteneren Familie. Sein verschleimter Atem schien die Mauern zerstören zu wollen, die ihn gefangen hielten.
Einer musste reden, er machte den Anfang.
»Sind Sie das? Haben Sie auf mich gewartet?«
Im Kinosaal hatte mir seine Stimme Angst gemacht. Nun vibrierte sie tief und dunkel wie von einem Virtuosen gestreichelte Cellosaiten. Er hatte die Stimme eines Tragöden, die die Straße mühelos verstummen ließ. Als ich ihn hörte, hatte ich eine Eingebung, jene wahnsinnige Idee, die mich danach für Monate in ein unentwirrbares Chaos gestürzt hat. Begeistert von meiner Geistesgegenwart frohlockte ich auf meiner Bank. Der Mann, der mich gefragt hatte, wie er am Leben bleiben sollte, würde mir helfen, ein akutes Problem zu lösen. Ich dachte nicht mehr an meinen Vater, die Vergangenheit war in ihre Kiste zurückgekrochen. Ich war wieder Lucie Paugham, die Marionettenspielerin, die seit Wochen einen Erzähler für ihr neues Stück suchte. Ich hatte einen anstrengenden Monat lang Bewerber vorsprechen lassen, aber es war nur eine lange Reihe von Enttäuschungen gewesen. Ich muss dazusagen, dass ich mich an einem alten Schauspieler mit betörender Stimme orientierte, der in einer Sendung bei France Culture philosophische Texte las. Ich hatte ihn mehrfach vergeblich angefragt. Nun endlich hörte ich die Stimme meines Erzählers, es war die des Selbstmordkandidaten.
»Ich biete Ihnen ein Geschäft an. Ich brauche einen Mitarbeiter für eine sehr spannende Arbeit.«
Wir stellten uns einander vor. Lucie Paugham, Alexandre Lanier. Dann erzählte ich ihm von meinem Stück und entwickelte in wenigen Worten meinen Plan. »Lächle«, sagt meine Mutter. Ich lächelte. Ich empfand die ruhige Euphorie eines ruinierten Glücksspielers, der auf der Straße eine dicke Geldbörse gefunden hat, die ihm hilft, seine Verluste beim Baccara wettzumachen.
Sparsame Gesten und huschender Blick, der Mann war offensichtlich überrascht von meinem ungewöhnlichen Angebot. Jemandem, der sich umbringen will, macht man nur selten so einen Vorschlag, das gebe ich zu. Ich fügte hinzu, ich bräuchte keinen gestandenen Schauspieler, sondern eine Stimme, seine. Er öffnete den Mund und schloss ihn mit einem leisen Seufzer. Alexandre Lanier hat einen schönen Mund, klein und voll, rosig und feucht. Ein Mädchenmund. Ich erinnere mich, dass ich dachte, er sei weiblicher als ich.
Der Zeiger drehte sich, und ich musste nach Hause. Die Langsamkeit unseres Gesprächs, die Pausen, das Zögern, vor allem seins, regten mich allmählich auf. Wir traten aus der Zeit, aber die Zeit drängte. Ich gab ihm die Adresse meines Ateliers und schlug ihm vor, am nächsten Tag, dem 1. Januar, um 18 Uhr vorbeizukommen. Er stand auf und drückte mir die Hand mit der Festigkeit eines Viehhändlers, der einen Deal besiegelt. Dann schob sich seine massive Gestalt unzugänglich für die allgemeine Festlaune zwischen kleine, bereits angeheiterte Grüppchen, die wie Stehaufmännchen schwankten, und Mädchen mit vergoldeten Lidern und langen Kleidern unter den Alltagsmänteln. Schließlich war er verschwunden, aufgesogen von der Menge, und ich dachte, dass ich ihn vielleicht zum letzten Mal gesehen hatte.
Ich war spät dran, und Philippe erwartete mich mit den Schlüsseln in der Hand, um loszufahren. Ich erzählte ihm nichts von meiner Begegnung mit Lanier. Ich spürte bereits die Absurdität meiner Entscheidung, und in Sachen Logik kennt mein Mann kein Pardon. Im Auto wollte mich mein Sohn Louis für Venus backwards begeistern, er war ein absoluter Fan. Meine Tochter Véga schmollte und scrollte hektisch durch ihren Instagram-Account. In irgendeinem Haus in der Banlieue lief die Party ohne sie auf Hochtouren, das war ein Albtraum. Ich erinnere mich sehr genau, was ich in diesem Moment empfunden habe, in der Wärme unseres Autos, das angenehm nach uns allen roch. Ich empfand das seltsame, paradoxe Vergnügen, ein Geheimnis nicht mit denen zu teilen, die man liebt.
2
Es war das Jahr meiner Schwester. Wir feiern Silvester abwechselnd bei mir und bei ihr. Wenn Agnès an der Reihe ist, uns zu empfangen, wissen wir, dass wir einen schönen Abend verbringen und vor allem gut essen werden, denn Kochen ist ihr Beruf. Sie hat ein Restaurant in einer Fußgängerzone im 15. Arrondissement, das immer ausgebucht ist. Wie schon erwähnt, ist meine Schwester sensibel. Ein paar Monate nach dem Drama waren bei ihr die Sicherungen durchgebrannt, die seit ihrer makabren Entdeckung in der Garage geschmort hatten. Am Tag des mündlichen Abiturs hatte Agnès vor einem verstörten Lehrer, puterrot und schnaufend wie ein Ochse, nacheinander ihre Kleidungsstücke abgelegt und am Ende in Slip und BH im Prüfungsraum gestanden. Sie wurde aus dem Verkehr gezogen und irrte dann jahrelang zwischen Psychiatern und Entziehungskuren hin und her, bis sie in der Küche eines Onkels landete, der Gastwirt war und sie wieder auf die Spur brachte.
Agnès ist eine intelligente Frau, und ihre immer mütterliche Küche ist eine subtile Mischung internationaler Kultur und französischer Tradition. Alles interessiert sie, und sie probiert ständig etwas Neues. Sie hat keine Kinder, aber einen Mann, den sie zusammen mit ihrer Berufung im Restaurant unseres Onkels gefunden hat. Antoine, Mathestudent und in den Ferien Tellerwäscher, war dort beschäftigt. Dicker Kopf, sanft und ruhig wie ein Labrador. Er unterrichtet in der Vorbereitungsklasse für die Hochschule und spielt samstags früh mit seinen Schülern Fußball. Eigentlich sollte ich nicht sagen, dass Agnès und Antoine keine Kinder haben. Sie haben zwei – meine, umständehalber. Da Philippe ständig auf Reisen ist und auch ich ziemlich oft unterwegs bin, haben unsere Kinder zwei Zuhause. Seit Végas Geburt vor sechzehn Jahren hat keiner von uns dieses Arrangement jemals infrage gestellt, weil alle auf ihre Kosten kommen. Agnès und Antoine haben dadurch zwei schon fertige Kinder gewonnen, Philippe und ich die für unsere jeweiligen Leidenschaften unverzichtbare Freiheit. Und Louis und Véga haben die Möglichkeit, bei den einen zu erhalten, was man ihnen bei den anderen verweigert, genießen also die Privilegien von Scheidungskindern, ohne unter den Unannehmlichkeiten zu leiden. Unsere geteilte Fürsorge gleicht einem kleinen selbst verwalteten Unternehmen, in dem jeder etwas zu sagen hat. Zwangsläufig knirscht es manchmal. Aber nicht mehr als anderswo.
Meine Schwester hat wenige Freunde. Von ihren verrückten Jahren hat sie ein tiefes Misstrauen gegen zufällige Begegnungen und neue Gesichter bewahrt. Die wenigen Auserwählten, die sie bei sich empfängt, werden dafür wie Kranke verhätschelt und wie Könige ernährt. Wir kamen als Letzte und wurden von ihr mit großem Pomp empfangen, das ist ihre Art. Unter der Kochschürze trug sie eins dieser Kleider, deren Geheimnis nur sie kennt und die man in keinem Geschäft findet. Seit ihrer Kindheit kleidet sich Agnès in Grün. Sie sagt, dass Grün sie begeistert, und fügt hinzu, sie könne nicht erklären, weshalb. Eine Goldkette, fein wie ein Spinnenfaden, schwang im Rhythmus ihrer Bewegungen an ihrem Hals. Meine Schwester hat den gleichen flachen Hintern und den gleichen Knochenbau wie ich, ist aber zehn Zentimeter größer, was einen großen Unterschied macht.
An jenem Abend waren Agnès’ übliche Gäste da. Mickey ist ihr amerikanischer Küchengehilfe, ein mit Maori-Tattoos bedeckter herausragender Patissier. Die Kinder lieben ihn. Véga, fasziniert vom blauen Spitzenmuster auf seinen Unterarmen, hat sich inzwischen zwar abgewöhnt, auf seinem Schoß zu sitzen, betrachtet ihn aber hingerissen und nostalgisch aus der Entfernung. Die Cuaults, ein schwerreiches, diskretes Paar, saßen nebeneinander auf dem Sofa und nippten freundlich an ihrem Champagner. Die beiden machen immer den Eindruck, als sei es für sie eine große Ehre, zu meiner Schwester eingeladen zu sein. Ich mag sie gern. Vor allem die Frau, die sich aus ihrer frühen Kindheit die Fähigkeit zu spontaner und rührender Begeisterung bewahrt hat. Sie lacht nie, ohne dabei in die Hände zu klatschen. Die Cuaults lauschen andächtig und trinken ohne Zurückhaltung, ohne etwas von ihrem bürgerlichen Geheimnis zu offenbaren. Ich vermute, dass sie meiner Schwester geholfen haben, die Anteile ihres Geschäftspartners zu kaufen, als der sie im Stich gelassen hat.
Der Abend kündigte sich an, wie er tatsächlich verlief: ruhig, freundlich und leicht. Zumindest dem Anschein nach. Denn im Leben findet alles auf zwei Ebenen statt. In jedem Augenblick. Es gibt den Putz an der Oberfläche, den unser Wortschatz beschreiben, verstehen und erzählen kann. Und eine tiefer liegende Ebene, auf der das Leben nicht in Echtzeit abläuft; wenn man will, kann man versuchen, sie im letzten Moment zu erwischen, bevor sie sich entzieht und auf immer für unsere Erfahrung verloren ist. Allein mit meinem Blick bewaffnet, habe ich sehr früh eine dezente Aufmerksamkeit für alles entwickelt, was sich um mich bewegt. Ich frage mich immer, wie es bei den anderen um dieses subsidiäre Bewusstsein steht. Die Erfahrung hat mich gelehrt, bei den Künstlern, die ich zu Unrecht als vollwertige Mitglieder dieser Familie zwanghafter Beobachter angesehen hatte, zu differenzieren. Einige, zu denen ich gehöre, spionieren unter dem Deckmantel von Müßiggängern, Rentiers oder Ganzjahresurlaubern auf eigene Rechnung vom Aufstehen bis zur Nachtruhe. Andere machen sich nicht die Mühe und beschäftigen sich nur mit Ideen. Wie machen sie das nur? Das Leben ist doch keine alte Geschichte!
Ich rede bei solchen Abendgesellschaften nicht viel. So kann ich mich ganz auf die faszinierende Mechanik der Körper konzentrieren. Der Marionettenspieler ist ständig auf der Suche nach unbekannten Gesten. Sie tauchen auf wie neue Worte im Alltagsvokabular, aus dem Nichts oder aus Filmen und ausländischen Serien übernommen. Das ist ein ständiges work in progress, in dem Natur und Kultur eine bewegte Beziehung eingehen. Ererbte, gelernte, nachgeahmte, natürliche oder künstliche Gesten, Ticks und Macken. Jeder von uns sendet Signale aus, die ich erfasse und klone. Die Menschen ahnen gar nicht, wie sehr sie mir gehören. Ich bin ein Spiegel, in dem sie sich nicht sehen. Mickey hat das nervöse Trommeln seiner Finger nie erkannt, wenn Théodora, meine Marionette, es exakt nachahmte. Ebenso wenig wie Philippe sein Nicken, mit dem er bestätigt, was er hört. Oder Louis das Schulterzucken, das sein fehlendes Selbstvertrauen verrät. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich die Liebkosung von Agnès’ Händen wiedergeben soll, die sich wie heilende Pflaster auf die Arme ihrer Tischnachbarn legen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Schwester nichts merken wird, wenn eins meiner Geschöpfe das endlich schafft. Und dennoch, dennoch, und das ist mein heimlicher Triumph, spüren alle, dass ich von ihnen spreche. Sie wissen nicht warum, aber alle teilen mit meiner Holzpuppe eine Verwandtschaft, die sie verwirrt.