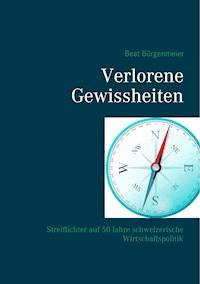
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Finanzkrise von 2008 hat viele Gewissheiten in Frage gestellt. Die Wirtschaftspolitik orientiert sich jedoch weiterhin nach alten Rezepten und verwechselt dabei vermehrt Liberalismus mit nationalkonservativem Abwarten und Verharren. Dieses Buch zeigt, dass diese Entwicklung sich lange vorher angebahnt hat. Es vereinigt eine Auswahl von Beiträgen in Zeitungen, Radio und Fernsehen, die nichts von ihrer Aktualität eingebüßt haben. Sie sind nach Themen gegliedert, die weiterhin die Agenda der schweizerischen Wirtschaftspolitik bestimmen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Floriane
Inhalt
Einführung
Politik und Wirtschaft
Vortreffliche Transparenz
WEF: Probleme schaffen oder lösen?
Dialogfähigkeit der Firmen
Generationenvertrag
Staat und Steuern
„Service public“ oder „marché privé“?
Harmonisierung oder Konkurrenz?
Gerechtigkeit und Effizienz im Multipack
Steuern und kein Ende
Reformen
Krise, Krise an der Wand, welche ist die schwerste im ganzen Land?
Reformitis
Im Namen des Volkes
Arbeit
Fairness
Lohn oder Verdienst, dass ist die Frage.
Was kostet Ostern?
Sparen wozu?
Geld und Finanzen
Bankgeheimnis :
Ein Brief zum langen Abschied
Selbsterfüllende Prophezeiungen
Geldpolitik in der Zwickmühle
Zurück zur Normalität
Mythen der Nationalbank
Wachstum
Kurzer Krieg, rascher Aufschwung?
Wachstumsschwäche
Ländervergleiche
Wirtschaftsethik
Wahltag ist Zahltag
Umwelt
Wirtschaftswachstum als heilige Kuh
Nachhaltige Entwicklung
Nachhaltig, was sonst?
Klimapolitik im Rückwärtsgang
Ausblick
1. Einführung1
Als Professor für Volkswirtschaft an der Universität Genf verfasste ich regelmässig Kommentare zum Wirtschaftsgeschehen. Ich begann mein Studium 1969 und war schon damals überzeugt, dass Volkswirtschaft nur dann Sinn macht, wenn sie für konkrete Empfehlungen zur Wirtschaftspolitik taugt. 1980 wurde ich Professor und trat 2009 in den Ruhestand, dem noch während sechs Jahren eine Gastprofessur an einer Pariser Universität folgte. Dieser Zeitraum entspricht etwa einem halben Jahrhundert, während dem viele Gewissheiten verloren gingen und neue entstanden.
Als Basler in Genf überbrückte ich den Röstigraben und hatte zugleich etwas Distanz zu den eidgenössischen Entscheidungs- und Machtzentren, die von einer Wirtschaftselite besetzt wurden, welche sich immer mehr von der Politik verabschiedete und wahrscheinlich deswegen dazu immer einfachere Meinungen hatte.
Um dazu einen Kontrapunkt zu setzen, habe ich mich entschlossen, eine Auswahl der Beiträge meiner Medienpräsenz in diesem Buch zu publizieren. Die Beiträge sind nicht chronologisch, sondern nach Themen geordnet und bestehen aus meinen Radiobeiträgen in der Sendung « Akzent » des DRS 2 und aus Texten in Zeitungen um die Jahrhundertwende.
Die meisten wurden in der Basler Zeitung veröffentlicht. Nach deren Besitzerwechsel wurde ich natürlich nicht mehr eingeladen. Ich habe dafür Verständnis. Schliesslich sind Intellektuelle für Nationalkonservative schon immer suspekt gewesen, besonders wenn sie sich für einen sozialliberalen Ausgleich einsetzen. Nichts Schlimmeres, als weder ganz links noch ganz rechts zu sein.
Es gehörte sich auch nicht für einen Wirtschaftsprofessor zu denken und manchmal zu irren, da von ihm erwartet wird, die Interessen der Wirtschaft im Sinne der Unternehmen und Banken kompromisslos zu vertreten. Dass zur Wirtschaft auch Konsumenten, Arbeitslose, Ausländer und einfache Bürger gehören, ist schliesslich derart bekannt, dass sie nicht auch noch gewürdigt werden müssten.
Vereinfachungen haben den grossen Vorteil, dass sie für alle diejenigen verständlich sind, die ihr eigenes Denken zum Nachplappern benützen. Ich vereinfache auch. Meine Lust zur Provokation drückt jedoch meine Sorge aus, dass die Ökonomisierung unserer Gesellschaft fortschreitet, dass die soziale Verantwortung der Wirtschaftselite weiter abnimmt, dass Liberalismus vermehrt mit Macht verwechselt wird, und dass Reformen durch eine neoliberale Propaganda eher verhindert, als gefördert werden. Neoliberalismus hat nichts mit Liberalismus zu tun, sondern bezeichnet eine erzkonservative Strömung, die in den USA nach dem Ende des kalten Krieges in Mode gekommen ist. Alles was aus dem Westen kommt, ist nicht ausschliesslich gut und nicht nur seit Donald Trump.
Ich richte mich nicht nur an eine Leserschaft, die aus der gleichen Generation stammt wie ich, sondern auch an alle, die heute noch für die Tugenden einstehen, denen wir unseren Wohlstand verdanken: Weltoffenheit, Toleranz und pragmatischen Umgang mit all erdenklichen –Ismen. Diese Werte gelten immer noch. Trotz den rechtspopulistischen Meckerern bleibt die Schweiz ein wohlhabendes Land.
Diese zum Teil sarkastisch-ironischen Texte wollen sichtbar machen, welche Gefahren für die individuelle Freiheit lauern, falls unsere Gesellschaft nur noch nach wirtschaftlichen Kriterien handelt, die längerfristig unsere nach dem Gesellschaftsvertrag ausgerichtete Verfassung aushebeln. Rechte für alle bringen Pflichten für alle.
Als ich anfing, die wirtschaftliche Szene zu verfolgen und zu kommentieren, war ich von den Erkenntnissen meiner Disziplin überzeugt. Der kalte Krieg, fixe Wechselkurse, hohe Wachstumsraten, ein nicht wiederkehrender Beschäftigungsgrad und ein allgemeiner Optimismus verfestigten die Gewissheit, dass wir das Wirtschaftliche im Griff haben. Eine kluge Wirtschaftspolitik ergab sich von alleine: Weitermachen wie bisher!
Eine erste Zäsur erfolgte anfangs der siebziger Jahre, als ein Ölpreisschock die erste wirkliche Rezession nach dem zweiten Weltkrieg auslöste. Die Wachstumsraten verkleinerten sich, die Wechselkurse wurden flexibel und die Arbeitslosenrate stieg an. Man musste sich daran gewöhnen, plötzlich mit grösseren Unsicherheiten zu leben, und die Wirtschaftspolitik offensiver zu gestalten.
Eine zweite Zäsur folgte Ende der achtziger Jahre. Der kalte Krieg ging friedlich zu Ende, obwohl ich im Glauben grossgezogen wurde, dass nur ein dritter Weltkrieg ihn bodigen könnte. „Das Ende der Geschichte“ wurde angesagt, was aber kam, war eine naive Hurrah-Stimmung. Das Ende des kalten Krieges brachte nicht der Siegeszug eines aufgeklärten Liberalismus, sondern eine konservative Gegenströmung, die versuchte, bestehende Privilegien zu festigen und neue für wenige zu schaffen.
Schliesslich hat die Finanzkrise, die 2007 begann und heute, im Januar 2018, immer noch nicht ganz ausgestanden ist, eine grosse Verunsicherung ausgelöst. Die herkömmliche Wirtschaftspolitik ist in vielen Bereichen in Frage gestellt. Theoretische und praktische Gewissheiten gingen haufenweise verloren. Bankenvertreter möchten uns glauben machen, dass sie nicht an dieser tiefen Krise, die das internationale Finanzsystem an den Rand eines Kollaps brachte, schuld sind. Schuld daran sei der Staat.
Ich habe dagegen geschrieben, mich über die populistischen Vereinfacherer geärgert und hilflos versucht, den „neuen“ Liberalismus als reaktionäre, fortschrittsfeindliche Doktrin zu entlarven. Den zynischen Meinungsmachern war dies egal. Ihnen war wichtig, dort Stimmen abzuholen, wo es am emotionalsten zuging. Was kümmert sie die historisch belegte Tatsache, dass der Liberalismus immer im Gegensatz zum Konservatismus stand. Seine wirklichen Feinde sind Anhänger des „Ancien Régime“, die es anscheinend heute in neuen Kleidern wieder vermehrt gibt. Sie sind nicht am Gemeinwohl, sondern an Marktmacht, politischer Einflussnahme und Schaffung von neuen Abhängigkeiten interessiert.
Diese Entwicklungen treten jedoch in den Hintergrund, wenn es darum geht, Wirtschaft in einem längeren Zeithorizont zu verstehen. Unaufhörlich findet dabei ein Strukturwandel statt, der das eigentliche Wesen des Wirtschaftens ausmacht. Dazu werden wir zum Teil gezwungen – der technische Fortschritt ist reich an Überraschungen -, zum Teil gestalten wir ihn mit. Dass alle Bürger dabei eingebunden werden, ist eine der Bedingungen, dass dieser Strukturwandel so reibungslos wie möglich verlaufen kann.
Neue Gewissheiten sind am entstehen: die Wirtschaft muss im grossen Stil umweltverträglich werden, und deren Resultat allen zugutekommen. Die neuen Informatik- und Kommunikationstechnologien erlauben eine offene Gesellschaft, die, wenn sie es nur will, Diskriminierungen abbauen und Manipulierungsversuche entgegentreten kann. Trotz aller Angstmacherei blickt eine solche Gesellschaft getrost in eine immer unsichere Zukunft, obwohl sich der Pessimismus besser verkaufen lässt, und dreiste Lügen heute genügen, Wähler zu gewinnen.
Die während dieser Zeit beobachteten, grossen Veränderungen haben keinen signifikanten Fortschritt in den Wirtschaftswissenschaften bewirkt. Anlässlich des hundertsten Jubiläums einer der berühmtesten Fachzeitschriften, „The American Review„, hat eine Gruppe von Starökonomen die wichtigsten Publikationen ausgewählt. Die letzte erschien 1981. Wenn seit über 36 Jahren alle das Gleiche denken und keinen Einspruch mehr dulden, ist diese Wissenschaft am Ende. Der kalte Wind des Neoliberalismus bläst weiter und wirbelt keine neuen Erkenntnisse, sondern gefährliche Vereinfachungen vor sich hin. Die sich liberal gebende Wirtschaftspresse ist derart in finanzielle Abhängigkeiten geraten, dass das Sprichwort „Des Brot ich ess, des Lied ich sing“, zu ihrem stillen Leitmotiv geworden ist.
Vertraute Gewissheiten aufgeben und nach neuen Ufern aufbrechen ist immer schwierig, besonders dann, wenn bestehende Wirtschaftsinteressen die Reise verhindern möchten. Unsere Gesellschaft ist aber schon längst auf dieser Reise. Die heute schon absehbaren Umwälzungen in Technik, Medizin und Umwelt werden neue Gewissheiten hervorbringen, die eine noch so verlogene Politik der Angstbewirtschaftung längerfristig nicht verhindern kann.
Die wirtschaftspolitische Agenda ist eigentlich klar: die gesellschaftliche Liberalisierung, die sich in unserem Land nach dem zweiten Weltkrieg mit Verzögerung durchsetzte, muss auch in der Wirtschaft zu Reformen führen.
Neue Organisationsformen, Umweltverträglichkeit und Fairness muss das Ziel einer modernen Wirtschaftspolitik sein. Wer darunter nur „mehr Markt“ versteht, hat ein gestörtes Verhältnis zu den Werten der Aufklärung. Ob er es will oder nicht, ist er Diener der bestehenden Machtverteilung und Wasserträger des national-konservativen Populismus geworden.
Eine schleichende gesellschaftliche Blockierung zeichnet sich in den Umweltanliegen, der Europafrage, der Finanzierung der Sozialwerke und dem demokratischen Kontrollverlust des Finanzsektors ab. Dass es nicht so weit kommt, verdanken wir nicht dem Markt, sondern unserem pragmatischen Demokratieverständnis.
Wohin die Reise geht, hängt davon ab, welche Ziele die Mehrheit der Stimmbürger sich setzen. In Zukunft wird es nicht reichen, die gesamte Wirtschaftspolitik nach Eigeninteressen auszurichten. Eine für alle tragbare Zukunftsperspektive ist gefragt.
1Ich danke Floriane Bürgenmeier und Monika Dauwalder für Ihre wertvolle Mitarbeit am Manuskript.
2. Politik und Wirtschaft
Das Verhältnis der Politik zur Wirtschaft ist ein unverwüstliches Thema. Es bezeichnet gegenseitige Abhängigkeiten, Verfilzung und Interessenabwägung. Obwohl das Primat der Politik an sich unbestritten ist, möchte die Wirtschaftslobby uns immer wieder schmackhaft machen, dass ohne sie nichts geht. Der Zuständigkeitsbereich der Wirtschaft ist jedoch beschränkt. Ohne rechtsstaatlich gesetzte Regeln breiten sich Korruption und Nepotismus aus. Dennoch wird die Politik immer wieder in Frage gestellt, verunglimpft und wirtschaftlichen Zwängen derart ausgesetzt, dass sie sich der wirtschaftlichen Logik unterwerfen muss.
Der erste Beitrag mit dem Titel „vortreffliche Transparenz“ stammt aus einer Zeit, wo die Technologieförderung in Mode gekommen war. Bis dahin war die schweizerische Wirtschaftspolitik äusserst zurückhaltend und konzentrierte sich auf eine kurzfristig ausgerichtete Konjunkturpolitik.
Die damalige eidgenössische Kommission für Konjunkturfragen war dafür zuständig, wurde jedoch von „Nachtwächter“ Liberalen nur widerwillig geduldet. Dass eine aktive Konjunkturpolitik aus liberaler Sicht nicht nötig sei, wird heute noch vor allem von den Kreisen vertreten, die sich nie die Mühe genommen haben, sich ernsthaft mit den Schriften eines J.M. Keynes auseinanderzusetzen, indem sie immer wieder versuchen, diesen Ökonom in die linke Ecke zu setzen.
Als Ende der neunziger Jahre diese Kommission in das neu geschaffene Staatssekretariat für Wirtschaft integriert wurde, konnte man erahnen, dass die Ökonomisierung unserer Gesellschaft unaufhaltsam seinen Lauf nahm, und dass nun eine aktive Wirtschaftspolitik weit über der Konjunkturpolitik hinaus in vielen anderen Bereichen zur Anwendung gelangen würde. Was früher eher von Juristen bearbeitet wurde, wurde zum Tummelfeld von Ökonomen. Jedenfalls wurde wirtschaftliche Effizienz zur bestimmenden Messlatte. Förderung von Talenten und Innovationen gehörte nun unter anderem auch zur Wirtschaftspolitik. Ob dies der Effizienzsteigerung geholfen hat, bleibe dahingestellt, transparenter wurde das Verhältnis der Politik zur Wirtschaft sicher nicht.
Ich schrieb den zweiten Beitrag, nachdem bekannt wurde, dass nach dem Anschlag auf das „World Trade Center“ 2001, das „World Economic Forum“ (WEF) nicht wie üblich in Davos, sondern in New York stattfindet. Dies war die Gelegenheit, mich spöttisch mit dem WEF auseinanderzusetzen, das ich auch heute als Beispiel eines gestörten Verhältnisses zwischen Politik und Wirtschaft betrachte. Seit dem Besuch von Donald Trump in Davos im Januar 2018 kann auch von kumulierten Interessen die Rede sein. Die Marke Trump verkauft sich unter seinesgleichen.
Der dritte Beitrag schliesst sich dieser Einschätzung nahtlos an. Er thematisiert die abnehmende Dialogfähigkeit der Firmen, die sich, wahrscheinlich durch die Globalisierung bedingt, politisch weniger verantwortlich fühlen. Jedenfalls mehren sich naive Stellungsnahmen von Topmanagern, die das Bildungswesen in erster Linie als Produktionsfaktor in Form von Humankapital verstehen und nicht als Beitrag zur Emanzipation des Bürgers. Sie strapazieren dabei nicht nur unser Demokratieverständnis, sondern auch den Solidaritätsgedanken der Chancengleichheit.
Der vierte Beitrag thematisiert dies anhand des Generationenvertrages, der ein zentrales politisches Thema ist. Bei Verteilungsfragen handelt es sich immer um soziale Gerechtigkeit. Diese nur nach wirtschaftlicher Effizienz ausrichten zu wollen, ist eine rechtsnationale Zwängerei.
Vortreffliche Transparenz2
Transparenz und Vortrefflichkeit sind magische Worte, die dann immer verwendet werden, wenn wir mit undurchsichtigen Machenschaften und haarsträubender Mittelmäßigkeit konfrontiert werden. Wenn die wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen transparenter wären, hätten wir nicht so viele Affären, Hintertreibungen und Vertrauensverluste, sind oft gehörte Klagen, an die sich ein allgemeines Bedauern anschließt: Wenn wir nur die vortrefflichsten Leistungen honorieren würden, dann wäre unser Wohlstand auch in Zukunft gesichert. Unser Wirtschaftswachstum würde nicht auf dem Pannenstreifen vorwärts kriechen, sondern wir könnten innovative Unternehmer in Scharen vorbeirauschen sehen, die mit zahlreichen Firmengründungen das Fundament eines neuen goldenen Wirtschaftszeitalters legen würden. Wir bräuchten mehr Unternehmer und weniger Beamte und Angestellte, lautet das Fazit. Damit dies schnell und plötzlich geschieht, müsse der Staat systematisch neue „startup“ Unternehmen in erfolgreichen Technologiebereichen fördern und Risikokapital zuhauf für besonders gehätschelte Talente bereitstellen, da unsere Banken anderweitig beschäftigt seien.
Der Staat solle für Unternehmer bessere Rahmenbedingungen schaffen, ihnen einseitig Steuererleichterungen zugestehen und den anderen beliebt machen, dass er nicht mehr alle ihre Forderungen erfüllen könne. Um diesem Ziel näher zu kommen, könnte er die alte Garde der ausrangierten Firmenmanager anstellen, damit ihr unermesslicher Erfahrungsschatz der neuen Generation zu Gute käme. Wir hätten dann einen Nährboden für freies Unternehmertum, wo neue Ideen unter kundiger Anleitung ausgebrütet werden könnten. Auf einem solchen Boden würden auch unsere Hochschulen zu blühen kommen, und das Bundesamt für Technologie hätte dann endlich die Rolle, die es anstrebt, nämlich diejenige eines Gärtners, der mit seiner Gießkanne in Fachhochschulen zarte Firmenpflänzchen zum Wachsen bringt. Mehr Staat für diejenigen, die es verdienen und weniger Staat für die andern.
Eine solche Idylle erlaubt es kaum, darauf hinzuweisen, dass solche Forderungen grundlegende Prinzipien der Eigenverantwortung und der individuellen Risikobereitschaft durchbrechen. Wieso soll nun plötzlich der Staat besser als seine Untertanen wissen, welche Firmengründungen erfolgreich sein werden und welche nicht? Wieso soll nun der Staat sich vermehrt in seinen Schulen um die Begabten kümmern und die andern mit neuen Fussballstadien trösten? Gilt der Grundsatz nicht mehr, dass die Schulen Bildung vermitteln, damit die zukünftigen Staatsbürger frei und hoffentlich auch kompetent entscheiden können?
Warum sollen nun plötzlich unsere Universitäten die Studenten zu Unternehmer erziehen, vorrangig angewandte Forschung betreiben und dafür das Geld vom Staat und der Wirtschaft erbetteln? Sind sie nicht mehr in der Lage, ihren von der Öffentlichkeit zugestandenen Freiraum mit humanistisch gebildeten und zudem noch kritischen Studenten auszufüllen? Sind solche Studenten in der Zukunft nicht „nützlicher“, wenn sie intellektuell in die Lage versetzt werden, unsere aktuellen Wirtschaftpraktiken zu hinterfragen, anstatt als Klone diese Praktiken unendlich zu wiederholen?
Firmengründungen haben zu jeder Zeit stattgefunden, ohne dass ein zukünftiger Unternehmer zuerst spezielle Kurse durchlaufen und einen Universitätsabschluss mit dem Nebenfach „Startups“ vorweisen musste. Zugleich hat es auch immer wieder Konkurse und Schiffsbrüche gegeben. Diese „schöpferische Zerstörung“, wie Joseph Schumpeter diesen Prozess nannte, lässt sich nicht steuern, sondern nur durch das Klima einer offenen, kritischen und toleranten Gesellschaft fördern.
Dass diese Gesellschaft in Gefahr ist, wenn karrierebesessene Manager sich als Unternehmer gebärden, wenn Aktionäre nur kurzfristig Börsenkurse maximieren, und wenn Politiker an ihren wirtschaftlichen Erfolgen gemessen werden, sind unseres Wissens nicht einmal den Universitäten eine Forschung wert. Sie haben sich anscheinend damit abgefunden, mit gleicher Elle gemessen zu werden. Sie nehmen es hin, weniger eine Universität, sondern vermehrt eine Schule zu sein, die nicht Bildung, sondern instrumentales Wissen vermittelt. Forschung muss nun auch gemanagt werden, manchmal auch von solchen, die davon keine Ahnung haben, aber sich dazu berufen fühlen, andere anzuleiten. Im Nahmen der Vortrefflichkeit werden unsere Bildungsanstalten verbürokratisiert.
Dass damit der Öffentlichkeit unabhängiges, kompetentes Expertenwissen verloren geht, das vermehrt in den von der Wirtschaft finanzierten Forschungsabteilungen produziert wird, scheint niemanden zu stören. Forschung soll rentieren und nicht bilden. Damit wird es auch einfacher, die übrigen Staatsbürger als überfordert zu deklarieren, um sie im demokratischen Prozess über die Gefahren und Nutzen von Freilandversuchen, über den Sinn von Genmanipulationen und den ethischen Aspekten der Stammzellenforschung abzumelden. Transparenz wäre da nur gefährlich, denn das Gründen von Firmen ist wichtiger als Aufklärung.
Was wir heute wissen:





























