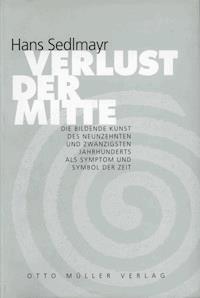
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Müller, Otto
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im ersten Teil behandelt Sedlmayr die >>Symptome<<, wie z. B. den Wandel der vorrangigen Aufgaben der Architektur vom Landschaftsgarten zur Fabrik. Den Hintergrund solcher Entwicklungsreihen bilden die vier durch >>Gesamtaufgaben<< gekennzeichneten Stilepochen Romanik, Gotik, Renaissance und Barock, sodass im anschliessenden Teil Diagnose und Verlauf die um 1760 wurzelnde Moderne als Ende der Stilgeschichte erscheint. Die Diagnose mündet in den Übergang von >>der 'Befreiung' zum Ende der Kunst<<. Der abschliessende Teil Zur Prognose und Entscheidung enthält die Erwartung, dass die Moderne >>als Ganzes gesehen, gerade auch im Chaotischen, den Charakter eines >geschlossenen< Zeitalters<< gewinnen kann. Vorläufig erweist sich als ihr einigendes Kriterium das Leiden an der Gottferne, die nirgends in gleicher Weise zum Ausdruck kommt wie in der Kunst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HANS SEDLMAYR
VERLUST DER MITTE
Die bildende Kunstdes 19. und 20. Jahrhundertsals Symptom und Symbol der Zeit
„Die Mitte verlassen. heißt die Menschlichkeit verlassen.“
(PASCAL)
„Alle Mitten sind zerbrochenund es gibt keine Mitte mehr.“
(MAJAKOWSKI, Hymne an Satan)
OTTO MÜLLER VERLAG
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Sedlmayr, Hans: Verlust der Mitte : die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhundertsals Symptom und Symbol der Zeit / Hans Sedlmayr. -11. Aull. -Salzburg ; Wien : Müller, 1998
ISBN 3-7013-0537-4
ISBN 3-7013-0537-4
© 1948 OTTO MÜLLER VERLAG, SALZBURG-WIEN
1. Auflage 1948
11. unveränderte Auflage 1998
Umschlaggestaltung: Leo Fellinger
Druck und Bindung: Wiener Verlag, Himberg
INHALT
Einleitung
Erster Teil: Symptome
1. Kapitel: Neue führende Aufgaben
2. Kapitel: Auf der Suche nach dem verlorenen Stil
3. Kapitel: Die Zerspaltung der Künste
4. Kapitel: Der Angriff auf die Architektur
5. Kapitel: Das entfesselte Chaos
6. Kapitel: Der Sinn des Fragments
Zweiter Teil: Diagnose und Verlauf
7. Kapitel: Verlust der Mitte
8. Kapitel: Der „autonome“ Mensch
9. Kapitel: An den Ursprüngen der Gegenwart
10. Kapitel: Vorläufer der modernen Kunst
11. Kapitel: Die drei Kunst-Revolutionen des 18. Jahrhunderts
12. Kapitel: Von der „Befreiung“ zur Verneinung der Kunst
Dritter Teil: Zur Prognose und Entsdieidung
13. Kapitel: Zur Wertung der Epoche
14. Kapitel: Zur Wertung der modernen Kunst
15. Kapitel: Die moderne Kunst als viertes Zeitalter der abendländischen Kunst
16. Kapitel: Die Moderne als Zeitwende in der Weltgeschichte
17. Kapitel: Zur Prognose
Schluß: Hetoimasia
EINLEITUNG
Das Thema
„Schon die Kunstgeschichte gehört nicht sidi allein an: sie dient der Kunde vom Menschen.“ (W. Pinder)
In den Jahren und Jahrzehnten vor 1789 hat in Europa eine innere Revolution von unvorstellbaren Ausmaßen eingesetzt: die Ereignisse, die man als „Französische Revolution“ zusammenfaßt, sind selbst nur ein sichtbarer Teilvorgang dieser ungeheueren inneren Katastrophe. Es ist bis heute nicht gelungen, die dadurch geschaffene Lage zu bewältigen, weder im Geistigen noch im Praktischen.
Zu verstehen, was damals wirklich geschehen ist, ist vielleicht die aktuellste Aufgabe, die den historischen Wissenschaften überhaupt gestellt ist: an dieser historischen Wende sind wir nicht nur historisch, sondern ganz unmittelbar interessiert. Denn mit ihr beginnt unsere Gegenwart und von ihr her erkennen wir auch noch unsere Lage, erkennen wir uns selbst.
Die Betrachtung der Kunst ist berufen, entscheidende Erkenntnisse zum Verständnis dieser inneren Revolution beizutragen. Nirgends ist das Unvergleichliche, Neue, das damals begonnen und Epoche gemacht hat, schärfer zu fassen als an einer Reihe von Erscheinungen in dem Gebiete der Kunst, die außerordentliche Prägnanz besitzen. Ist man imstande, diese Erscheinungen nicht bloß als historische Tatsachen zu sehen, sondern als Symptome, dann ergibt sich aus ihnen zwanglos eine Diagnose des Leidens der Zeit. Denn als Leiden werden diese Zustände zweifellos weithin empfunden.
Man hat zwar gelegentlich für eine Deutung der Epoche Erscheinungen der Kunst als Symptome herangezogen, so Spengler. Bei ihm und den meisten anderen sind es aber gerade nicht die eigentümlichen Erscheinungen, sondern solche, zu denen es Analogien auch in anderen Epochen gibt. Es treten aber im Gebiete der Kunst seit rund 1760 Erscheinungen auf, die es nie und nirgendwo in der Weltgeschichte gegeben hat. Mit so großer symbolischer Kraft sprechen sie von Erschütterungen im Inneren der geistigen Welt, daß es einmal unverständlich erscheinen wird, daß die Betrachtung der Kunst nicht sogleich alles verraten hat.
Man hätte wohl schon längst alles erraten, wenn nicht die Angst zu sehen die Augen geschlossen hätte. Denn diese Lage zu sehen und nicht zu verzweifeln verlangt Mut. Anderseits kann aber gerade diese Betrachtung Mut geben.
Zwar darf die Wissenschaft, mag sie auch ihre Erkenntnisse der Tiefe entreißen, sich nicht einbilden, ein Gewicht auf den ungeheuren Waagschalen des Äons zu sein. Aber so wie es bei seelischen Störungen zur Findung des verlorenen Gleichgewichtes beitragen kann, Unbewußtes in das Licht des hellen Bewußtseins zu heben und dadurch zu bannen, so kann eine analoge Betrachtung unseres Zeitalters von der Kunst her – über das bloß theoretische Interesse hinaus, das uns in so entscheidungsreichen Zeiten kaum genug anziehen könnte – wenigstens einige Ansätze zur Lösung eines Zustands zeigen, der viele quält.
Unserer Epoche scheint nicht nur im Individuellen, sondern auch im Kollektiven die Aufgabe gestellt, durch das Bewußtmachen von Unbewußtem hindurch zu einer neuen Unmittelbarkeit und Selbstverständlichkeit zu kommen.
Die Methode
Die Möglichkeit, die Kunst als Instrument einer Tiefendeutung von Epochen zu benützen, ist theoretisch schon geschehen. Sehr klar hat den Grundsatz solcher Betrachtungen René Huyghe 1939 formuliert: ..Die Kunst ist für die Geschichte der menschlichen Gemeinschaften das, was der Traum (des individuellen Menschen) für den Psychiater bedeutet.“ Und zwar gilt das gerade auch für die mißlungene Kunst, für ihre Entgleisungen und Fehlleistungen. „Die Kunst erscheint vielen nur als eine Zerstreuung am Rande des wirklichen Lebens, sie sehen nicht, daß sie in das Herz dieses Lebens hinabreicht und seine noch unbewußten Geheimnisse offenbart, daß sie die direktesten, die aufrichtigsten, weil am wenigsten berechneten Geständnisse enthält. Die Seele eines Zeitalters maskiert sich hier nicht; sie sucht sich, sie verrät sich hier mit jenem Vorherwissen, das allem eigen ist, was aus der Empfänglichkeit und der Besessenheit hervorgeht.“ Damit ist das Programm aufgestellt. Aber für die Epoche, die unsere Gegenwart begründet, ist es erst noch zu verwirklichen.
Dazu bedarf es einer Methode, um die wesentlichen Erscheinungen, auf die eine Diagnose sich stützen kann, von den unwesentlichen zu sondern, die jene verhüllen.-Sonst wird die Deutung willkürlich. Denn gerade im 19. Jahrhundert ist im Gebiete der Kunst unendlich vieles „unaufrichtig“, unecht, berechnet, vorgeschützt. Es ist zum Beispiel nicht möglich, von der Sphäre des „Stils“ auszugehen, weil sich gerade im 19. Jahrhundert in ihr Echtes und Vorgeschütztes in zunächst kaum durchschaubarer Weise mischt. Dieses Oberwiegen des „Unechten“ ist eine Grundtatsache für die Erkenntnis des 19. und 20. Jahrhunderts. An ihr sind bisher noch alle Gesamtdeutungen der Epoche gescheitert. Es ist eine Methode notwendig, die imstande ist, das Echte und das Unechte zu unterscheiden, die Masken zu durchdringen. Wie in der Seelendeutung kann sie nicht von den Idealen und dem Bewußten der Zeitkunst ausgehen, sondern von jener unbewußten Zone der „Empfänglichkeit und Besessenheit“, wo sich die Seele des Zeitalters nicht maskiert.
Die Methode, die diese Unterscheidung leistet, nenne ich die „Methode der kritischen Formen“. Sie beruht im wesentlichen auf folgender Überlegung: Unter den Formen, in denen eine Epoche sich im Felde der Kunst verkörpert, sind radikal neue immer sehr selten; weitaus die meisten Formen einer Zeit werden durch Umformungen älterer erzeugt. Und weil radikale neue Formen so selten sind, liegt es nahe, sie als bloße Absonderlichkeiten zu nehmen, als „Launen der Phantasie“, als „Ausnahmen, welche die Regel bestätigen“, als „Entgleisungen“ oder „Absurditäten“. Eine solche radikal neue „Form“ ist zum Beispiel die Idee, die Kugel zur Grundform eines ganzen Gebäudes zu nehmen. Dieser Gedanke erscheint den meisten bloß als ein schlechter Scherz, als Irrsinn, Wohlwollenderen vielleicht als ein „Experiment mit der Form“, und er ist – angewandt auf ein Haus – tatsächlich unsinnig. Wäre er nur das, so stünde es nicht dafür, sich mit dem Kugelbau abzugeben.
Aber eine unsinnige Idee muß nicht notwendig auch sinnfos sein. Es ist vielmehr geradezu zum heuristischen Prinzip zu machen, daß sich in solchen absonderlichen Formen Eigentümlichkeiten enthüllen, die in gemäßigter und deshalb weniger auffallender Weise auch sonst das Schaffen einer Zeit bestimmen, dessen Eigenart in ihnen gleichsam auf die Spitze getrieben wird. Der vorzügliche französische Architekturhistoriker Auguste Choisy hat diese Vermutung auf die Formel gebracht: „Ce sont les abus qui caractérisent le mieux les tendances“ – es sind die Mißbräuche, durch die sich am deutlichsten die Neigungen verraten. Und sie sind zu verschiedenen Zeiten ganz verschieden. Nur eine Epoche zum Beispiel, die die Säule als etwas extrem MenschenfÖrmiges betrachtete, konnte auf den „verrückten Einfall“ der „sitzenden Säulen“ kommen, die in einem Entwurf des Barock-Architekten Fra Andrea Pozzo erscheinen. Sie sind „kritische Form“ und haben exemplarische Bedeutung. Und so ist auch die Kugel als Gebäude „kritische Form“, die tief verräterisch die Untergründe eines ganzen Zeitalters bloßlegt. Sie ist Symptom einer tiefgreifenden Krise der Baukunst und des Geistes überhaupt. Vielleicht wird man das leichter zugeben, wenn man bedenkt, daß der „absurde Gedanke“ unmittelbar vor der Zeit auftaucht, in der der erste Luftballon des Rozier de Pilätre sich in die Luft erhob (1783).
Hier wird jene „Zone des Unbewußten“ erreicht, denn der eigentliche Sinn solcher Formen ist ihren Erzeugern nicht bekannt. Und wenn man sie nach ihm befragt, werden oft ganz andere, offenbar unzureichende Motive für die Berechtigung solcher Formen vorgeschützt.
„Die Kunst der Diagnose besteht darin, die ,Gründe' zu durchschauen und das eigentliche Leben zu erkennen, das jene Gründe vorschickte“ (H. Thielicke).
Für diesen ersten Versuch müssen die Andeutungen zur Methode genügen, die im einzelnen noch besser zu begründen wäre. Auch bleibt das Problem des „Unechten“, bleibt der Unterschied von Zeit-,.Ausdruck“ und Zeit-,.Symptom“ noch genauer zu klären.
Grenzen der Methode
Die Grenzen, die jeder solchen Diagnose „des Ganzen“ gezogen sind, hat am besten K. Jaspers gezeigt. „Die Meinung, wissen zu können, was das Ganze geschichtlich oder gegenwärtig sei, ist ein Grundirrtum; das Sein dieses Ganzen selbst ist fraglich.“ „Doch haben Wissensperspektiven in der Relativität nicht nur ihren Sinn, sondern sind unerläßlich, um in den echten Grund der eigenen Situation zu kommen.“ „Das Kennen meiner eigenen Welt wird der einzige Weg, um zunächst im Bewußtsein die Weite des Möglichen zu gewinnen, dann im Dasein zum rechten Planen und zu wirklichen Entschlüssen zu kommen, schließlich jene Anschauungen und Gedanken zu erwerben, welche mich dazu führen, im menschlichen Dasein das Durchscheinen des Transzendenten zu erkennen.“ „Ziel der Situationserhellung ist es, das eigene Werden in der besonderen Situation mit der größten Entschiedenheit. . . ergreifen zu können. Bilder der Situation sind der Sporn, durch den der einzelne erweckt wird, sich zurückzufinden zu dem, worauf es eigentlich ankommt.“1
Diese grundsätzlichen Grenzen der Methode werden im vorliegenden Fall noch enger gezogen, weil die Basis für die hier versuchte Diagnose nur die Betrachtung der „bildenden Künste“ abgibt, während die gerade für das 19. Jahrhundert so wesentliche Musik ebenso unberücksichtigt bleibt wie die Literatur, die Künste des Theaters und der Film. Dafür besitzt, methodisch, die Betrachtung der bildenden Künste eine eigentümliche Überlegenheit, denn sie macht Dinge sichtbar, die sonst nur schwer und auf Umwegen bewußt gemacht werden könnten.
Wie die Möglichkeiten der Diagnose sind auch die der Prognose begrenzt. Denn „Prognose ist das spekulierende Voraussehen des Menschen, der etwas tun will; er sieht nicht das, was unausweichlich geschieht, sondern das, was geschehen kann, und orientiert sich daran“.1
Begrenzung des Themas
Die Problemstellung dieser Arbeit ist also nicht kunstgeschichtlicher Art, sondern eine „Kritik“ des Geistes, der Versuch einer Diagnose der Zeit, ihres Elends und ihrer Größe, von der Kunst her.
Sie ist nicht kunst-geschichtlidi, denn sie berücksichtigt mehr die Gefährdungen der Epoche als ihre Leistungen, von denen nur ganz allgemein die Rede ist. Und sie ist nicht kunst-geschichllich, denn sie beschäftigt der Zustand des Ganzen und seine Phasen im großen, nicht das Einmalige des Verlaufs, mehr das Neue als das Ineinandergreifen aller historischen Faktoren in konkreter historischer Situation.
Trotzdem ergibt sie meines Erachtens grundlegende Resultate auch für die Kunstgeschichtswissenschaft selbst. Vor allem tritt überhaupt erst in ihr und durch sie in einer unübersehbaren Vielzahl verschiedenartigster Erscheinungen die innere Einheit der Epoche hervor, von der unsere unmittelbare „Gegenwart“, 1948, und auch noch die bevorstehende Zukunft selbst Teilphasen sind. So disparat sind die künstlerischen Phänomene des 19. Jahrhunderts, daß noch jede Darstellung etwas Chaotisches angenommen hat. Mit den Stilbegriffen, wie sie für die ältere Kunst Europas entwickelt worden sind, ist ihr nicht beizukommen. Dieses scheinbar chaotische Durcheinander an der Oberfläche verdeckt mächtige und klar faßbare Grundtendenzen, die das Neue des Jahrhunderts bestimmen; gerade auch im Chaotischen zeigt es einen nicht minder bestimmten Charakter wie die älteren großen Epochen der europäischen Kunst. Und erst wenn man die innere Einheit dieser Epoche erfaßt hat, ist die Basis gegeben, um einmal die Geschichte des Zeitalters im einzelnen zu schreiben (wofür noch sehr viel Vorarbeit zu leisten wäre, denn noch sind weite Gebiete der Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts Urwald).
Das wird hier nicht versucht, auch nicht in der Form eines „Abrisses“ der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts. Vielmehr wird in den abschließenden Kapiteln nur skizziert, wie sich die so gesichtete Epoche in das Gesamtbild der europäischen Kunst und der Weltgeschichte der Kunst einfügt, und wie die Leistungen der Kunst – die zu allen Zeiten eine ist – eng mit jenen Gefährdungen zusammenhängen.
Aufgabe einer Kunstgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts aber wäre es. gerade die Leistungen herauszuarbeiten und das Wertrelief der Epoche herzustellen. Denn die Epoche hat mitten im Chaos große Leistungen aufzuweisen, sie besitzt große Begabungen und Geister, die tiefer und leidenschaftlicher sind als die meisten führenden Meister des 18. Jahrhunderts.
____________
1) K.Jaspers. Die geistige Situation der Zeit, 41. bis 50. Tausend (Berlin-Leipzig 1933).
HANS SEDLMAYR • VERLUST DER MITTE
ERSTER TEIL
SYMPTOME
„........................
Fragmente dessen, was das Herz erschaut,Sind unsre Städte mir, ein schwacher Schein. Das große Babylon ist nur ein Scherz, Will es im Ernst so groß und maßlos sein Wie unser babylonisch Herz.“
(Aus „The heart“ von Francis Thompson)
ERSTES KAPITEL
NEUE FÜHRENDE AUFGABEN
„Denn die Aufgabe ist nichts anderes als das nach Gestalt verlangende Leben selbst.“ (H. Schrade)
Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts treten neue führende Aufgaben auf, die es entweder überhaupt noch nie gegeben hat oder die doch noch niemals die Führung beansprucht hatten.
Die bisher führenden Aufgaben der Kunst – Kirche und Palast-Schloß – mehr und mehr zurückdrängend, lösen sie einander in rascher Folge in dem Anspruch auf Führung ab: von rund 1760 bis heute lassen sich sechs oder sieben solcher führender Aufgaben unterscheiden, die jedesmal für ganz Europa gültig sind: Landschaftsgarten, architektonisches Denkmal, Museum, Theater, Ausstellung, Fabrik. Keine von ihnen hat also die Führung länger als eine oder höchstens zwei Generationen lang behaupten können. Jede von ihnen ist Symptom.
In ihrer Abfolge ist ein deutlicher Riditungssinn erkennbar.
Der Verlauf im großen wird an den führenden Aufgaben deutlicher erkennbar als an jeder anderen Wandlung der Kunst, obwohl der Vorgang von anderen, ungeordneten Bewegungen verunklärt wird. Diese Betrachtung gibt den sichersten Faden, um sich durch das Labyrinth des 19. und 20. Jahrhunderts hindurchzufinden.
Doch kann man von führenden Aufgaben – diese Einschränkung muß sofort gemacht werden – nur in einem begrenzten Sinn sprechen. Denn nur der Schwerpunkt der Architektur liegt in diesem Bereich. Nur die Architekten und die großen Gartenkünstler sind noch von daher zu erfassen, alle ihre Namen kommen hier vor. Aber von der großen Malerei wird so nur der geringste Teil erfaßt. Ihre bedeutendsten Leistungen entstehen abseits von diesen Aufgaben und vielfach überhaupt nicht mehr für eine bestimmte Aufgabe, sondern als „freie“ Kunst, für sich, ohne öffentlichen Auftrag. Das hängt damit zusammen, daß zum Unterschied von den alten Gesamtaufgaben, Schloß und Kirche, die neuen nicht mehr Gesamtkunstwerke sind, die den bildenden Künsten einen festen Ort und feste Themen anweisen, sondern entweder reine Architektur, wie das architektonische Denkmal, oder bloß architektonischer Rahmen, wie Haus oder Museum, in die „freie“ Kunst zur beliebigen Füllung eintreten kann. Nur in der Mitte des 19. Jahrhunderts entsteht in dem Theatergebäude eine Renaissance des Gesamtkunstwerks: es ist die einzige unter diesen Aufgaben, für die bedeutende Maler und Bildhauer in gebundenem Auftrag schaffen.
In welchem Sinn kann man aber dann überhaupt noch von führenden Aufgaben sprechen? Ist es nicht Willkür, aus der sehr großen Zahl neuer Aufgaben, die jetzt auf künstlerische Gestaltung Anspruch erheben, gerade diese wenigen herauszugreifen? Es gibt doch daneben Börse, Parlament, Universität; Hotels, Krankenhäuser, Bahnhöfe, Stadien usw.
Führend dürfen diese Aufgaben heißen:
1. weil sich ihnen die gestaltende Phantasie mit besonderer Vorliebe zuwendet;
2. weil hier die größte Sicherheit der Haltung erreicht wird und oft ein fester Typus entsteht;
3. ganz besonders, weil von ihnen, wenn auch in beschränktem Bereich, etwas wie stilbildende Kraft ausstrahlt, weil sich ihnen andere Aufgaben angleichen und unterordnen;
4. weil sie bewußt oder unbewußt mit dem Anspruch auftreten, die Stelle der alten großen, sakralen Architekturen einzunehmen und eine eigene Mitte zu bilden.
An diesen Aufgaben ist noch etwas von der kollektiven Macht der Kunst zu spüren, die dem 19. und 20. Jahrhundert in seinem maßlosen Individualismus sonst weithin verlorengegangen ist. Wenn auch weniger mächtig, sind sie in dieser Hinsicht doch die Erben der großen Gesamtkuristwerke der Vergangenheit.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























