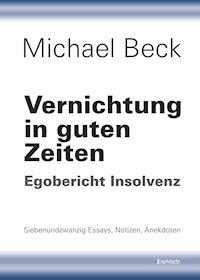
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es kommt einem vor wie ein biographischer »Tsunamie«, aus dem viele Aspekte einer gescheiterten, selbständigen Existenz geschildert werden. Es wird detailliert geschildert wie es mit klaren Zielen und einer »handwerklichen Gründlichkeit« zu einem Dienstleistungsunternehmen kommt, was man tun kann, um großen Erfolg zu haben. Doch in diese Erfolgsstory ist kein »Sicherheitsgurt« eingebaut. Das mittelständische, sozialwirtschaftliche Unternehmen scheitert an der Bürokratie und ihrer unbeeinflussbaren Zahlungsmoral, dann auch noch an den eigenen Mitarbeitern und an seiner langjährigen Hausbank, die selbst vor der Pleite steht. Schließlich kommt es in dieser Sammlung von Essays, Notizen und Anekdoten dennoch nach einer ersten Insolvenz wieder zu einem beruflichen Neuanfang mit einem Kleinbetrieb. Dann kommt die nächste Finanzkrise und ein erneutes Scheitern durch den Kreditverkauf an einen Hedgefonds. Es sind tatsächlich zwei Kollapse hintereinander durchzustehen in wenigen Jahren. Eine derartige Verknüpfung von Ereignissen befindet sich außerhalb jeglichen unternehmerischen Planens und Handelns: Die öffentliche Hand bezahlt nicht, die Hausbank ist pleite, eine zweite Bank steht kurz vor der Pleite und verdient mit den Kreditverkäufen an Hedgefonds und staatlichen Liquiditätshilfen, ein Insolvenzverwalter sahnt fünfstellig ab und macht platt, obwohl das Unternehmen real und nach dem Gesetz rettbar ist, die Justiz schaut zu und verfolgt den Falschen wegen »vorsätzlicher Insolvenzverschleppung«. Dann die Zwangsversteigerung der Immobilie, die inzwischen das Rückgrat des Neuanfangs war, an »Schnäppchenjäger«, schließlich Zwangsräumung mit groben behördlichen Fehlern. Wertgegenstände verschwinden. Nun alles weg. Es geht hier um mehr als eine individuelle Biographie und deren persönliche Aufarbeitung, sondern um den Zustand der Sozialen Marktwirtschaft, den Schutz und die Förderung von Kleinbetrieben, um Psychologie und zukunftsorientierte Wirtschaftsphilosophie mit einer anderen Ethik. Das alles mitzuteilen ist in einer phantasievollen, mutigen, analytischen und auch unterhaltenden, sogar selbstironischen Weise ausgeführt. Jedes der siebenundzwanzig Kapitel steht für sich. Alle zusammen zeigen in ihrer Vielschichtigkeit des Aufarbeitens den roten Faden dieses Pechs. Der Autor Michael Beck kann noch lachen, auch auslachen und schimpfen! Beim Lesen fällt jedem der Groschen: das kann es nicht sein. Jemandem wurde übel mitgespielt. Jemand empört sich und deckt auf. Was anderes bleibt ihm nicht übrig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Autor Michael Beck
Aufgewachsen in Ludwigsburg, dort Abitur am Mörike-Gymnasium (1971).
Dann Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Erlangen-Nürnberg mit dem Abschluss Diplom-Sozialwirt. Promotion auf dem Gebiet der Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Tätigkeiten und Projekte als Dozent/Trainer/Berater, Politische Bildung, Jugendarbeit, Soziale Kulturarbeit. Ausbildung Gesprächspsychotherapie in Innbruck.
Wissenschaftlich-Pädagogische Anstellungen an den Universitäten Erlangen-Nürnberg und Bamberg. Danach Bildungsreferent beim Bildungswerk der Wirtschaft. Später selbständig mit dem sozialwirtschaftlichen Bildungsinstitut bfe-Bildungspark, Sitz in Nürnberg und dem Seminarhotel “Schloss Daschow“. Es erfolgt die Insolvenz; danach Abwicklungsarbeiten und Neuaufbau des Kleinbetriebes „Landhotel Schloss Daschow“, welches in der Finanzkrise versteigert wird. Dann der zweite berufliche Neustart als Personalentwickler/Personalberater, Wohnsitz Nürnberg
Jüngere Veröffentlichungen vom gleichen Autor:
Michael Beck – Lyrik: Zusammengefasstes Wichtiges
Michael Beck – Fachbuch: Szenario-Plan-Methode
Michael Beck
VERNICHTUNG IN GUTEN ZEITEN
Egobericht Insolvenz
Siebenundzwanzig Essays, Notizen, Anekdoten
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2014
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright (2014) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte bei Dr. Michael Beck
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
ISBN 9783957446503
www.engelsdorfer-verlag.de
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Einleitung – Anmerkungen zu den Essays, Notizen und Anekdoten
I Tatsachen
Die Gründung und das Bestehen des Bildungsinstituts – mit Ideen und Fleiß: der ganz normale, wunderbare Erfolg
Die Ereignisse in Leipzig
Wehrhaft, standhaft – bis zum Schluss
Die Vorfälle in Aschaffenburg
Nichts wie akquirieren!
Arbeitsamt Schwerin, Nebenstelle Parchim/Lübz
Die letzten Rettungsversuche, die scheiterten
Die Hausbank
Beruflicher Neustart, Teil eins: Der Neuaufbau eines Kleinbetriebes – Schloss Daschow wird Hotel und Restaurant
Bankenkrise – Auf Wiedersehen „Soziale Marktwirtschaft“
II Emotionen
Im freien Fall
Über meine Erziehung zum Gemeinsinn und das Vertrauen zum Staat
Die Jahre vergehen – Bericht des Insolvenzverwalters – Suche nach Sinn und Perspektiven
Wie sich mein Dasein in das einer großen Masse fügte
Zensuren – es gibt Gute und Schlechte
Wo ist das Licht am Ende des Tunnels?
Das „Effi-Briest-Syndrom“
III Reflexionen
Die Ethik einer erfüllten Jugend und die spätere
Unternehmenskultur
Psychologie der Freiheit
Der Traum vom liberalen Unternehmer
Vernichtungsprinzip, Teil 1 – Vorüberlegung: Gibt es das?
Vernichtungsprinzip, Teil 2 – Es existiert: Wie funktioniert es?
Vernichtungsprinzip, Teil 3 – Beschimpfung
Mittelstand, Finanzmärkte und Realwirtschaft
IV Randgeschichten
Fest im Glauben
Vom „Adlon“ zur Pommes-Bude Bahnhof Friedrichstraße
Den Tod auf der Autobahn verhindert
Am Postschalter
V Abschluss-Essay
Gelebt, so weiter! Und: Beruflicher Neustart nächster Versuch
Einleitung – Anmerkungen zu den Essays, Notizen und Anekdoten
Dies ist kein Roman und kein Krimi, liebe Leserin und lieber Leser, auch wenn der Text mit all seinen Konstruktionselementen an Überspitzungen in seinen Vorkommnissen und Entwicklungen in einen Vernichtungsprozess hinein allerhand zu bieten hat – wie wenn es nicht real wäre. Das war es aber. Alles hat sich über mehrere Jahre zugetragen und immer wieder entstanden einzelne Kapitel mit Schilderungen, Analysen, Versuchen zu verarbeiten oder etwas aufzudecken. Ich wollte ganz einfach Geschehnisse festhalten, aber auch Einschätzungen versuchen, um mich selber wieder als Person und nicht als Objekt von scheinbarer Willkür zu sehen, zu befreien, den beruflichen Neustart zu schaffen. Daher diese Mischform aus Essays, Notizen und Anekdoten. Bis zu einem Zeitpunkt, an dem ich sagen kann, das meiste dürfte nun vorbei sein, ist alles aufgezeichnet – immer noch mit einem offenen Ende. Die Stellung eines sozialwirtschaftlichen Dienstleisters im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips ist nicht einfach. Der existentielle Neustart nach einer Insolvenz ist noch schwieriger. Ich habe hier geschildert was ich unter guter Arbeit verstehe, die eigentlich überhaupt nicht in eine Insolvenz münden kann. Und ich habe protokolliert wie ein Neustart gelingen könnte, was er über lange Strecken einfach nicht tun will. Wo soll so eine Geschichte herkommen als von einem selbst – deshalb nicht objektiv, sondern so subjektiv wie die Energie, die vorher zum wunderbaren Erfolg des Kleinunternehmens geführt hat. Kein anderer Stil, der changiert vom Erfahrungsbericht, der Analyse, bis zum Pathos der Beschimpfung, ist in der Lage die Wahrheit zu finden, die subjektive Wahrheit deren überindividuelle Teile sehr deutlich werden und teilweise zu einem Portrait der Zeit beitragen. Leider sind es diese „guten Zeiten“ in denen so etwas passieren kann.
Die betriebliche – wie die Privatinsolvenz - scheinen in dieser Gesellschaft tabu zu sein, denn obwohl es in den letzten Jahren Hunderttausende davon gibt, erfährt man wenig darüber, was denn die Betroffenen daraus machen, die Ursachen - wie es passiert ist, in welche Verstrickungen man hineinkommt. Am Anfang der Entwicklung dachte ich auch, das ist eine Krise, schnell wieder da raus, das musst Du mit Dir selbst ausmachen - und keine Öffentlichkeit aufscheuen. Als daraus während des ersten beruflichen Neustarts die Vernichtung eines Lebenswerkes wurde durch den Kreditverkauf der Bank an einen Hedgfond, da ist mir der Kragen geplatzt und es wurde mir klar, zumindest möchte ich mit meinem Fall öffentlich anfragen, ob diese Gesellschaft diesen Turbokapitalismus möchte. Auch auf die Gefahr hin, dass man heute eher als Angestellter beschäftigt ist oder sich sogar in prekären Beschäftigungsverhältnissen befindet und somit wenig Interesse daran hat, zu erfahren, wie es einem Klein- und Mittelbetrieb so geht. Vielleicht ändern sich nach der Lektüre die Einstellungen gegenüber der Existenz solcher Betriebsgrößen und dem was man unternehmerische Energie nennt. Und das glaube ich einfach nicht, dass die Stütze unseres Wirtschaftssystems bis in die entlegensten Regionen hinein, die Klein- und Mittelbetriebe mit ihren Mitarbeitern, dies wollen und für gut heißen. Damit man sich ein Bild darüber machen kann wie man dazu steht, sind hier alle Erfahrungen dazu aufgezeichnet. Dabei konnte ich mir nicht so viel Gedanken über Satzbau und die allerbeste Aneinanderreihung der Sätze machen, es sollte nur alles Empirische und die Gedanken dazu, aufgeschrieben sein - manchmal persönlich mit der ganzen Wucht der Betroffenheit, manchmal wirtschaftsphilosophisch, manchmal mit dem verbliebenen Humor. Welche verschiednen Wörter, Garstige, Vornehme, Wissenschaftliche, Fachjargon dabei verwendet werden entspricht der Motivation zu sagen was zu sagen ist und kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Bitte lesen Sie: haptisch das Papierbuch oder weil es ja heute so ist: das E-Book, auch gut, der Inhalt ist der Gleiche.
Michael Beck
ITatsachen
Die Gründung und das Bestehen des Bildungsinstituts – mit Ideen und Fleiß: der ganz normale, wunderbare Erfolg
Denken allein kann schädlich sein, wenn man daraus nicht die Konsequenz zieht, auch nach dem, was man sich erdacht hat, zu handeln. Wenn das nicht sofort umzusetzen ist, kommt es wohl auf den eigenen Willen an und darauf, den Zeithorizont, den man sich zugesteht, anzupassen. Erfolgt dies nicht, würde jemand wie ich in eine Blockade geraten und vielleicht krank werden. Insofern gehe ich auch ferner liegende Planungen an. In meinen Ausführungen über die Zusammenhänge, Ursachen und Auswirkungen meiner betrieblichen Insolvenzen möchte ich deshalb damit beginnen, über die von mir ausgedachte Gründung der privaten Erwachsenenbildungs-Schule zu berichten.
Das Bildungsinstitut wurde aufgrund einer privaten Initiative gegründet, um Arbeitsmarktchancen von Umweltberufen auszuloten und entsprechende Bildungsgänge auszuarbeiten und anzubieten. Zur fachlichen und öffentlichen Unterstützung wurde ein Umweltkongress kreiert und unter der Schirmherrschaft mehrerer Ministerpräsidenten und Umweltbundesminister durchgeführt.
Gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit und in ihrem Auftrag wurden über viele Jahre praktische Umweltschützer (dabei handelt es sich zumeist um Fortbildungsgänge mit sehr praktischen Anforderungen für Teilnehmer ohne Ausbildungsabschluss), Umwelttechniker, Umweltpädagogen, Umweltinformatiker und Betriebliche Umweltmanager ausgebildet und am ersten Arbeitsmarkt platziert. Im Laufe der Zeit boten auch andere öffentliche Einrichtungen diese Ausbildungsgänge an und der Teilarbeitsmarkt war bald gesättigt. In meinem Bildungsinstitut gab es diese speziellen Bildungsgänge deshalb nicht mehr, dafür etablierten wir uns als allgemeiner Anbieter für verschiedenste berufliche Trainings- und Bildungsgänge.
Wir verfügten über ca. 70 modular anpassungsfähige Seminar-Typen mit eigenen Prüfungen durch Bildungsträger und Fachverbände sowie mit IHK-Abschlüssen. Über 50 festangestellte Mitarbeiter in zwölf bundesweit verteilten Büros sorgten für ein effizientes Bildungsmanagement. Ein Pool von über 350 freien Dozenten stand mit fachlicher Kompetenz für den Lehreinsatz zur Verfügung. Spezielle Abteilungen beobachteten den Arbeitsmarkt, um neue Nischen zu entdecken, die von Arbeitslosen zu besetzen waren, oder um berufliche und betriebliche Trainingsmöglichkeiten und allgemeine Kontakte zu Unternehmen als potenzielle, zukünftige Arbeitgeber herauszufinden.
Ein eigenes Bildungsmodell war dazu da, die Teilnehmer fachlich zu schulen, ihnen aber auch Eigeninitiative und Selbstbewusstsein angedeihen zu lassen.
Das Gesamtkonzept bestehend aus den Arbeitsmarktkontakten, dem Bildungsmodell und den Beratungs- und Vermittlungsmodulen führte nicht selten zu Vermittlungsquoten von nahezu 100 Prozent. Das heißt, fast alle Teilnehmer der Kurse hatten danach eine feste Stelle.
Ein spezielles Verfahren der gruppenweisen Rekrutierung von Arbeitsuchenden kam der Arbeitsmarktproblematik besonders entgegen. Ebenso die aktive, vorausschauende Mitarbeit in Projektgruppen, wie zum Beispiel für die Neuansiedlung von Callcentern oder Warenhäusern in einer bestimmten Region, die zu passgenauen Weiterbildungen und Auswahlverfahren führte und damit zu gezielten und erfolgreichen Vermittlungen.
Im Zuge der Europäisierung führten wir mit Partnern in verschiedensten Ländern gemeinsame, innovative Weiterbildungs- und Vermittlungsprojekte durch. In drei Städten bauten wir anerkannte Fachschulen als feste Bildungseinrichtungen auf. Bundesweit sorgte eine ausgeklügelte Logistik für den entsprechenden Einsatz von EDV und sonstigen Lernmitteln, um auch in entlegeneren Regionen, in denen sich die Ansiedlung eines Bildungsträgers nicht gelohnt hätte, kompetente Angebote machen zu können. Die vorhandenen Schulungskapazitäten umfassten bis zu 1000 Plätzen, zwischen 400 und 930 Teilnehmer insgesamt wurden ganztags unterrichtet.
Die Ausgangslage für neuartige, attraktive Angebote war aufgrund eines soliden, gewachsenen Geschäftsaufbaus immer gut. Organisation und Finanzmittel waren auf Flexibilität, d.h. auf Schwankungen in der Auftragslage und Zahlungsmoral, eingerichtet.
Es gab auch aufregende Jahreswechsel ohne genaue Prognosen, wie gut es weitergehen würde. Die Anspannung war aber nie besorgniserregend. Wir entwickelten weiterhin neue Konzepte, bei Auftragsmangel wurden keine Büros geschlossen, auch Seminare mit zu wenig Teilnehmern wurden nicht abgesagt.
Schließlich sorgte das interne Controlling für eine genauere Verwendung der Mittel. Wenn wir gegenüber dem alleinigen Auftraggeber in Vorleistung gingen, steigerte das vor Ort das Vertrauen in eine gute Zusammenarbeit. Die manchmal intransparente Zuteilung von Kursen war zwar schmerzlich, wir hatten jedoch genügend Stehvermögen, dies auszuhalten. Es gab auch Fälle, dass überraschend ein Bildungsträger von außen Kurse bekam, obwohl er noch keinen Nachweis über eine spezielle Fachkompetenz hatte. Darüber wurde auch gelegentlich in den Medien berichtet, weshalb wir nicht immer glücklich mit unserem Auftraggeber waren. Unsere Aufgabe an sich – allein mit der individuellen Investition einer Weiterbildung jemanden wieder in den Arbeitsmarkt zu bekommen – war aber phänomenal.
Trotzdem kam ein Krisenjahr, in dem sich das flexible System mit seiner bundesweiten Verteilung bewähren musste. In bestehenden Einrichtungen wurden Kurse nicht genehmigt, in völlig neuen Städten kam man dagegen zum Zug. Das bedeutete einen hohen organisatorischen Aufwand. Doch die Auftragslage versprach sich wieder zu verbessern. In einer Region gelang uns ein ganz neues Modell: Aus der Zusammenarbeit mit politischen Vertretern, der halbstaatlichen Wirtschaftsförderung, der Arbeitsverwaltung und unserem Bildungsinstitut, welches Callcenter-Unternehmen für diese Region akquirierte, ergab sich ein enormer Arbeitskräftebedarf für Neuanstellungen, der nur durch den Einsatz von Arbeitslosen zu befriedigen war. Im Vorfeld von Weiterbildungskursen war unser Bildungsinstitut in alle Personalfragen miteinbezogen und richtete eine neue Callcenter-Schule ein. Das Geld für die Investition wurde beschafft, die Schule sollte 80 Plätze für mindestens fünf Jahre haben.
Es war alles vertraglich unter Dach und Fach, doch die Arbeitsverwaltung entsandte keine Teilnehmer, obwohl es einen Bedarf von über 1000 neuen Mitarbeitern gab. Vier neue Callcenter hatten ihre Ansiedlung zugesagt und organisiert, bekamen aber keine Mitarbeiter. Dem Institut fehlten die Gebühren für die eingerichteten Teilnehmerplätze.
Dieses Kooperationsmodell, welches in offensiver und intelligenter Weise ein Arbeitsmarktproblem lösen sollte, scheiterte. Es war der Beginn einer richtigen Liquiditätskrise.
Die Ereignisse in Leipzig
Zur gleichen Zeit führte unser Institut in Leipzig Fortbildungskurse zum „geprüften Personaldisponenten“ – eine Art Personalfachkaufmann/-frau – durch. Auch hier handelte es sich um ein lang vorbereitetes Kooperationsprojekt, um gezielt einer speziellen Arbeitsmarktproblematik zu begegnen. Zwei Landesregierungen der neuen Bundesländer gründeten staatliche Gesellschaften für Arbeitnehmerüberlassung (Zeitarbeit) – als Zwischenstation (nicht als Dauerarbeitsplatz!) für Arbeitslose eine gute Ausgangsposition, um in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Für diese Gesellschaften wurden marktorientierte Personaldisponenten gebraucht, die man unter den gemeldeten Arbeitslosen aussuchte und schulte. Unser Institut entwickelte den Kurstyp, stellte vorab die Arbeitsmarktkontakte her, analysierte den Unterschied zu den kommerziellen Zeitarbeitanbietern, bot die Kurse an und bekam den Zuschlag.
Eines Tages ließ der örtliche Kursstättenleiter die zentrale Koordination wissen, dass ein Dozent mit der entsprechenden Softwareschulung nicht unterrichten würde, weil er bislang sein Dozentenhonorar nicht erhalten hätte. Laut Vertrag war die Zentrale aber mit der Zahlung nicht in Verzug. Der Dozent kam trotzdem nicht. Da der Kurs schon fast zu Ende war, wurden – mit Genehmigung des Auftraggebers – die Teilnehmer der Softwareschulung eine Woche vorher in die Trainingsbetriebe entsandt.
Dies stellte sicherlich einen Mangel in der perfekten Durchführung eines Kurses dar. Andere Mängel waren aber aus dieser Einrichtung in Leipzig nicht bekannt. Sie wurde regelmäßig besucht, unterstützt und von der Geschäftsführung, der pädagogischen Leitung, dem Controller und dem Qualitätsbeauftragten überprüft. Bei keiner Visitation wurde irgendeine negative Auffälligkeit entdeckt. Also alles in Ordnung. Auch dieser Kurs wurde bis auf diesen kleinen Mangel ordnungsgemäß zu Ende geführt und die Teilnehmer bekamen ein Arbeitsplatz.
Mehrere Monate später nahm der Verwaltungsleiter des Instituts an einer Besprechung im Arbeitsamt Essen teil. Nachdem alle ein neues örtliches Projekt betreffenden Fragen erledigt waren, teilte ihm der Abteilungsleiter des Amtes mit, dass man weiter mit dem Institut zusammenarbeiten würde trotz des Intraneteintrages aus Leipzig. Das Instrument des Intraneteintrages war uns nicht bekannt. Was lag vor? Welche Auswirkungen sollte das haben können? Aus Leipzig erhielten wir auch keine Mitteilung.
Ich fuhr nach Leipzig in das Verwaltungsbüro für zusammengefasste Aufgaben beim Arbeitsamt. Ich sprach vor und man sagte mir, gegen das Institut läge nichts vor. Wir könnten Angebote machen wie bisher. Es gäbe einige Dinge, die wir routinemäßig nachweisen sollten, dann wäre alles in Ordnung. Eine schwarze Liste gäbe es nicht.
In Folge ging es um Unterstellungen, deren Gehaltlosigkeit leicht nachweisbar war. Einmal sollte die Bezahlung der Sozialversicherung bei einem freien Dozenten nachgewiesen werden, was schlecht möglich war. Alles kostete Zeit und Nerven und keiner wusste, was ein Intraneteintrag ist und was dieser bewirkt.
Immer nachdem neu angeforderte Nachweise erbracht waren, wurden wieder neue Nachweise verlangt, und jeweils wurde mündlich zugesagt, der Eintrag würde nun gelöscht werden. Er wurde aber nicht gelöscht. Inzwischen hatten ihn zig potenzielle Auftraggeber gelesen, ohne dass sie eine Ahnung von dem inzwischen 14 Jahre bestehenden Institut hatten.
Wir baten auch die Zentrale der damaligen Bundesanstalt für Arbeit , uns aufzuklären. Dort wollte man dann auch alle möglichen Nachweise, die wir ordnungsgemäß einreichen konnten und deren Sinn unsere Verwaltung nicht verstand. Im Gegenzug baten wir darum, die Zahlungen an uns zu beschleunigen, weil inzwischen unsere Auftragslage zunehmend ins Stocken geriet.
Inzwischen hatten wir selbst die lokalen Arbeitsämter, bei denen Kurse liefen oder eingereicht werden sollten, über den ganzen Sachverhalt informiert. Über 20 Kurse wurden nach extra anberaumten Qualitätsprüfungen der Behörde fortgesetzt – ein wunderbarer Vertrauensbeweis – und knapp 20 Kurse wurden neu zur Genehmigung eingereicht.
Eine weitere dringende Kontaktaufnahme mit der zuständigen Stelle bei der Zentrale der Bundesanstalt sollte den Zweck erfüllen, auf die sich zuspitzende Situation hinzuweisen: Einerseits sei man im Intranet negativ gelistet, andererseits sollten neue Kurse genehmigt werden und auch die Kursgebühren würden nur schleppend angewiesen. Die Dame am Telefon sagte mir nur, es gäbe über 40.000 Bildungsträger, da hätte man jetzt keine Zeit für unser Anliegen.
Vorbereitete Kurse in weiteren fünf Städten waren genehmigt, rechtsgültige Verträge mit den Studienteilnehmern lagen vor, die Kursbeginne rückten immer näher – auf einmal stornierten die zuständigen Arbeitsämter von sich aus den Kursbeginn.
Bis zu diesem Zeitpunkt konnte unser Institut allen Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Niemand wurde freigestellt. Aber mit dieser geballten Aktion ging es in Richtung Insolvenz. Gegen die Stornierung der Kurse konnten wir nichts machen. Die Zeit der noch laufenden 23 Kurse ging langsam zu Ende. Das würde es dann gewesen sein. Aus das Lied.
Seit den ersten Signalen einer Liquiditätskrise war über ein halbes Jahr vergangen, ohne dass wir hätten eingreifen können, weil wir von der nachrichtendienstähnlichen Methode des Intraneteintrages erst fünf Monate nach Eintrag von jemandem erfahren hatten, der über seine Dienstverpflichtung hinaus ganz einfach dachte, wir müssten das wissen.
Die Ereignisse überschlugen sich. Inzwischen hatte sich im Zuständigkeitsbereich des den Eintrag auslösenden Arbeitsamts Folgendes zugetragen: Der dortige Kursstättenleiter kündigte und bat um eine vorzeitige Beurlaubung, weil er sich als Rechtsanwalt freiberuflich betätigen wollte. Das Bildungsgeschäft wäre ihm zu unsicher geworden. Keiner hatte nur den leisesten Verdacht, dass das nicht stimmte. Längst hatte er alle von uns jahrelang durchgeführten Kurse beim Arbeitsamt eingereicht und noch während seiner Anstellung genehmigen lassen. Keinem seiner langjährigen Kollegen, die ihn auch sonst unterstützen, war etwas aufgefallen.
Noch besaßen wir die Kraft, sofort einen neuen Kursstättenleiter zu engagieren. Der Intraneteintrag bestand nach wie vor. Wir stellten den neuen Kollegen in der Behörde vor und wurden, wie man so schön sagt, scheißfreundlich empfangen.
Ich bekam noch einen extra Termin bei der aus München nach Leipzig versetzten Abteilungsleiterin. Sie saß hinter ihrem Schreibtisch, ich durfte an dem daran rechtwinklig angelegten Besprechungstisch sitzen und hinter meinem Rücken auf einem Stuhl in der Ecke des Zimmers saß eine Sachbearbeiterin mit einem Schreibblock – die sogenannte sowjetische Sitzordnung, wie man mich einmal aufklärte. Ein Verhör. Ich verzichtete darauf und las diesen zwei Hyänen die Leviten: „Ich gestatte Ihnen nicht, die Verantwortung für den Intraneteintrag zu leugnen und zu behaupten, Sie könnten dafür nichts“. Dieser Satz war und ist für mich wichtig, von den beiden Damen wurde er nicht verstanden.
Ich verließ das Büro und ging durch die ultramodernen Gänge mit überall aus den Lautsprechern tönender Hintergrundmusik hinaus. Und kam nie wieder. Wir hatten dort keine Kurse mehr. Die noch laufenden Kurse wurden an einen anderen Bildungsträger ohne Einhaltung von Copyright übergeben: „Abgewickelt“.
Wehrhaft, standhaft – bis zum Schluss
Von nun an musste unsere Verwaltung immer wieder die unterschiedlichsten Nachweise erbringen, was wir auch leisten konnten, einschließlich der Nachweise anderer Behörden wie Finanzamt etc. Was im Dunkeln blieb, waren die Namen der Dozenten, die in dieser Angelegenheit auch eine Rolle spielten. So konnten wir nicht einschätzen, was hier eigentlich passierte und was davon der Wahrheit entsprach.
Auch ich fuhr dann noch drei Mal nach Leipzig. Die sogenannten Besprechungen fanden im Büro der Z-Büro-Leiterin (das war damals die Abteilung für „zusammengefasste Aufgaben“, in der viele maßgebliche Entscheidungen bzgl. der Bildungsträger gefällt wurden) statt. Sie saß vor mir auf Distanz hinter ihrem Schreibtisch , mein Gesicht war zum Licht des Fensters gewandt, hinter mir saß die stellvertretende Abteilungsleiterin, bereit alles mit zu protokollieren. In keinem der drei Gespräche ging es um etwas Konkretes zu meinem Fall. Angeblich gab es keine Negativlisten oder Einträge. Gegen uns läge nichts vor. Wir könnten jederzeit Bildungsangebote einreichen. Die Bearbeitung unseres Falles wäre schon sehr fortgeschritten, usw., usw. Trotz aller hoch disziplinierten Anstrengungen war keine Klärung möglich, geschweige denn Informationen zu bekommen, sich auszusprechen, Anhaltspunkte zu erhalten oder irgendwelche Probleme zu lösen.
Beide Frauen waren sich über die Sitzordnung sehr im Klaren und wussten sehr genau, dass ihre gezielte Gesprächsführung eine einwandfreie Verzögerungstaktik war. Der Intraneteintrag hatte Zeit, nicht nur Papier ist geduldig; aber wie lange noch unser Bildungsträger, damit fertig zu werden?
Und dann kam der Gipfel der Infamie, vorbei an amtsinternen Verordnungen, eine professionell vorgebrachte Lüge, die das kriminelle Verhalten unseres ehemaligen Mitarbeiters schützte, also ebenso als kriminell zu bezeichnen ist: Beim Bildungsträgertreffen versicherte diese Abteilungsleiterin allen anwesenden Bildungsträgern, dass das Landesarbeitsamt einen Erlass herausgebracht hätte, zum Jahreswechsel grundsätzlich keine neuen Bildungsträger im Bezirk zuzulassen. „Unser Neuer“ – das heißt, unser ehemaliger Kollege – war wohl die berühmte Ausnahme. Diese Veranstaltung verhalf ihm dazu, dass Vermutungen oder Verdächtigungen in keinster Weise in die Richtung gingen, dass er den Intraneteintrag veranlasst hätte. Er hatte sich ja mit einer klaren Begründung förmlich verabschiedet und dies als Kündigungsgrund angegeben. Da waren seine Tücher mit Hilfe von den drei bis vier Mitarbeitern des Arbeitsamtes Leipzig bereits im Trocknen.
Warum es überhaupt nötig war, unsere Vernichtung anzustreben, ist mit meinen mitteleuropäischen Berufserfahrungen nicht zu erklären. Nachdem wir immer wieder die Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit konsultieren wollten und um Hilfe, um ein Gespräch oder entsprechende Informationen baten, was rundum kategorisch verwehrt wurde wie in Kafkas „Das Schloss“, fingen wir an, an uns selbst zu zweifeln. Inzwischen wurden wir überall sogenannter Trägerprüfungen unterzogen, die im Prinzip durchweg positiv verliefen. Dennoch durften die fast 20 vorbereiteten, eingereichten und vorab genehmigten Kurse nicht beginnen.
Schon seit mehreren Jahren führten wir im Herbst einen mehrtägigen Erwachsenenbildungs-Kongress mit kleiner Messe durch. Hier war unser ganzes Team gefordert, einem professionellen, ausgewählten Publikum ein gutes Event zu bieten. Wegen der angespannten Situation war dieses Jahr unser Verwaltungsleiter nicht mit dabei, sondern er war zur Verabredung einiger Einzelheiten bei einem neuen Auftraggeber in Westdeutschland. Völlig unüblich und ungewohnt für diesen Event wurde ich ans Telefon gerufen. Mein Verwaltungsleiter überbrachte mir eine unklare Nachricht über einen aus Leipzig kommenden Intraneteintrag, von dem man ihm unter vier „inoffiziellen“ Augen berichtet hätte. Für mich war alles vollkommen unverständlich, weil ich ja aus den erwähnten Gründen in letzter Zeit mehrmals in Leipzig war. Welche Tragweite diese Art nachrichtendienstliche Verfolgung hatte, konnten wir nicht einmal ahnen, dazu fehlte uns jegliche negative Erfahrung mit unserem bisherigen staatlichen Auftrageber. Ich bat ihn sofort, das Arbeitsamt in Leipzig anzurufen und einen Termin zu vereinbaren. Der Kongress lief weiter. Mein Kollege fuhr gleich am nächsten Tag weiter nach Leipzig und kam mit einer kleinen Liste, welche Nachweise wir zu bringen hätten, zurück in unser Koordinationsbüro der kleinen Hauptverwaltung. Teilweise betrafen diese Nachweise überhaupt nicht den Standort Leipzig und es ging auch nicht um Mängel, weil wir unmittelbar nachweisen konnten, dass unsere Abläufe korrekt waren.
Ein weiterer Vorwurf war, dass die Dozenten (völlig verallgemeinert) ihr Gehalt nicht bekommen würden. Über 90 Prozent unserer Dozenten waren auf Honorarbasis verpflichtet, die Honorarauszahlung war aus verschiedenen sachlichen Gründen unterschiedlich geregelt, was aber in den jeweiligen Verträgen festgehalten war. Also konnten wir auch hier die entsprechenden ordnungsgemäßen Nachweise erbringen. Bis auf einen: den desjenigen Dozenten, der am Ende eines Weiterbildungsprojektes seinen Dienst nicht antrat mit der Begründung, er hätte sein Honorar nicht bekommen, was, unsere Fristenlösung eingerechnet, nicht stimmte. Im Gegenteil: Er hatte seinen Vertrag grob fahrlässig nicht eingehalten, weil er in dieser Woche einen anderen, attraktiveren Beratungsauftrag hatte. Seine Pflichtverletzung hatte er perfide in die Denunziation umgebogen, wir wären unseren Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen. Erst mit der von ihm nicht durchgeführten Unterrichtseinheit mit Klausur wäre sein Modul beendet und die Honorarzahlung fällig gewesen. Das Arbeitsamt hatte diesen Zusammenhang nicht überprüft, sondern aus dieser vermeintlichen Beschwerde die schärfste und heimtückischste Waffe des Intraneteintrags geschmiedet. Zu diesem Zeitpunkt waren wir somit bei allen Arbeitsämtern der neuen Bundesländer vogelfrei. Später führte dies zu unserer Vernichtung. Zu diesem Zeitpunkt hatte einer einen gewaltigen Vorteil davon: Der Mitarbeiter, der sich viele Monate vorher unter Absprache mit dem gleichen Arbeitsamt selbstständig gemacht hatte, der noch während seiner Festanstellung die bfe-Instituts-eigenen Maßnahmebögen als seine eingereicht hatte, der die Beschwerde dieses Dozenten inszeniert hatte, indem er ihm riet, sich bei der Behörde zu beschweren, und der den Vorgesetzten und Kollegen nach Nürnberg meldete, der Ausfall dieses Moduls sei kein Beinbruch und mit dem Arbeitsamt abgesprochen, ein vorgezogener Beginn der praktischen Trainingszeit sei genehmigt.
Mit unseren Büros und Weiterbildungsprojekten waren wir bis dato noch an über 15 Standorten vertreten. Die laufenden Kurse sowie die über 20 im Einsatz befindlichen Dozenten bedurften bei der sich mittlerweile einstellenden Gerüchteküche und Rufschädigung einer besonderen Betreuung. Wie sich später herausstellte, hatten Festangestellte ihre Diebestour auch bereits in Bochum, Suhl und Nürnberg vorbereitet, um uns Kurse wegzunehmen. Auch im „vertrauten“ Kreis spürte man also, dass es kein leichtes Arbeiten war.
Immer noch nicht aufgegeben war der mögliche Beginn der fast 20 Kurse; um diese Standorte mussten wir uns besonders kümmern – ohne Erfolg. Hinzu kamen völlig neuartige Aufgaben bei Bank, Steuerberater, Finanzamt etc. incl. Tuchfühlung mit rechtsanwaltschaftlichen Dingen, die uns wegen der persönlichen Unbedarftheit völlig zu absorbieren schienen.
Eines Tages hatte das verbliebene Nürnberger Team einen viele Seiten umfassenden Brief an das Büro des damaligen Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit verfasst und abgeschickt. Er wurde nie beantwortet.
Ein paar Wochen später, nachdem sich vieles ereignet hatte, bat ich unser Rest-Team gemeinsam die Mittagspause zu verbringen. Wir machten einen fast zweistündigen gemeinschaftlichen Spaziergang und kehrten dann ein, um eine Suppe zu essen. Wir hatten kaum miteinander geredet, keiner konnte das Wort Intraneteintrag oder den Namen des ehemaligen Kollegen mehr hören.
Dies war der Abschied von meinen teilweise über vierzehn Jahre lang liebgewonnenen und geschätzten Mitarbeitern, Kollegen, Freunden und Partnern. Diese vier Stunden des letzten Tages entsprachen unserer emotionalen und geistigen Dichte, die uns immer so leistungsfähig und flexibel machte. Wir pflegten die Verteilung von Verantwortung in einer flachen Hierarchie, auch wenn ich manchmal doch der Chef sein durfte oder musste. So auch in diesem Augenblick, in dem ich entschied, meinem Team mitzuteilen, dass dies der vorgezogene diesjährige Betriebsausflug und gleichzeitig die Verabschiedung sei. Wir müssen uns verabschieden und jeder seinen Weg gehen.
Die Vorfälle in Aschaffenburg
Nach der weitgehenden Auflösung unseres Büros in Nürnberg, Neutorgraben, ging es darum, den Rest im Prinzip noch gut gehender Kurse mit einem kleineren Team zu betreuen – auch in der Absicht, im Herbst die bereits eingereichten weiteren 16 Kurse durchführen zu dürfen und zu können.
In unserer Kursstätte in Aschaffenburg ging es zunächst um die Beauftragung einer gruppenweisen Schulung und Rekrutierung von Fachpersonal für den Möbelhandel. Für derartige Problemlösungen und eine Zusammenarbeit mit externen Auftraggebern war das Arbeitsamt Aschaffenburg sehr gut vorbereitet. Die Signale am Arbeitsmarkt für passende freie Stellen wurden dort erkannt. Ein rein für den Außendienst zuständiger, kompetenter Arbeitsvermittler war dafür abgestellt, die internen Abteilungen waren darauf vorbereitet. Es wurde partnerschaftlich und sachorientiert kommuniziert, unbürokratisch gehandelt, sogar amtsbezirksübergreifend rekrutiert und informiert, es schien ein neues Modellprojekt zu werden, von einzelnen vernachlässigbaren Unebenheiten abgesehen.
Zwei Dinge waren bei der Vorbereitung und in der Startphase auffällig: Ein einziger Möbelhändler als zukünftiger Arbeitgeber drängte sich sehr in den Vordergrund, als ob er das alles bezahlen würde, und trotz des eher spektakulären Projektes blieb der Arbeitsamtsdirektor im Hintergrund.
Es kam unser bereits praktizierte Instituts-Modell zum Tragen: Wir informierten und berieten die möglichen Teilnehmer, wählten sie aus und stellten die Kurse zusammen – schon Monate vor dem Beginn!
Als „fliegender Bildungsträger“ hatten wir sehr gut geeignete Räume gefunden. Die Dozenten zeigten ihre bewährte Mobilität, die ihnen auch Spaß machte, die ganze Organisation ging von Nürnberg aus. Sprecher in den Gruppen sorgten für ein transparentes, demokratisches Klima und unterstützten das für unsere Erwachsenenbildung nötige Sozialgefüge.
Die Gruppenzusammensetzung war selbstverständlich nicht optimal. Wer kann grundsätzlich schon erwarten, dass aus einer völlig heterogenen Ansammlung von Arbeitslosen aus Aschaffenburg eine völlig homogene, fein geschliffene Bewerbergruppe entsteht. Wer tagtäglich mit dem Arbeitsmarkt und seinen Menschen zu tun hat, kennt die Problematik. Hier standen wir auch Schulter an Schulter in einheitlicher Meinung mit den entsprechenden Mitarbeitern des Arbeitsamtes. Diese Art „Kollegialität“ und Vertrautheit kannte ich schon von vielen solchen Begegnungen. Unsere Erkenntnisse waren gepaart mit einer unausgesprochenen Solidarität und sozialen Nähe zu diesen arbeitslosen Mitbürgern.
Der kleine Unterschied zwischen Arbeitsamt und uns war allerdings, dass wir als Bildungsträger eine unausgesprochene und vertraglich nirgendwo stehende Verpflichtung eingegangen waren, mit einer Bildungsmaßnahme alle Teilnehmer in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Das war unser Problem. Ein Teil der Kursteilnehmer würde mit dem erreichten Klassenziel einen sehr guten adäquaten Arbeitsplatz bekommen. Ein anderer Teil aber nicht, weil er bald glauben oder gar der Überzeugung sein würde, dass er nicht geeignet wäre, dass kein Arbeitsplatz in Wohnnähe wäre usw. Hier setzten dann unsere Beratungskompetenz und vor allem auch die höheren Motivationskünste ein, um bei diesen Teilnehmern Potenziale zu wecken, damit auch sie die subjektiv-richtige Stelle finden würden.
Aus professioneller Sicht lebenslanges Lernen zu organisieren ist so eine Situation für Andragogen nicht ganz so schwierig, wie sie sich anhört: Teilnehmer eines Weiterbildungskurses können sich positiv mit ihrer Lebenssituation auseinandersetzen, das Lernen wieder lernen, konkrete Einmündungswege mit allen Tricks kennen lernen und ausprobieren und nicht zuletzt auch neue Fachinhalte lernen, die generierbar sind. Sie können über einen geschützten Versuch-und-Irrtum-Vorgang zu einem neuen Selbstbewusstsein kommen und mit konkreten Tipps oder sogar konkreten Arbeitsstellen versorgt werden.
Wenn Not am Mann war, übernahmen wir die Verhandlungen mit dem potenziellen Arbeitgeber bis diesem schwindelig wurde oder er vor lauter schlechtem Gewissen danach in die Kirche ging. Wenn man uns die Türe wies, kamen wir zu einer anderen Türe wieder herein und standen erneut auf der Matte. Bei gruppenweisen Vermittlungen stellten wir die Arbeitgeber vor die Alternative: zwei gute Bewerber und einen schlechten oder keinen. Unser Institut hatte dadurch nicht selten eine Vermittlungsquote von fast 100 Prozent.
Auf diese Situationen, die sich meistens im letzten Drittel eines Kurses abspielen, waren wir bereits innerlich und organisatorisch vorbereitet. Wichtig war es, neben der Vermittlung fachlicher Inhalte permanent das persönliche Befinden der Teilnehmer einzuschätzen und sie auch emotional zu begleiten. Und ebenso wichtig war es, rechtzeitig adäquate sogenannte Praktikumsplätze zu haben, das heißt potenzielle Arbeitsplätze, die in Unternehmen aus einer Trainingssituation nach der Theoriephase entstehen können. Solche Möglichkeiten zu finden und sie richtig einzuschätzen, war eine zentrale Kompetenz, auf die wir sehr stolz waren. Denn kein Personalleiter oder Unternehmer ließ immer „die Katze aus dem Sack“ und offenbarte eine offene Stelle, die er schon gar nicht dem Arbeitsamt gemeldet hatte. Es war also eine aufwendige und komplizierte Analyse, durch die wir auch dank unserer langen Erfahrung und unserer Intuition herausfanden, wo eine zumindest mittelfristige Position entstand. Hinzu kam grundsätzlich, dass Unternehmen nicht nur misstrauisch gegenüber Arbeitslosen sind, sondern auch in einer gleichbleibenden Ertragslage aus den bekannten Gründen eines überregulierten Arbeitsmarktes prinzipiell lieber keine neuen Mitarbeiter einstellen wollen.
Die Kurse in Aschaffenburg waren wie die meisten unserer Kurse bewegt, durchwachsen, sehr gut durchorganisiert, trotzdem vor Überraschungen nicht gefeit, manchmal hochemotional und ohne den Anteil an Idealismus aller Mitarbeiter undenkbar. Eine Art Dienstleistung total, zwischen hoher Professionalität auf der einen Seite und der Gestalt eines Sackes voller Flöhe auf der anderen. Aber am Ende würde es wieder so sein wie immer: Die Leute sind untergebracht, sie haben ein seriöses Zeugnis für die Zukunft, die Arbeitsamtskasse hat wieder Einzahler und kann etliche Zahlungsempfänger von ihrer Liste streichen. Eine nützlichere Arbeit kann ich mir als Erwachsenenbildner eigentlich nicht vorstellen. Mit dieser inneren Zufriedenheit kann ich auch auf jegliches Danke vom Teilnehmer, vom Mitarbeiter, vom Arbeitsamt oder vom eingesetzten Dozenten verzichten.
Inzwischen schwappte die Liquiditätskrise von Leipzig, Gera, Suhl und Schwerin kommend auf unsere „gesunden“ Kurse über. Meine eigene Solidität geriet in Gefahr. So langsam aber sicher konnten wir nicht mehr wissen, was noch passieren würde. Immerhin gab es schon ein paar wenige, aber penetrante Dozenten, die berechtigt oder unberechtigt ihr Honorar anmahnten und sich einer der deutschesten Tugenden hingaben: Sie beschwerten sich nicht bei unserer Verwaltung, sondern sie denunzierten. Wenn nun der so vom Denunzianten Angesprochene diese „Information“ nicht an den Betroffenen gibt, wo sie zur Lösung des eventuellen Problems hingehört, sondern sie ohne Anhörung, Erörterung, Diskussion, Verteidigung, Stellungnahme, Lösungsvorschlag negativ interpretiert, falsch interpretiert, nicht überprüft aktenkundig macht, in irgendeiner Weise weitergibt, ohne den Betroffenen mit einzubeziehen, dann wird die Denunziation zur Verfolgung, zur Hetze, zur Vernichtung – vor allem, wenn der Tatbestand entsprechend verfälscht ist und der sich selbst abspulende Entwicklungsprozess nicht aufgehalten wird.
So weit hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht gedacht. Ich dachte nur, ich müsse etwas tun, zumindest informieren und auf Hilfe und Verständnis hoffen. So beschloss ich, beim Arbeitsamt vorzusprechen. Meine beiden Ansprechpartner waren an diesem Tage nicht im Amt. Also klopfte ich bei der zentralen Verwaltungsstelle an und traf auf einen Mitarbeiter dieses Büros, den ich kannte und der mir sympathisch war. Ich schilderte meine Vermutungen, was die Ursachen der falschen Informationen, der Gerüchte, der Vorhaltungen anging, aber auch die sich abzeichnenden Schwierigkeiten die, wenn nichts geschehen würde, bald auch die Aschaffenburger Kurse treffen würden. Ich merkte, dass ein Gespräch und eine Begegnung dieser Art in diesem Zimmer und in der ganzen Laufbahn dieses Beamten noch nicht vorgekommen waren. Und hätte ich nicht beruflich mit dem Thema Körpersprache zu tun gehabt, hätte ich die Sprachlosigkeit nicht interpretieren können. Das heißt, die Reaktion dieses erstaunten und voller Mitgefühl erscheinenden Menschen habe ich wahrscheinlich richtig interpretiert. Was ich aber falsch einschätzte, war dieses Amt, diese Behörde, diese bürokratische Anstalt. Denn von der Reaktion dieses einzelnen Menschen entwickelte sich nichts weiter in Richtung einer weiteren Erörterung mit anderen maßgeblichen Personen, geschweige denn in Richtung einer Problemlösung.
Was sich in der vertrauensvollen und empathischen Situation zwischen dem Beamten und mir abspielte, war in keinster Weise multiplizierbar. In meiner Wahrnehmung und Phantasie in diesem Zimmer, in dieser Gesprächssituation erkannte ich nicht die symbolische Kommunikation eines Fallbeils oder jemanden, der versucht mir die Haut abzuziehen oder auf den Kopf zu scheißen.
Mit der klaren Vorstellung, wie das Aschaffenburger Problem, wenn es größer wird, zu lösen wäre, machte ich mich auf den Weg nach Nürnberg, in der Aschaffenburger Kursstätte war schön längst niemand mehr. Auf der Rückfahrt klingelte zwei Mal das Handy von zu Recht besorgten Dozenten, denen ich glaubwürdig meine positive Strategie mitteilte. Ich hoffte darauf, dass sich diese positive „kämpferische“ Stimmung am nächsten Unterrichtstag verbreiten würde.
Dies traf zu. Aufgrund der sich zuspitzenden Lage sprang ein Dozent ab, ein anderer, loyaler sprang ein. Die Situation war gerettet. Der Zeitpunkt fiel zusammen mit einem Anruf des Arbeitsamtsdirektors aus Aschaffenburg bei mir im Büro. Ein langes Gespräch ergab sich. Mir schien, die Stimmung jenes Gespräches in der zentralen Verwaltungsstelle setzte sich tatsächlich im Hause dort fort. Der Arbeitsamtsdirektor erklärte mir, man sehe die Sache nüchtern, man sehe sich in der Lage, trotz merkwürdiger Irritationen die Kurse bis zum Schluss zu retten. Sorgen bereite ihm das anerkannte Zeugnis des Verbandes, der ja wegen unserer drohenden Insolvenz abgesprungen sei. Ich sagte, ein anderer Verband, der umfassende Erfahrungen in der Aus- und Weiterbildung hätte, hätte sich bereits zur Verfügung gestellt, die Prüfungskommission zu bilden und ein gültiges





























