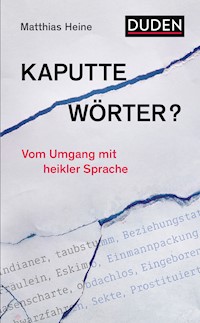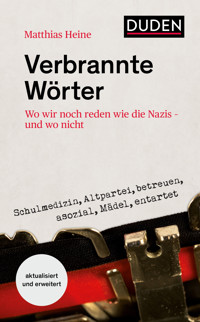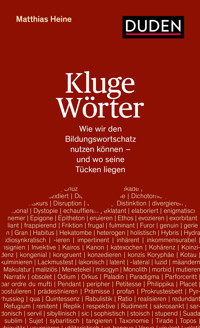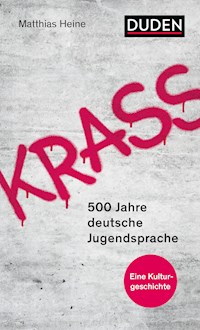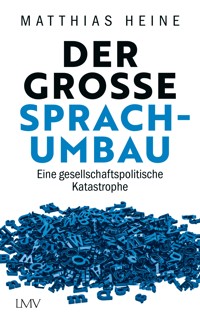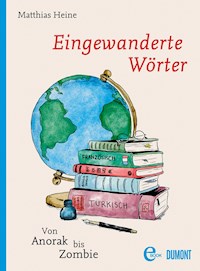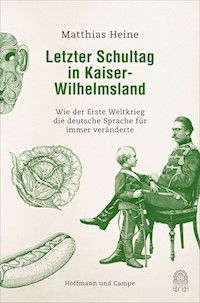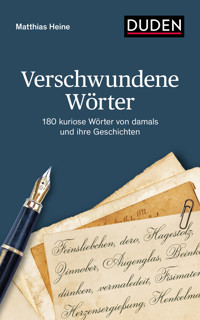
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliographisches Institut
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Duden - Sachbuch
- Sprache: Deutsch
"Jedes alte Wörterbuch ist ein Zwischenreich, in dem unter lauter bis heute Lebenden die Geister gestorbener Wörter umherspuken." In diesem Sinne hebt Matthias Heine liebenswerte Kulturgeschichten: Von Wörtern wie "lützel" oder "Zagel", die schon lange außer Gebrauch sind, bis hin zu solchen, wie "Schupo" oder "Knabe", die kaum jemand mehr aktiv benutzt. Manche sind mit großer Literatur verbunden wie "Feinsliebchen" in den Gedichten Heinrich Heines. Manche sind sentimentale Erinnerungen an die eigene Jugend oder den Sprachgebrauch der Eltern und Großeltern wie "Manchesterhose" oder "bohnern". Alle eint, dass der sprachliche Wandel sie langsam aber sicher in der Vergangenheit zurücklässt. Schauen wir noch einmal auf sie zurück!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matthias Heine
Verschwundene Wörter
Warum Wörter verloren gehen – und doch ewig leben
Jedes alte Wörterbuch ist ein Zwischenreich, in dem unter lauter bis heute lebenden die Geister verlorener Wörter umherspuken. Etwa die Hälfte der Lemmata zu Beginn der Buchstabenstrecke A im »Grammatisch-kritischen Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart«, das Johann Christoph Adelung zwischen 1774/93 und 1801 veröffentlichte, ist heute in keinem neueren großen Wörterbuch der Gegenwart mehr zu finden – weder im »Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache« aus der DDR noch im gedruckten achtbändigen Universalduden und nicht einmal im überaus umfangreichen Online-Duden.
Die reichhaltige Strecke von Fachbegriffen rund um den Aalfang, die Adelung verzeichnet, gibt einen guten Hinweis auf einen der Gründe für den Verlust von Wörtern: Die damit bezeichneten Phänomene und Tätigkeiten existieren nicht mehr oder sind zumindest aus dem Alltag der meisten Deutschsprecher verschwunden. Früher war der fettreiche Aal für viele Menschen ein wichtiges Grundnahrungsmittel, aber mit der Notwendigkeit des Aalfangs verschwand die Notwendigkeit, einen ausdifferenzierten Wortschatz dafür zu haben. Heute braucht kein Mensch mehr Wörter wie Aalhälter, Aalquast oder Aalpuppe, und man staunt, wenn sich Aalleiter, Aalreuse und Aalspeer überhaupt noch in einem allgemeinsprachlichen Wörterbuch finden.
Der Wörterschwund betrifft in gleicher Weise obsolete oder industrialisierte Handwerkstätigkeiten. Mit der gewerbsmäßigen Weberei verschwand das bei Adelung verzeichnete Wort abbäumen für die Tätigkeit, bei der man das fertige Gewebe von einem Baum mit seinem runden, starken Holz, um das es gewickelt worden war, wieder abnahm. Und mit den Veränderungen in der Metallverarbeitung wurde abäthmen überflüssig, mit dem man das Ausglühen von Luftblasen im heißen Eisen bezeichnete.
Ein ganzes Lexikon füllen Berufsbezeichnungen, die heute nur noch als Familiennamen weiterexistieren. Ein Russe war ein Flickschuster (nach Reuß ›Lederflicken, Schuhflicken‹). Der ➔ Nachtkönig leerte nachts die Latrinen. Ein ➔ Zeidler war ein Waldimker. Ein ➔ Ameisler sammelte Puppen der Insekten, um sie zu verkaufen. In jüngerer Zeit brachten Veränderungen der Berufswelt Wörter wie ➔ Kommis, Tankwart, Posamentierer oder Fahrstuhlführer zum Aussterben. Ebenso verschwanden die Institutionen und Mechanismen, mit denen die alten Berufs- und Standesbezeichnungen verbunden waren. Das Wort ➔ Depositenkasse in Erich Kästners »Emil und die Detektive« versteht heute kein Kind mehr, und die wenigsten Eltern können es ihm erklären. Was genau ein ➔ Couponschneider war, wissen nur noch Spezialisten: ein wohlhabender Mann, der von seinen Aktien lebte.
Dem wirtschaftlichen Wandel, der alte Berufsbezeichnungen verschwinden ließ, gingen oftmals technische Veränderungen voraus. Neue Erfindungen ersetzten etablierte Gerätschaften, Werkzeuge und Maschinen, sodass deren Bezeichnungen ebenfalls überflüssig wurden. Das Tastentelefon überholte die alten Apparate mit Wählscheibe, und die Fließbandproduktion ließ in den 1950er-Jahren in Westdeutschland Autos mit Metallkarosserie erschwinglich werden, was den ➔ Leukoplastbomber aus Kunststoff vom Markt verdrängte. Veränderte Materialien beim Hausbau machten ➔ Trockenwohner entbehrlich, und die industrielle Massenproduktion von billigen Kleidungsstücken untergrub das Geschäftsmodell der ➔ Monatsgarderoben.
Doch der Wörterverlust kann noch viele andere Ursachen haben. Soziale und politische Veränderungen führten dazu, dass Titel und Bezeichnungen unverständlich wurden – den ➔ Rentmeister kennt man heute noch am ehesten, weil eine Figur in Fontanes Roman »Der Stechlin« Rentmeister Fix heißt. Auf den Pedell, einen Universitätsdiener, der Studenten in den Karzer, die Arrestzelle der Uni, schleppen konnte, stößt man nur noch in der Prosa Heinrich Heines und anderen Texten über das akademische Leben im 18. und 19. Jahrhundert. Als ➔ Hagestolz wird heute niemand mehr verspottet, weil Ehelosigkeit und/oder Homosexualität nicht mehr als Stigma gelten. Keine Frau will noch als Fräulein angeredet werden, weshalb es auch kein Fräuleinwunder mehr gibt – ein ursprünglich in den frühen 1950er-Jahren für das US-Magazin »Time Life« geprägter Begriff für die modernen, jungen, westdeutschen Frauen.
Manche dieser Wörter gingen mit dem politischen System unter, dem sie verhaftet waren. Das gilt nicht nur für das offizielle und propagandistische Vokabular. Es traf den Blockwart, der bei den Nazis die Volksgenossen überwachte, ebenso wie den mit ähnlichen Aufgaben betrauten ABV (Abschnittsbevollmächtigter) in der DDR. Genauso verschwanden Alltagssprachliches und Spöttisches mit dem Staat, in dem sie gängig waren – weder ➔ Picasso-Euter noch ➔ Ochsenkopfantenne überlebten den realen Sozialismus. Im wiedervereinigten Deutschland wurde der Groschen ein Opfer des politischen Wandels – er kam uns mit der Umstellung auf den Euro abhanden. Oft ist der Schwund unspektakulär, langweilig und bürokratisch: Kürzlich wurde das Wort Pflegestufe in den Regeln für den Umgang mit pflegebedürftigen älteren Menschen durch Pflegegrad ersetzt. Langfristig wird es in Vergessenheit geraten genau wie ➔ Kriegerwitwe oder Rentenmarke.
Dass Wörter verloren gehen, ist nicht so neu, wie es Sprachpessimisten vielleicht glauben. Die ausgestorbenen Berufsbezeichnungen, die der Linguist Jakob Ebner 2015 in einem Lexikon sammelte, sind nicht erst unter dem planierenden Einfluss des großen Gleichmachers ›Moderne‹ verschwunden, sondern viel früher. Schon im 19. Jahrhundert wussten Menschen nicht mehr, was Luther meinte, wenn er in seiner Bibelübersetzung von einer ➔ Schnur (›Schwiegertochter‹) oder einer ➔ Pfebe (›Kürbis‹) sprach. Daher füllte ein Theologe 1844 ein bereits 20-seitiges Büchlein mit der »Erklärung der hauptsächlichsten veralteten deutschen Wörter in Dr. Luthers Bibelübersetzung«.
Martin Luther ist allerdings ein gutes Beispiel für den Einfluss, den einzelne Individuen auf den Sprachwandel und damit auf das Verschwinden und das Fortbestehen von Wörtern haben können. Zwar konnte der Reformator Schnur und Pfebe nicht dauerhaft in der neuhochdeutschen Schriftsprache etablieren – aber er sorgte dafür, dass wir heute Adler statt ➔ Aar und Biene statt ➔ Imme sagen. Dabei ging es ihm nicht bewusst darum, die Sprache zu lenken. Er bevorzugte Ausdrücke, weil er sie für volkstümlicher, weiter verbreitet und überregional verständlicher hielt.
Bewusste Wiederbelebung betrieben andere. Der national gesinnte ›Turnvater‹ Friedrich Ludwig Jahn schlug zahlreiche alte und veraltete Wörter als Verdeutschungen von Fremdwörtern vor – darunter beispielsweise das heute aufgrund seiner NS-Geschichte wieder verpönte Gau. Wandervogel und Jugendbewegung gruben Vokabeln wie ➔ vagieren wieder aus. Besonders folgenreich machten die Autoren des Sturm und Drang und der Romantik alte, fast ausgestorbene Wörter wieder lebendig, etwa ➔ potz, ➔ frommen oder ➔ weidlich. Wenn diese Ausdrücke dann in die millionenfach in Schulen, Universitäten, Theatern und bildungsbürgerlichen Lesezimmern reproduzierte Sprache der großen Klassiker Goethe und Schiller gelangten, dann wurden sie für die nächsten hundert Jahre Bestandteil der Dichtersprache des 19. Jahrhunderts und bleiben zumindest Gebildeten bis heute bekannt und verständlich – wenn sie auch nicht mehr aktiv gebraucht werden.
»Dichtersprache des 19. Jahrhunderts« ist allerdings in gewisser Hinsicht ein Pleonasmus. Denn das, was heute in den Wörterbüchern als der Stilebene ›dichterisch‹ zugehörig markiert wird, war fast ausschließlich in älterer Dichtung gebräuchlich – also etwa vom Sturm und Drang bis zu Stefan George. Schon bei Gottfried Benn, Kurt Tucholsky, Mascha Kaléko und Bertolt Brecht findet man diese Wörter kaum noch. Erst recht nicht bei modernen Lyrikern, die das Wort ›Dichter‹ selbst oft als antiquiert empfinden. Die Kategorie ›dichterisch‹ – das ist mir bei der Arbeit an diesem Buch klar geworden – bezeichnet in der Lexikografie eine Sondergruppe des veralteten Wortschatzes. Das gilt in ähnlicher Weise für die Stilbezeichnung ›gehoben‹.
Man mag das Zurückgehen des schönen alten dichterischen und gehobenen Wortschatzes bedauern. Es ist aber kein Indiz für eine Sprachverarmung des Deutschen. Den verschwindenden Phänomenen, für die keine Bezeichnungen mehr notwendig sind, steht eine viel größere Gruppe von neuen gegenüber, für die auch neue Wörter geprägt werden. Deshalb verzeichnen alle großen digitalen Textarchive seit 1900 millionenfache Zuwächse im Wortbestand des Deutschen. Dem stehen nur 2300 Wörter gegenüber, die in den verschiedenen Duden-Wörterbüchern als ›veraltend‹ angezeigt sind; hinzu kommen 5600 als ›veraltet‹ markierte Lemmata sowie eine nicht viel größere Zahl von Vokabeln, die zumindest aus dem Rechtschreibduden mit seinem beschränkten Platz gestrichen wurden. Selbst wenn sich unter den Neuprägungen der vergangenen 125 Jahre viele Eintagsfliegen finden oder es sich um politischen, wissenschaftlichen und verwaltungstechnischen Expertenwortschatz handelt – die Neologismen überwiegen den Schwund.
Dennoch faszinieren verlorene Wörter. Oft löst die Begegnung mit ihnen sogar einen leichten Phantomschmerz aus. Nicht alle sind ›versunkene Wortschätze‹, aber sie alle sind Zeugnisse von Veränderungen und von Geschichtlichkeit. Und sie sind eine Verbindung mit Vergangenheit – mit Bedürfnissen, Lebenswelten, Träumen und Gefühlen von Menschen, die vor uns gelebt haben. Manche Ausdrücke sind mit großer Literatur verbunden, etwa der erwähnte Rentmeister mit Fontane, ➔ Feinsliebchen mit den Gedichten Heinrich Heines, ➔ fallieren und ➔ Mesalliance mit Thomas Manns »Buddenbrooks«. Andere sind sentimentale oder gruselige Erinnerungen an die eigene Jugend oder den Sprachgebrauch der Eltern und Großeltern wie ➔ Manchesterhose, ➔ Nietenhose, ➔ Koreapeitsche, ➔ Sittenstrolch oder ➔ Tippelbruder. Einige werden schlicht als schön empfunden wie ➔ Konterfei, ➔ Schnurrpfeiferei, ➔ Springinsfeld oder ➔ Backfisch. Andere als kurios wie die Berufsbezeichnung ➔ Kaltmamsell oder Ausdrücke für soziale Typen wie ➔ Kohlrabiapostel, ➔ Pomadenhengst oder ➔ Janhagel. Wenn ein Autor bewusst solche Wörter in seinem Text verwendet – sei es aus ironischer Absicht, als Schmuck oder als Zeitkolorit –, spricht die Linguistik von ›Archaismen‹.
In diesem Buch werden 181 solcher Ausdrücke genauer betrachtet. Von Wörtern wie ➔ peuplieren, ➔ Fant oder ➔ Bilwiss, die schon lange außer Gebrauch sind, bis hin zu solchen, die noch bekannt sind wie ➔ Schupo, ➔ Bahnhofskino oder ➔ Knabe, die aber kaum jemand mehr aktiv benutzt. Ausgewählt wurden sie nach Interessantheit, ob sich an ihnen ein Stück Kulturgeschichte erzählen lässt. Jeder Artikel will eine kleine historische Tiefenbohrung sein. Selbstredend ist das Kriterium ›Interessantheit‹ subjektiv. Ich habe allerdings in meinem jahrzehntelangen Berufsleben als Journalist und Autor die Erfahrung gemacht, dass alles, was ein Einzelner interessant findet, auch für viele andere Menschen interessant ist. Wir sind alle nicht so individuell und besonders, wie wir manchmal glauben.
Nicht immer sind für das Verschwinden von Wörtern hochrangige Phänomene wie soziale und politische Umwälzungen, große Erfindungen, wirtschaftliche Umbrüche oder Veränderungen der literarischen Ausdrucksweise verantwortlich. Oft genug ist nur die Mode Triebkraft für Veränderungen. Der sich in rätselhaften Windungen ergehende Fluss des Sprachwandels spült manche Ausdrücke einfach so fort. Das können wir gerade aktuell beobachten: In jüngster Zeit scheint es, als würde das echt deutsche Wort Hubschrauber allmählich durch Helikopter verdrängt, und junge Menschen gehen nicht mehr ins Fitnessstudio, sondern ins Gym. So findet echter Sprachwandel ganz unauffällig statt. Gegen Wörter wie ➔ traun, ➔ inkommodieren, ➔ pardauz oder ➔ Eidam hatte nie eine Gleichstellungsbeauftragte protestiert, keine Minderheit hatte sich von ihnen diskriminiert gefühlt, und sie waren keiner untergegangenen Technik, keinem Beruf und gesellschaftlichen System unauflösbar eng verbunden gewesen. Doch trotzdem benutzt sie kaum noch jemand – es sei denn, er will seinem Text einen betont altmodischen Anstrich geben oder seine sprachliche Individualität durch gesuchte Vokabeln hervorheben.
Das geschieht übrigens häufiger, als man denken würde. Kein Wort ist jemals völlig verschwunden, solange es noch bei alten Autoren steht, in Dialekten verwendet wird oder aus Urkunden hervorgekramt werden kann. Solange eine Sprache lebt, kann im Prinzip jedes Wort, das einmal in ihr existierte, wiederbelebt werden. Das gilt theoretisch sogar für schon lange pergamentifizierten mittelhochdeutschen Wortschatz wie lützel (›wenig‹) oder Zagel (›Schwanz‹). In jüngerer Zeit bescherte die Unterhaltungsindustrie mit ihren Büchern, Filmen und Computerspielen beispielsweise Wörtern wie Oger (›Menschenfresser‹), ➔ Mahr, ➔ Bilwiss oder ➔ Drude eine kleine Renaissance.
Das wahre Reservat, in dem die ›veralteten‹ und ›veraltenden‹ Wörter weiterleben wie die Dinosaurier auf dem tropischen Hochplateau in Arthur Conan Doyles Roman »Die vergessene Welt«, sind aber die Medien unterhalb der Hochliteratur, in denen kreativ mit Sprache umgegangen wird. Während der Recherchen für dieses Buch stellte ich fest, dass die große Mehrheit der in diesem Buch aufgezählten ›verschwundenen‹ Wörter in Zeitungen immer noch gelegentlich verwendet werden – und hier wiederum vor allem im Feuilleton. Letzteres ist doppelt begründbar: Feuilletonschreiber sind einerseits häufig belesene Menschen, denen auch ältere Literatur noch vertraut ist, andererseits stehen sie unter größerem Originalitätsdruck als Autoren im Wirtschafts-, Politik- oder Sportressort. Sowohl Leser wie Feuilletonistenkollegen erwarten, dass über kulturelle Phänomene in einem variationsreichen Stil geschrieben wird. Die Ironie, mit der man dann zugleich andeutet, dass man sich der Antiquiertheit der eigenen Wortwahl durchaus bewusst ist, macht es möglich: Hier kann eine Hose noch ein ➔ Beinkleid sein und eine Prostituierte noch eine ➔ Kokotte, hier wird noch ➔ inkommodiert und ➔ karessiert, hier werden noch ➔ Alfanzereien getrieben und ➔ Brosamen aufgelesen. Aber nicht nur im klassischen Feuilleton tauchen vermeintlich ›verlorene‹ Wörter überraschenderweise noch auf. Selbst in einem Podcast wie »Gemischtes Hack« hört man ein Wort wie ➔ Konterfei, obwohl die beiden Podcaster Tommi Schmitt und Felix Lobrecht völlig unverdächtig sind, irgendeinem kulturellen Snobismus zu frönen.
Ein derartiges Comeback wird den zu Beginn genannten Fachwörtern aus der Aalfischerei, die im Adelung stehen, wahrscheinlich nicht vergönnt sein, aber im Prinzip kann jedes Wort ewig leben – sogar Aalhälter, Aalquast oder Aalpuppe. Es müsste sie nur jemand in ein erfolgreiches Buch, einen Film oder ein Computerspiel einbauen. Conan Doyles Roman, in dem die Dinosaurier im Amazonasgebiet weiterleben, heißt im Original »The Lost World«. Das Wort ›lost‹ entwickelte in den vergangenen Jahren einen speziellen Zauber. ›Lost Places‹, also verlassene und heruntergekommene Häuser, wurden zu einem Massenphänomen in Popkultur und Internet. Warum sollten ›lost words‹ nicht genauso ein Kult werden? Im englischsprachigen Raum sind sie es unter jener Bezeichnung längst.
Allerdings sollte man sich genau überlegen, wo man alte Wörter einsetzt und wo nicht. Am falschen Ort kann man nicht nur unangenehme Situationen heraufbeschwören, weil die Angesprochenen sich vielleicht ungebildet fühlen. Es kann auch ganz konkret peinlich werden. Als ich im Kaufhaus Lafayette in Berlin einmal eine Verkäuferin nach einem Vatermörder fragte – also einem Hemd mit Stehkragen –, sah sie mich misstrauisch und verständnislos an. Noch schlimmer erging es dem Freund, der sich bei einer jungen Frau im Edeka nach Ochsenschwanzsuppe erkundigte – heute werden die Ochsenschwänze nur noch in Gulaschsuppe oder Rindfleischsuppe verwurstet. Er konnte eine Anzeige wegen sexueller Belästigung gerade noch abwenden.
Aar
Für dieses Wort müsste in den Wörterbüchern der Hinweis ›nur in Kreuzworträtseln‹ eingeführt werden. Denn dort flattert der Aar noch allgegenwärtig herum, während dieses ehemalige Dichterwort in der modernen Literatur außer Gebrauch gekommen ist. Zu den Letzten, die es noch ernsthaft verwendeten, gehörten NS-Schriftsteller wie Hans Friedrich Blunck oder Werner Schultze von Langsdorff alias Thor Goote. Nach 1945 tauchte es noch ein paar Mal als Zitatwort auf. Wolfgang Koeppen leistet sich im Roman »Das Treibhaus« ein Wortspiel mit dem Fluss Ahr und dem Tier Aar. Über einen »Burgundertraubenwein von der deutschen Ahr« sinniert der Abgeordnete Keetenheuve: »Wer begleitete ihn, von Schultagen her, breitete seine Fittiche über ihn, zeigte den scharfen Schnabel, die räuberischen Krallen? Der deutsche Aar.« Dann war das Wort erledigt – zum zweiten Mal. An seine Stelle trat vollständig der Adler, der eigentlich nur ein ›Edelaar‹ ist – so die Bedeutung des im Mittelhochdeutschen aufgekommenen Falkner-Wortes adelar. Wahrscheinlich ist Luther, der Adler bevorzugte, dafür verantwortlich, dass jenes Wort sich gegen Aar durchsetzte. Bis ins 16. Jahrhundert blieb Aar dann immerhin noch für kleinere Greifvögel wie Milan, Sperber und Weihe in Gebrauch. Sperber beziehungsweise seine mittelhochdeutschen Vorgängerformen sparwœre, sperwœre und sperbœre bedeuteten ursprünglich ›Sperlingsaar‹, weil diese Art Kleinvögel wie etwa Sperlinge erbeutet. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts wurde Aar dann in der Sprache der Dichtung wiederbelebt. Wie ➔ Leu war es nicht nur wegen seines altdeutschen Klanges, sondern auch als praktisch kurzes, einsilbiges Reimwort willkommen. Einer der Ersten, die es wieder nutzten, war der ungemein einflussreiche Schweizer Literaturtheoretiker Johann Jakob Bodmer. In seinem Fabelgedicht »Die Schnecke, der Adler und die Krähe« reimt er:
Die Schnecke hatte sich tief in ihr Haus gezogen;
Da kam ein starcker Aar geflogen.
Der fasset sie mit seinen Klauen an,
Er zweifelt, was es sey; als auf denselben Plan
Gleich eine Krähe kömmt, und zu ihm saget: Höre,
Die Schaal ist guter Speise voll:
Doch folgest du nicht meiner Lehre,
Geniessest du sie nimmer wohl.
Flieg auf, und schwinge dein Gefieder;
Dann wirff mit Macht die Schnecke nieder.
Zerbrich die Schaal und glaube mir
Du hast dann Speise nach Begier.
Die Krähe lehrt den Adler so.
Deß ward die Schnecke gar nicht froh.
Er warf sie und ihr gantzes Haus
An einen Stein, es brach, sie fiel heraus.
Die Krähe nahm der Beute wahr,
Fuhr zu, und aß sie vor dem Aar.
Um 1800 war der Aar dann im hohen Ton allgegenwärtig, am prominentesten in Goethes »Faust«:
Frau Victoria,
Mit ihrem weißen Flügelpaar,
Sie dünkt sich wohl sie sei ein Aar.
Als die Moderne den epigonalen Gebrauch der Klassikersprache aufgab, begann jedoch der erneute Sinkflug des Wortes.
Advokat
Einer der größten Fortschritte der westeuropäischen Geschichte in den vergangenen 1000 Jahren war die Verrechtlichung des Lebens. Vorher basierte die Rechtsprechung vor allem auf lokalen Gewohnheiten. Das änderte sich allmählich, als im späten Mittelalter zunächst an der italienischen Universität Bologna das schriftlich fixierte römische Recht wiederentdeckt wurde und anhand von Schriften wie dem spätantiken »Corpus Iuris« Juristen ausgebildet wurden. Das Bewusstsein, dass es abstrakte Rechtsnormen gibt, breitete sich dann im ganzen lateinischen Europa aus und wurde selbst auf Phänomene übertragen, die von den Römern noch nicht juristisch behandelt worden waren. Parallel dazu bildete sich ein Berufstand von Fachleuten aus, die diese Rechte kannten und sie interpretieren konnten. Bei der Organisation frühmoderner Staatlichkeit waren sie unentbehrliche Spezialisten.
Im Spätmittelhochdeutschen kam für solche Experten die aus dem lateinischen advocatus (›Rechtsbeistand‹) entlehnte Berufsbezeichnung Advokat auf. Die Advokaten, die in Städtechroniken des 13. Jahrhunderts genannt werden, waren aber noch nicht Rechtsanwälte im heutigen Sinne. Sie waren vor allem zuständig für die Rechtsberatung außerhalb der Gerichtsverhandlungen sowie für das Abfassen von Schriftsätzen. In der Übersicht »Gerichtlicher Process des geschriebenen Rechts« des Juristen Petrus Termineus wird das Wort 1584 erklärt: »Ein advocat ist der den parteihen in ihren sachen rath gibet, ihnen dieselben fürt, doch nicht mündlich, sondern schrifftlich.« Den mündlichen Prozess führte der Prokurator. Erst in der frühen Neuzeit fielen beide Funktionen zusammen, und juristische Vertreter jeder Art wurden nun Advokaten genannt. In der Neuzeit gehörten Advokaten ähnlich wie wohlhabende Kaufleute zur Oberschicht, etwa in den Städten.
Da das abstrakte moderne Recht für viele Menschen undurchschaubar war, wurde Advokat häufig abwertend gebraucht. Johann Fischart prägte im 16. Jahrhundert das Wort Schadvocat. In den »Drei Erznarren« klagt Christian Weise 1673 über einen Richter, der in Komplizenschaft mit den Anwälten die Prozessgebühren erhöht und das Verfahren in die Länge zieht: »Item, er hält etliche Advocaten auf der Streu, die müssen ihm jährlich etliche hundert Gülden geben.« In der Satire »Ein Schock Phantasten« (➔ Schock) wird 1700 über den »Process-Narr« gewitzelt, der sich vorstellt:
Ich führ Proceß schon lange Jahr
Davon mir wachsen graue Haar!
Der Richter nimmt sein Deputat
Das Recht verkehrt mein Advocat.
Ähnlichen Erfahrungen ist der seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts belegte Winkeladvokat zu verdanken. Das allmähliche Verschwinden des Wortes wird im »Deutschen Fremdwörterbuch« erklärt: »Seit dem 19. Jh. im Zuge des Übergangs vom römischen zum deutschen (bürgerlichen) Recht kraft amtlicher Sprachregelung als offizielle Berufsbezeichnung zunehmend durch die Ausdrücke Rechtsanwalt oder Anwalt abgelöst (so seit 1804 in bayerischen, seit 1849 in preußischen Verordnungen, 1877 in der Strafprozessordnung des Deutschen Reichs und bes. 1878 in der Rechtsanwaltsordnung).« Nur in Österreich und in der Schweiz habe sich dieser Prozess länger hingezogen. Heute wird das Wort nur noch übertragen im Sinne von ›Fürsprecher‹ verwendet oder um die lange Tradition des Anwaltsberufs zu betonen.
Afterglaube
Als um die Jahrtausendwende Film- und Musicalproduzenten begannen, nach Premieren zu Aftershowpartys einzuladen, konnten sich die Angeschriebenen ein gelegentliches maliziöses Lächeln nicht verkneifen. Sie wussten schon, dass es dort nicht darum ging, sich gegenseitig den nackten Po zu zeigen, aber die Vorstellung war doch erheiternd. Ähnliche absurde Assoziationen kommen heute auf, wenn man in alten Texten auf Wörter wie Afterbildung, Afterglauben, Afterweisheit und Afterlogik stößt. Sie alle leiten sich aber nicht vom männlichen Substantiv After (›Darmausgang, Anus‹) her, sondern von einem Adverb oder einer Präposition, die in germanischen Sprachen zeitliche oder räumliche Nachrangigkeit ausdrücken konnten. Die ältesten Belege stammen aus dem Gotischen (aftaro) und aus frühen Runeninschriften (after). Heute kennt man vor allem das englische Adverb after (›nach im zeitlichen Sinne, später‹), aber im frühen 20. Jahrhundert gab es hierzulande noch das Wort Aftermieter (›Nachmieter‹).
Zudem entwickelte sich im Deutschen aus der Vorstellung, dass eine Sache zeitlich später auftritt, die Möglichkeit, mit After-als erstem Bestandteil in Wortzusammensetzungen Zweitrangigkeit oder Falschheit auszudrücken. So ist Afterglaube ein seit dem 16. Jahrhundert nachweisbares Synonym für Aberglaube. Johannes Nas droht 1570 in seinem katholischen Brevier »Handbüchlein Des klein Christianismi« über das Erste Gebot »Du solst […] nicht frembde Götter neben ihm haben«:
Wider das Gebott sündiget man/ […] so man mit Afterglaube/Zaubereyen/ Schwartzkünsten/ Wundsegen/ Unsichtig machen/Wetter bannen/ Unhold fürchten/ in Traume/ die händ beschawen/Natiuitet [altes Wort für Geburtshoroskop, mh] machen/vnnd dergleichen lumpenwerck vmbgehet […].
Am Ende des 18. Jahrhunderts kam Afterweisheit (›oberflächliche Kenntnis einer Materie‹) beziehungsweise das dazu gehörige maskuline Substantiv Afterweiser auf. Goethe etwa stellt fest: »Die Afterweisen suchen von jeder neuen Entdeckung nur so geschwind als möglich für sich einigen Vortheil zu ziehen.« Im gleichen Sinne wurde um 1800 die Afterbildung gebraucht. Jünger ist Afterlogik (›wahnhaft falsche Logik‹) als ein polemischer Ausdruck der sich im 19. Jahrhundert etablierenden modernen Wissenschaften. Alle diese Wörter sind mittlerweile im Duden als ›veraltet‹ ausgewiesen.
Alfanzerei
In Stefan Zweigs Buch über den Magnetiseur, Arzt und Wunderheiler Franz Anton Mesmer möchte dieser seine Wiener Standeskollegen im 18. Jahrhundert davon überzeugen, dass seine »Heilung durch den Geist« (so der Titel von Zweigs Buch) kein Schwindel sei. Doch sie geben ihm keine Chance:
Vergebens, daß er seine einstigen Kollegen in seine magnetische Klinik bittet, um ihnen zu beweisen, daß er nicht mit Quacksalbereien und Alfanzereien, sondern mit einem begründeten System operiere – keiner der geladenen Professoren und Doktoren will sich mit den sonderbaren Heilungsphänomenen ernstlich auseinandersetzen.
Alfanzerei ist eine Bildung auf der Basis der Wörter Alfanz und alfanzen. Ersteres geht auf italienisch all'avanco (›zum Vorteil‹) zurück und wurde im 14. Jahrhundert in der Bedeutung ›Schwindel, Betrug‹ ins Deutsche übernommen. Später konnte es, zum Beispiel bei Luther, auch die Bedeutung ›Albernheiten, Possen‹ haben. Daraus entstand im 16. Jahrhundert das Wort alfanzen (bei Luther immer alfenzen), das in der Reformationsrhetorik eine Rolle spielte – als alfanzende Schwindler und Narren galten bei Luther und Huldrych Zwingli natürlich immer die jeweiligen theologischen Gegner. Zudem war Luther einer der Ersten, der das neue, aus dem Verb mit der pejorativen Nachsilbe -rei gebildete Substantiv Alfanzerei gebrauchte. Über die Bücher, die der seinerzeit sehr berühmte schottische Theologe John Major veröffentlichte, urteilt der Wittenberger Reformator 1521 harsch: »Wilch fudder [›Wagenladungen‹, mh] voll alfentzerey sind da!«
Als Ausdruck typisch protestantischer Sittenstrenge und Unerbittlichkeit hallte das Wort noch beim Preußenherrscher Friedrich Wilhelm I. nach, als dieser 1739 per Erlass diverse Weihnachtsbräuche verbot:
Wir vernehmen mißfällig, daß am Christabend vor Weihnachten Kirche gehalten, das Quem pastores gesungen worden, und die Leute mit Kronen oder auch mit Masken von Engel Gabriel, Knecht Rupprecht gegangen und dergleichen Alfanzereien mehr getrieben werden.
Dergleichen »bisher üblich gewesene Alfanzereien« untersagte der Soldatenkönig nun per Erlass an seine Superintendenten. Im Gegensatz zu Alfanz und alfanzen blieb Alfanzerei noch bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts zwar selten, aber gebräuchlich; unter anderem verwendete es Ernst Bloch in »Das Prinzip Hoffnung«.
Ameisler
Heute kann es nach Paragraf 69 des Bundesnaturschutzgesetzes mit bis zu 50.000 Euro Bußgeld geahndet werden, wenn man einen Ameisenhaufen zerstört. Doch vor nicht allzu langer Zeit gab es Menschen, die ihren Lebensunterhalt damit bestritten, Ameisenkolonien ihrer Puppen zu berauben. Ameisler, die ab dem 17. Jahrhundert in Bayern, Österreich und Böhmen bekannt waren, sammelten und dörrten die Puppen der Ameisen und verkauften sie in der Stadt als Futter für Käfigvögel und Zierfische. In Wien wurden diese Geschäfte auf dem Naschmarkt und Meidlinger Markt getätigt. Außerdem sammelten Ameisler die Harzkörner, die die Tiere in ihre Haufen getragen hatten, und boten sie als Weihrauchersatz, den sogenannten Waldrauch, an.
Anfangs schrieb man den Ameisenpuppen sogar eine medizinische Wirkung zu, und so erläutert ein Kräuterbuch des Adam Lonitzer, Frankfurter Stadtphysikus im 16. Jahrhundert, die »Beste Weiß, Omeisen-Eyer zu sammeln«. Dreihundert Jahre später, 1885, führt das Buch »Geographische Charakterbilder aus Deutschland« zum Ameisler aus:
Er durchstreift die Wälder, in denen die schwarze Ameise Abfälle von Nadelholz und Pflanzenteilen in solcher Menge zusammenträgt, daß diese Haufen eine Höhe von 1½ Ellen erreichen. In ihnen birgt das Tier seine Puppen, die sogenannten Ameiseneier. Diese sucht der Ameisler auf, und seine Ausbeute ist in manchen Sommern so beträchtlich, daß die Händler aus Wien sie ihm mit 200 fl. [Abkürzung für Gulden, mh] bezahlen.
Und ein Lesebuch aus dem Jahre 1895 beschreibt die Öffnung der Haufen:
Der Ameisler reibt seine Hände noch mit Terpentin oder einem anderen Öl ein, damit sie gegen die Ameisensäure gestählt sind; dann erfaßt er seine Schaufel und reißt den seit Jahren mit unsäglichem Fleiße kunstvoll aufgeführten Bau auseinander.
Peter Rosegger, der als Kind ein »Waldbauernbub« war – wie der Titel seines berühmtesten Werkes verkündet –, verfasste 1883 eine literarische Szene namens »Der Ameisler«. In ihr schildert der Erfolgsschriftsteller, wie ein Ameisler die aus dem zerstörten Bau herausgesiebten Insekten dazu brachte, ihre Puppen auf einem ausgebreiteten Leinentuch in Haufen zusammenzutragen, sodass er sie leichter einsammeln konnte. Mit dem Aufkommen des modernen Naturschutzgedankens und seiner Verrechtlichung kam die Tätigkeit des Ameislers aus der Mode. Doch noch in den 1950er- bis 1970er-Jahren wurden in Österreich 270 Sammellizenzen vergeben.
Anstandsdame
Das seit dem frühen 19. Jahrhundert nachweisbare Wort bezeichnete ursprünglich ein Rollenfach am Theater: So wie jugendliche Naive, Held und Bonvivant war Anstandsdame ein Fachbegriff für einen bestimmten Typus, den Schauspielerinnen in einem Stück verkörpern konnten. Das Grimm'sche Wörterbuch definiert Anstandsdame als »gesittetes verhalten exemplarisch vorführende, (als begleiterin junger damen oder paare) auf die wahrung der schicklichkeit achtende weibl. Person«. 1816 liest man über die zurückliegende Saison am Theater Kassel im »Morgenblatt für die gebildeten Stände«:
Mad. Hähnle, die als Anstandsdame uns angekündigt war, lernten wir in mehrern Rollen als solche kennen. Sie ist wirklich eine Frau von vielem Anstand, wohl aussehend und erhabener Gestalt, doch ist ihr Spiel kalt und ohne tiefes Interesse.
Das Wort und die damit verbundene Vorstellung fanden schließlich ihren Weg in das wirkliche Leben – nicht zuletzt, weil mit dem Aufkommen des sogenannten Naturalismus und des modernen Theaters die alten Rollenfächer in Vergessenheit gerieten. Gustav Cohn schildert 1896 in seinem Buch über »Die deutsche Frauenbewegung« die Verhältnisse an englischen Universitäten, die schon eigene Zweige für Frauen hatten: »Zum Beginn wurde eine Anstandsdame erwählt, deren Begleitung zum Besuche der Universitätsvorlesungen den jungen Damen auferlegt wurde.« In Skandinavien hingegen sah man die Dinge lockerer, wie 1901 »Das goldene Buch der Sitte« beschreibt: »In Norwegen und Schweden machen junge Leute beiderlei Geschlechts zusammen tage- und wochenlange Reisen ohne auch nur eine Anstandsdame mit sich zu führen, und niemand findet auch nur das Geringste darin.« Und 1911 verspottet August Bebel im zweiten Band seiner Memoiren Eduard Lasker, seinen großen nationalliberalen Opponenten im Reichstag der 1870er- und 1880er-Jahre, als »parlamentarische Anstandsdame«.
Da man sich die Anstandsdame als scharfen Hund vorstellte, der die Tugend eines Mädchens bewachte, kam im frühen 20. Jahrhundert das umgangssprachliche Synonym Anstandswauwau auf. Nicht zuletzt sorgte der Anstandswauwau dafür, dass am Ende einer gesitteten Mahlzeit ein Anstandsrest auf dem Teller verblieb.
Augenglas
Unser deutsches Substantiv Brille entwickelte sich aus dem Wort Beryll, das man im Mittelalter nicht nur für das heute so genannte Mineral verwendete, sondern für alle klaren Kristalle. Die frühesten Formen der am Ende des 13. Jahrhunderts in Oberitalien erfundenen Brillen hatten zunächst aus Kristall geschliffene Gläser. Der Name des Kristalls wurde dann zur Bezeichnung für das gesamte neuartige Gerät. Schon früh gab es aber Bedarf für ein deutsches Wort neben dem fremdartig klingenden beryll. So wird 1420 in einer Glosse zu einem Manuskript das lateinische Wort berillus mit augen glas erläutert. Diese deutsche Zusammensetzung blieb erhalten, selbst als man beryll längst zur Brille eingedeutscht hatte und nicht mehr als Fremdwort empfand. Albrecht Dürer etwa berichtet in seinem Reisetagebuch, in dem er akribisch alle seine Ausgaben auflistet, Ende Oktober 1520 über einen Einkauf: »Ich hab 4 stüber [Münzart, mh] umb 2 augengläßer geben.«
Zunächst wurde das Wort eher im Plural gebraucht; dann wurde singularisch Augenglas für jede Art von Brille, ein Monokel, einen Zwicker, ein Lorgnon oder gar ein Fernrohr vorherrschend. Im 20. Jahrhundert nahm die Frequenz des Wortes jedoch massiv ab. Die Literaten mieden es, weil es einen komischen Klang bekommen hatte. Man liest es nur noch bei Historikern, die längst vergangene Zeiten schilderten, oder bei Journalisten und Sachbuchautoren, die ein Synonym für Brille suchten.
Einer der Letzten, der es ganz selbstverständlich für eine Gegenwartsschilderung einsetzte, war Franz Werfel 1933. In seinem Roman über den Völkermord an den Armeniern »Die vierzig Tage des Musa Dagh« nutzt er seinen etwas lächerlichen Nebensinn, um die Erschöpfung und Hilflosigkeit des Pastors Johannes Lepsius anschaulich zu machen, der sich im Auswärtigen Amt für die Armenier einsetzt: »Lepsius nimmt sein Augenglas ab und putzt es angelegentlich. Seine Augen zwinkern stumpf und müde. Sein ganzer Körper bekommt durch den geschwächten Blick etwas Täppisches.«
ausgepowert
Wenn wir heute lesen, ein Manager oder eine Fußballmannschaft seien völlig ausgepowert, dann verstehen wir diesen Ausdruck vom englischen Wort power her und legen ihm selbstverständlich die Bedeutung ›erschöpft, entkräftet‹ zu. Doch in alten Texten kann dies zu Missverständnissen führen. Denn in der ökonomischen Fachsprache des 19. Jahrhunderts gab es das Verb auspowern in einem ganz anderen Sinne mit abweichender Aussprache, das vom französischen pauvreté abgeleitet war – wie die alternativen Schreibweisen ausgepovert und ausgepauvert deutlicher zeigen. In einem Band von »Möglins Annalen der Landwirtschaft« liest man 1820 über die Möglichkeit, auf einem sandigen Acker Spargel oder Stoppelrüben anzubauen: »Aber freilich darf er nicht völlig verarmt (ausgepowert) seyn, und man muß Dünger dazu geben können.«
Das im späten 18. Jahrhundert aufgekommene Wort scheint zunächst dem Vokabular der modernen Landwirtschaft angehört zu haben. Erst von dort wurde es dann auf allgemeine ökonomisch-politische Verhältnisse übertragen. 1892 erklärt der liberale Politiker Ludwig Bamberger in einem Plädoyer für den Freihandel vor dem Reichstag: »Alle die früheren Täuschungen, denen man sich hingab, indem man glaubte, ein Land wird, wie der Ausdruck lautete, ausgepowert, weil es mehr ausführt als einführt, beruhen auf Irrthum.« Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war das Wort im Sinne von ›verarmen, wirtschaftlich zugrunde richten‹ gebräuchlich, wobei spätestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts nicht mehr immer deutlich zu unterscheiden war, ob der Sprecher nun von der abnehmenden Power oder der zunehmenden pauvreté sprach. Der CDU-Politiker Friedhelm Ost schien ausgepowert aber noch ganz im alten Sinne zu gebrauchen, als er sich am 20. Juni 1991, während der großen Berlin-Bonn-Debatte, zur Hauptstadtfrage äußerte: »Der Wiederaufbau des östlichen Teils unseres Vaterlandes, der von den Sozialisten und ihren Funktionären ausgepowert und zerstört worden ist, stellt die größte Herausforderung für uns alle in der nächsten Zeit dar.«
Backfisch
Zum Braten verwendete man früher vor allem die Fische, die zu klein waren, um sie zum Kochen einer Fischsuppe in Stücke zu schneiden. Jacob Grimm definiert im »Deutschen Wörterbuch« Backfisch als »fisch zum backen, noch nicht zum sieden«. Die bayerische Spezialität Steckerlfisch gibt noch heute eine Vorstellung davon. Doch selbst Grimm wusste schon, dass seit dem 17. Jahrhundert Backfisch ebenso als Bezeichnung für ein sehr junges Mädchen im Teenageralter gebräuchlich war. In einer lateinischen Thesenschrift über die Jungfernschaft aus dem Jahre 1623, die angeblich von der damaligen Präsidentin des Ordo Virginum, einer lockeren Gruppe jungfräulich lebender Frauen in der katholischen Kirche, verfasst worden war, wird puellae virgunculae als »halbgewachsene Frischlinge/ Backfischlein« verdeutscht. Im Lexikon »Der Teutschen rechtsgelahrheit« definiert der Jurist Johann Georg Estor 1767 Backfisch als »ein mädgen, das heranwächst«. Literarisch geadelt wird der Begriff schließlich von Goethe, der 1773 in seinem »Götz von Berlichingen« einen Bräutigam schwärmen lässt, er sei nun im Besitz »des hübsch[es]ten Backfisch im ganzen Dorf«.
Im 20. Jahrhundert kam das Wort allmählich aus der Mode. Genauso wie seine von Jacob Grimm genannten Synonyme: »ähnliche namen sind flitze, splette, grasaffe«. Schon 1967 bezeichnet das »Wörterbuch der Gegenwartssprache« (WdG) Backfisch als ›veraltend‹ für ein ›Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren‹. Den endgültigen Garaus machte ihm dann das Wort Teenager, das es heute vollständig verdrängt hat. Dabei ist Backfisch genauer (wenn die WdG-Definition stimmt) und müsste als präzise geschlechtsspezifische Bezeichnung (bei Teenager sind die Mädchen ja nur mitgemeint) gerade heutzutage den Zeitgeistbedürfnissen mehr entgegenkommen. Mit aus der Mode gekommen sind die schönen Zusammensetzungen Backfischjahre, Backfischroman und Backfischschwärmerei, obwohl es das alles natürlich immer noch gibt.
Bahnhofskino
Dies war die verbreitete umgangssprachliche Bezeichnung für die auch Aktualitätenkino genannten Lichtspielhäuser, die sich oft in der Nähe von Bahnhöfen befanden. Ein solches Kino gab es beispielsweise in der Nähe des Berliner Bahnhofs Zoo – das dortige »Aki« (Abkürzung für Aktualitätenkino) überlebte bis Anfang der Neunzigerjahre. Diese Art Häuser kam europaweit in der Zwischenkriegszeit auf. Ihr Ursprungsland war Frankreich, wo sie cinéacs hießen, eine Zusammensetzung aus cinéma und actualité. 1933 liest man im »Pariser Tageblatt«, einer Zeitung für Deutsche in der französischen Hauptstadt, eine Beschreibung, die sich nicht wesentlich von den Angeboten in Deutschland unterschieden haben dürfte:
Zwei Micky-Mausfilme und ein buntes »dessin animé« zeigen die hohe Stufe der amerikanischen Trickfilmkunst. Die Reportage von dem Ringkampf im freien Stil zwischen dem Weltchampion Deglange und Malciewicz [sic, mh] ist wohl einer der besten Sportfilme, die man jemals gesehen hat. Aktualitäten aus aller Welt in gewohnter Buntheit vervollständigen das sehenswerte Programm.
Das erste Kino, das den Bahnhof im Namen trug, waren die 1949 im Stuttgarter Hauptbahnhof eröffneten Bahnhofs-Lichtspiele, kurz Bali. Der Kinoname Bali wurde danach in westdeutschen Städten weit verbreitet. In Bahnhofsnähe lagen diese Kinos, weil sich Reisende mit kurzen Filmen und Wochenschauen in der Art heutiger Nachrichtensendungen die Wartezeit vertreiben konnten. In der DDR hießen diese Häuser Zeitkinos.
Das bunte, aktuelle und kurze Programm der Bahnhofskinos konnte in den Sechzigerjahren nicht mehr gegen das Angebot des Fernsehens bestehen. Sie bekämpften ihren Niedergang, indem sie besonders reißerische Filme zeigten. Dadurch wurde Bahnhofskino im Westen zu einer Genrebezeichnung, die billige Italowestern, Grusel-, Kung-Fu-, Sandalen- und Sexfilme umfasste. In den 1980er-Jahren waren fast alle Bahnhofskinos komplett auf Pornos umgestellt, was wiederum der Bahn nicht passte, die die Bahnhöfe zu familienfreundlichen Einkaufs- und Servicezentren umwandeln wollte. Das letzte Bahnhofskino schloss 1999. Das Wort schaffte es seltsamerweise nie in den Duden, nicht einmal in das achtbändige »Große Wörterbuch der deutschen Sprache.« Seine einst weite Verbreitung ist aber dadurch bewiesen, dass es nicht nur einem Lied der Gruppe BAP von 1984 den Titel gab, sondern sich bis heute ein Podcast namens Bahnhofskino solchen Genrefilmen, insbesondere dem Horror, widmet.
Bänkelsänger
Die Neugier auf Sensationen und die Lust am Unglück anderer ist keine Erscheinung des modernen Medienzeitalters. Von der frühen Neuzeit an bis ins 20. Jahrhundert wurden entsprechende Bedürfnisse von herumziehenden Sängern befriedigt, die auf öffentlichen Plätzen, oft bei Jahrmärkten oder Kirchweihfesten, erzählende Lieder mit grausig-erregendem Inhalt vortrugen – sogenannte Moritaten, die vielleicht so hießen, weil sie am Ende oft eine ›Moral von der Geschicht'‹ verkündeten. Der Bänkelsang war eine multimediale Kunstform, bei der das im Lied Beschriebene von grellen Bildern illustriert wurde, auf die der Sänger mit einem Stock zeigte. Weil er dabei oft auf eine Bank stieg, um besser sichtbar zu sein, entstand das Wort Bänkelsänger.
In einem der frühestens Belege erklärt der Literaturtheoretiker Johann Christoph Gottsched die Entstehung der Dichtkunst aus einem Bedürfnis nach aufregenden Geschichten, das allen »kindischen« Völkern der Frühzeit gemein gewesen sei. In seiner »Critischen Dichtkunst« heißt es 1730:
Die wildesten Leute verließen ihre Wälder, und liefen einem Amphion oder Orpheus nach, welche ihnen nicht nur auf ihren Leyern was vorspielten; sondern auch allerley Fabeln von Göttern und Helden vorsungen: nicht viel besser als etwa itzo auf Messen und Jahrmärckten die Bänckelsänger mit ihren Liedern von Wundergeschichten, den Pöbel einzunehmen pflegen.
Man sieht: Das Wort hatte von Anfang an einen abwertenden Klang. Bänkelsänger gehörten wie Gaukler, Wandermusikanten oder umherziehende Komödianten dem fahrenden Volk an, das außerhalb der Gesellschaft stand. Und für die Leute, deren Bedürfnisse sie befriedigten, hatte Gottsched nur Verachtung übrig, denn ihm ging es darum, die deutsche Literatur auf ein höheres Niveau zu heben und den Geschmack der Theatergänger und Bücherleser zu verbessen.
Darin stimmte Gottsched mit seinem Pendant überein, auch wenn dieser, der aufgeklärte Freigeist Christoph Martin Wieland, eine ganz anders geartete poetische Natur war. 1754 nahm Wieland die von Gottsched so unvorteilhaft mit Jahrmarktsattraktionen verglichenen frühen Dichter und Denker in Schutz. In einer theoretischen Schrift über den Unterricht für Schüler mit dem Titel »Plan von einer neuen Art Privat-Unterweisung« schreibt er: »Homerus wird nach meiner Einsicht kein elender Bänkelsänger und Landstreicher, und Plato kein Sophist und Fanaticus seyn.« Damit rehabilitierte Wieland zwar die ältesten Literaten, aber Bänkelsänger wurde nun endgültig zu einem polemischen Begriff. Ernst Moritz Arndt etwa beschimpft in den 1820er-Jahren literarische und politische Gegner als »Bänkelsänger und Gaukler der Gelehrsamkeit«.
Erst als der Beruf des Bänkelsängers an der Wende zum 20. Jahrhundert allmählich ausstarb, kamen Leute wie Frank Wedekind oder Bertolt Brecht auf die Idee, den Bänkelsang auf Kabarett- und Theaterbühnen für ein gebildetes Publikum zur Kunstform zu erheben. Ein frühes Beispiel ist Wedekinds Lied »Der Tantenmörder«, in der ein Mörder vor Gericht jammert:
Ich hab' meine Tante geschlachtet, Meine Tante war alt und schwach; Ihr aber, o Richter, ihr trachtet Meiner blühenden Jugend-Jugend nach.
Berühmter noch ist Brechts »Moritat von Mackie Messer« aus der »Dreigroschenoper«, mit der der Bänkelsang endgültig weltliteraturfähig wurde. Als gespenstische Reminiszenz an jene Zeiten taucht das Wort noch gelegentlich im Feuilleton-Jargon auf. Die »Süddeutsche Zeitung« nannte Wolf Biermann 2006 zum 70. Geburtstag einen »großen Bänkelsänger« und wollte ihn damit in eine Reihe mit Brecht stellen.
Base
Wieder eine dieser alten Verwandtschaftsbezeichnungen, die ihre Bedeutung mehrfach veränderten. Im Althochdeutschen bezeichnete basa beziehungsweise wasa sehr präzise die Schwester des Vaters. Noch in der Braunschweiger Kirchenordnung von 1569 zählt zu den Personen, die man nicht ehelichen darf: »Irer Basen Man/ dz ist/ ires Vatters schwester man.« Doch konnte schon im Mittelhochdeutschen mit base ebenso die Mutterschwester gemeint sein. Das Wort bewegte sich also immer mehr in Richtung der allgemeinen Bedeutung ›Tante‹. Noch Friedrich Gladov übersetzt in seinem Lexikon der »A la Mode-Sprach der Teutschen« von 1727 »Ma Tante« mit »Meine base«. Von ›Tante‹ ausgehend wurde der Begriff dann auf alle entfernteren weiblichen Verwandten ausgedehnt, um schließlich auf die Bedeutung ›Cousine‹ wieder eingeengt zu werden. In Wilhelm Raabes Roman »Die Kinder von Finkenrode« von 1859 stellt der Vater einem Verwandten, der erstmals zu Besuch kommt, seine Tochter vor: »Du hier nennst sie Base oder Bäschen oder Kusine – nein, nicht Kusine, das ist ein französisches Wort!«
Heute lebt der Ausdruck nur noch in der Zusammensetzung Klatschbase