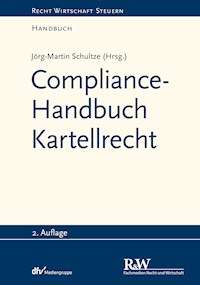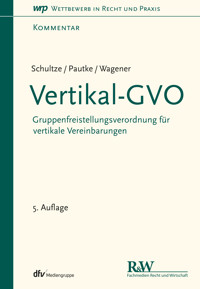
179,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fachmedien Recht und Wirtschaft
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: BB-Kommentar
- Sprache: Deutsch
Die 5. Auflage des Standard-Kommentars zur Vertikal-GVO behandelt die am 1. Juni 2022 in Kraft getretene, grundlegend reformierte Vertikal-GVO, die bis 2032 für sämtliche Vertriebsverträge gilt, die Auswirkungen in der EU haben. Der Kommentar setzt sich mit den Änderungen und Anpassungserfordernissen der neuen Vertikal-GVO auseinander und ist folglich grundlegend überarbeitet und in weiten Bereichen neu geschrieben. Die Neuauflage enthält eine vollständige Kommentierung des Verordnungstextes mit umfassender Berücksichtigung der Vertikal-Leitlinien sowie der aktuellen Entscheidungspraxis. Ein Fokus des Kommentars liegt dabei auf den Neuregelungen zum dualen Vertrieb sowie des Plattformvertriebs. Exkurse zu Franchise-Vereinbarungen sowie zu Zuliefervereinbarungen runden das Werk ab. Der Titel in Kürze: - Umfassende Kommentierung aller Aspekte aus der Sicht der Praxis mit wissenschaftlicher Grundlage; - Zusammenfassende Erörterung vieler Spezialthemen wie Online-Vertrieb, Plattformvertrieb, Software-Verträge, industrielle Zulieferverträge, Informationsaustausch; - Berücksichtigung der Praxis in den Mitgliedstaaten der EU
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1478
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Vertikal-GVO
Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale Vereinbarungen
Praxiskommentar
Von
Dr. Jörg-Martin Schultze, LL.M.
Dr. Stephanie Pautke, LL.M.
Dr. Dominique S. Wagener, LL.M.
Rechtsanwälte in Frankfurt am Main
5., komplett überarbeitete und erweiterte Auflage 2025
Alle im Buch verwendeten Begriffe verstehen sich geschlechterneutral. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet – entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat lediglich redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
ISBN: 978–3–1846–3
© 2025 Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Mainzer Landstr. 251, 60326 Frankfurt am Main, [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Satzkonvertierung: Lichtsatz Michael Glaese GmbH, 69502 Hemsbach
Druck und Verarbeitung: Elanders Waiblingen GmbH, 71332 Waiblingen
Printed in Germany
Vorwort
Jedes Buch erscheint etwas später als geplant. Wenngleich auch diese Auflage von Verzögerungen nicht verschont geblieben ist, haben wir bewusst auf eine sofortige 5. Auflage nach Verabschiedung der neuen Vertikal-GVO verzichtet, um weiter dem Anspruch „von der Praxis für die Praxis“ (so im Vorwort zur 4. Auflage 2019) gerecht zu werden und unsere praktischen Erfahrungen mit der neuen Verordnung einfließen lassen zu können.
Diese Auflage ist dabei in mehrfacher Hinsicht etwas Besonderes. Zum einen kommentiert sie die grundlegendste Reform, der die Vertikal-GVO bisher unterzogen wurde und zum anderen ist sie die letzte, die vom kompletten, bisherigen Autorenteam „Schultze/Pautke/Wagener“ verantwortet wird. Deshalb übernehme ich in dieser Auflage auch allein das Vorwort. Denn nachdem ich mich zum Jahresende 2024 in den Ruhestand verabschiedet habe, werde ich mich auch aus dem Autorenkreis dieses Kommentars zurückziehen. Zu einem Kommentar, der „Hilfestellung aus der Sicht des Praktikers leisten“ (so im Vorwort zur 1. Auflage 2001) will, lässt sich aus dem Ruhestand nichts mehr beitragen.
Nach 25 Jahren Kommentar-Geschichte danke ich meinen Mitautorinnen und Partnerinnen der Kartellrechtskanzlei MEO Rechtsanwälte PartGmbB für ihre Treue zu dem Projekt und freue mich über ihre Absicht, den Kommentar auch künftig fortzuführen. Ich danke dem Verlag, der uns hauptsächlich in Gestalt unserer Lektorin Tanja Brücker gegenübertrat, für die Geduld bei der Finalisierung des Manuskripts und die großzügige Interpretation von Fristen. Diese Haltung hat wesentlich zur Freude an dem Projekt beigetragen. Und ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die uns durch positive Rückmeldungen immer wieder motiviert haben, an der Kommentar-Tätigkeit festzuhalten.
Last but not least: Unsere Kollegin Argyro Triantafyllou hat sich um die Vereinheitlichung der Teil-Manuskripte verdient gemacht, und ohne unsere Office Managerin Nadine Kothe wäre der Abschluss der 5. Auflage irgendwann zum Erliegen gekommen – ganz herzlichen Dank für die erheblichen Beiträge, die durch Frau Kothe bei allen Auflagen erbracht wurden.
Frankfurt, im Juli 2025
Jörg-Martin Schultze
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung
1. Entstehungsgeschichte
2. Rechtsgrundlage
3. Grundlagen und Systematik
4. Räumlicher Geltungsbereich der Vertikal-GVO
5. Vertikale Vereinbarungen außerhalb des Anwendungsbereichs der Vertikal-GVO
5.1 Nur Wettbewerbsbeschränkungen nach Art. 101 Abs. 1 AEUV bedürfen einer Ausnahme nach Art. 101 Abs. 3 AEUV
5.2 Entsprechende Anwendung der Vertikal-GVO
5.3 Überschreitung der Marktanteilsschwellen von Vertikal-GVO-konform gestalteten Vereinbarungen
5.4 Überschreiten der Grenzen der Ausnahmekataloge für Kernbeschränkungen
6. Bewertung von Spezialvereinbarungen nach den Leitlinien
6.1 Produktgruppenmanagement-Vereinbarungen
6.1.1 Grundsätzliche Bewertung
6.1.2 Anforderungskriterien an Vereinbarungen innerhalb der Marktanteilsschwelle des Art. 3 Abs. 1
6.1.2.1 Preisempfehlungen
6.1.2.2 Empfehlung zu Produktzusammensetzung und Positionierung
6.1.2.3 Exklusivität
6.1.2.4 Informationsaustausch zwischen Wettbewerbern
6.1.3 Anforderungskriterien an Vereinbarungen außerhalb der Marktanteilsschwelle des Art. 3 Abs. 1
6.1.3.1 Marktausschluss- oder Abschottungswirkung
6.1.3.2 Kollusionsgefahr auf Anbieter- und/oder Abnehmerseite
6.1.4 Hohes kartellrechtliches Augenmerk erforderlich
6.2 Vorauszahlungen für den Zugang
6.2.1 Grundsätzliche Bewertung
6.2.2 Anforderungen an Vereinbarungen zu Zugangszahlungen innerhalb der Marktanteilsschwelle des Art. 3 Abs. 1
6.2.3 Anforderungen an Vereinbarungen zu Zugangszahlungen jenseits der Marktanteilsschwellen des Art. 3 Abs. 1
6.2.3.1 Marktausschluss anderer Händler oder anderer Anbieter
6.2.3.2 Kollusionsrisiko
7. Verhältnis zum deutschen Kartellrecht
7.1 Sondervorschriften im GWB
7.1.1 § 21 Abs. 2 GWB
7.1.2 §§ 20 Abs. 1, 19 GWB
7.1.3 § 19a GWB
7.2 Grundsatz der parallelen Anwendung
7.3 Auslegungsgrundsätze für Regelungen des GWB
7.4 Bewertung von Altverträgen seit der 7. GWB-Novelle
7.5 Verhältnis zum Missbrauchsverbot bei relativer Marktmacht, § 20 Abs. 1 GWB
8. Die Vertikal-GVO im Prozess – Beweislast
Kommentar
Art. 1 Abs. 1 lit. a – Vertikale Vereinbarung
1. Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen
1.1 Abgrenzung zu einseitigen Verhaltensweisen
1.2 Exkurs – Geoblocking-VO
1.3 Beschlüsse
1.4 Vereinbarungen zwischen mehr als zwei Unternehmen
2. Unternehmen und Unternehmensvereinigungen als Normadressaten
3. Vertikalverhältnis für Zwecke der Vereinbarung
4. Gegenstand der Vereinbarung
5. Waren und Dienstleistungen
Art. 1 Abs. 1 lit. b – Vertikale Beschränkung
1. Spürbare Wettbewerbsbeschränkung
2. Spürbare Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels
3. Beurteilung von vertikalen Beschränkungen nach deutschem Kartellrecht
Art. 1 Abs. 1 lit. c – Wettbewerber
Art. 1 Abs. 1 lit. d – Anbieter
Art. 1 Abs. 1 lit. e – Online-Vermittlungsdienste
Art. 1 Abs. 1 lit. f – Wettbewerbsverbote
1. Formen von Wettbewerbsverboten zulasten des Abnehmers
2. Qualifizierung als Wettbewerbsverbot im Sinne von Art. 1 Abs. 1 lit. f
3. Unmittelbare oder mittelbare Verpflichtung
4. Relevanter Markt
5. Einzelheiten zur Mindestabnahmeverpflichtung
6. Englische Klausel
7. Abgrenzung zur Alleinbelieferungspflicht des Anbieters
7.1 Bedingungslose Freistellung nach der Vertikal-GVO
7.2 Bewertung außerhalb der Vertikal-GVO
Art. 1 Abs. 1 lit. g – Selektive Vertriebssysteme
1. Überblick
2. Anbieter- und händlerseitig geschlossene Selektivvertriebssysteme
3. Abgrenzung zur Fachhandelsbindung
4. Qualitative Selektivvertriebssysteme
5. Quantitative Selektionskriterien
6. Sonstige Selektionskriterien
7. Auswahl anhand festgelegter Merkmale
8. Selektionskriterien für den Internetvertrieb
9. Zulässigkeit durchlaufender Vertriebsbindungen im mehrstufigen Vertrieb
10. Parallele Vermarktung über unterschiedliche Arten von Vertriebssystemen
11. Abgrenzung zu Franchisevereinbarungen
Art. 1 Abs. 1 lit. h – Alleinvertriebssysteme
Art. 1 Abs. 1 lit. i – Rechte des geistigen Eigentums
Art. 1 Abs. 1 lit. j – Know-how
1. Inhaltliche Bedeutung des Know-how-Begriffs
2. Geheim, wesentlich, identifiziert
Art. 1 Abs. 1 lit. k – Abnehmer/Handelsvertreter
1. Bedeutung
2. Definition von Handelsvertreterverträgen
2.1 Überblick
2.2 Definition anhand finanzieller und geschäftlicher Risiken
2.2.1 Allgemeines
2.2.2 Risiken aus vermittelten Verträgen
2.2.3 Risiken aus marktspezifischen Investitionen
2.2.4 Risiken aus anderen Tätigkeiten auf demselben Markt
2.3 Handelsvertreter und Online-Plattformwirtschaft
3. Zusammenfassende Stellungnahme
Art. 1 Abs. 1 lit. l – Aktiver Verkauf
Art. 1 Abs. 1 lit. m – Passiver Verkauf
Art. 1 Abs. 2 erster Unterabsatz – Unternehmen, Anbieter, Abnehmer
Art. 1 Abs. 2 zweiter Unterabsatz – Verbundene Unternehmen
Art. 2 Abs. 1 – Freistellung
Art. 2 Abs. 2 – Anwendbarkeit für Unternehmensvereinigungen
1. Systematik
2. Unternehmensvereinigung
3. Wareneinzelhändler
4. Umsatzschwelle
5. Würdigung
Art. 2 Abs. 3 – Anwendbarkeit auf Übertragung geistigen Eigentums
1. Art. 2 Abs. 3 Satz 1 – Übertragung geistigen Eigentums als Bestandteil einer vertikalen Vereinbarung
1.1 Übertragung und Nutzung geistigen Eigentums
1.2 Vertikale Vereinbarung als Hauptgegenstand
1.3 Zweckbindung
2. Art. 2 Abs. 3 Satz 2 – Keine Begründung von mit Art. 4 und 5 vergleichbaren Wettbewerbsbeschränkungen
3. Einzelne Vereinbarungen
3.1 Franchiseverträge
3.1.1 Definition des Franchise
3.1.2 Von der Vertikal-GVO erfasste Franchiseformen
3.1.3 Franchisevereinbarungen und Übertragung geistiger Eigentumsrechte
3.2 Softwareverträge
Art. 2 Abs. 4 – Anwendbarkeit für Wettbewerber
1. Art. 2 Abs. 4 Satz 1
2. Art. 2 Abs. 4 Satz 2
2.1 Keine Ausnahme für Vereinbarungen mit umsatzschwachen Abnehmern
2.2 Art. 2 Abs. 4 Satz 2 lit. a und lit. b
2.2.1 Art. 2 Abs. 4 Satz 2 lit. a: Dualer Vertrieb
2.2.2 Art. 2 Abs. 4 zweiter Halbsatz lit. b
3. Vertikale Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern außerhalb der Vertikal-GVO
Art. 2 Abs. 5 – Informationsaustausch unter Wettbewerbern
Art. 2 Abs. 6 – Online-Vermittlungsdienste
Art. 2 Abs. 7 – Andere Gruppenfreistellungsverordnungen
1. Verhältnis zu den früher geltenden Gruppenfreistellungsverordnungen (Alleinvertriebs-GVO, Alleinbezugs-GVO und Franchise-GVO)
2. Verhältnis zur Kfz-GVO
3. Verhältnis zur TT-GVO
4. Verhältnis zu den horizontalen Gruppenfreistellungsverordnungen (F&E-GVO und Spezialisierungs-GVO)
Art. 3 – Marktanteilsschwelle
1. Vorbemerkung
2. „Analoge Anwendung“
3. Umdrehung des Regel-Ausnahme-Prinzips
4. Die zweite Marktanteilsschwelle
5. Folgen bei Überschreitung mindestens einer Marktanteilsschwelle
Art. 3 Abs. 1 – Zweiparteienvereinbarung
Art. 3 Abs. 2 – Mehrparteienvereinbarung
Art. 4 – Kernbeschränkungen
1. Einordnung
2. Regelungsinhalt des Einleitungssatzes
Art. 4 lit. a – Preisbindung
1. Art. 4 lit. a erster Halbsatz – Fest- und Mindestpreisbindung
1.1 Beschränkung der Verkaufspreise des Abnehmers
1.2 Entscheidungspraxis und Bußgelder
1.3 Direkte Vorgaben zu Weiterverkaufspreisen
1.4 Indirekte Preisbindung
1.5 Aktionsplanung
1.6 Spannen- oder Margengarantie
1.7 Mindestwerbepreise
1.8 Preisbindung im Dreiparteienverhältnis
1.9 Erfüllungsverträge
1.10 Hub-and-Spoke-Vereinbarungen
1.11 Dynamic Pricing
1.12 Datenaustausch zwischen Anbieter und Abnehmer
1.13 Bewertung von Fest- und Mindestpreisen nach der Legalausnahme des Art. 101 Abs. 3 AEUV
1.14 Versuchte Preisbindung nach deutschem Recht, § 21 Abs. 2 GWB
2. Art. 4 lit. a zweiter Halbsatz – Ausnahmeregelung für Höchstpreise und Preisempfehlungen
2.1 Wettbewerbsbeschränkung im Sinne von Art. 101 Abs. 1 AEUV
2.1.1 Höchstpreise
2.1.2 Preisempfehlungen
2.2 Grundsatz der Gruppenfreistellung
2.2.1 Preisvorgaben des Anbieters
2.2.2 Absatzförderungsmaßnahmen
2.3 Ausnahmsweise keine Gruppenfreistellung bei Anreizgewährung oder Druckausübung
2.3.1 Gewährung von Anreizen
2.3.2 Ausübung von Druck
2.3.3 Preispflege
2.3.4 Irrelevanz des Befolgungsgrads
2.3.5 Besonderheiten bei Höchstpreisen
2.3.6 Besonderheiten bei Preisempfehlungen
3. Meistbegünstigung
3.1 Verschiedene Formen von Meistbegünstigungsklauseln
3.2 Verpflichteter der Meistbegünstigungsklausel
3.3 Meistbegünstigungsklauseln zulasten des Anbieters
3.4 Meistbegünstigungsklauseln zulasten des Abnehmers
3.5 Preisparitätsverpflichtungen im Internetvertrieb
3.6 Bewertung außerhalb der Vertikal-GVO
3.6.1 Herkömmliche Meistbegünstigungsklauseln
3.6.2 Verschiedene Arten von Paritätsverpflichtungen im Internetvertrieb
3.6.3 Plattformübergreifende Einzelhandels-Paritätsverpflichtungen
3.6.4 Enge (auf direkte Vertriebskanäle beschränkte) Paritätsverpflichtungen im Online-Einzelhandel
3.6.5 Paritätsverpflichtungen auf vorgelagerter Ebene
Art. 4 lit. b–d – Gebiets- und Kundenbeschränkungen
1. Erläuterung zur neuen Kommentierung von Art. 4 lit. b–d
2. Regelungsinhalt
3. Typische Fälle unmittelbarer und mittelbarer Gebiets- und Kundenbeschränkungen
4. Zulässige Beschränkungen des aktiven Verkaufs in/an exklusiv zugewiesene Gebiete/Kundengruppen
4.1 Vom Vertragsgebiet zum Alleinvertriebsgebiet
4.2 Unterscheidung zwischen aktiven und passiven Verkäufen
4.3 Der Begriff der „Kundengruppe“
4.4 Alleinvertriebsgebiete und Alleinvertriebskunden
4.5 Vertragliche Umsetzung
4.6 Zulässige Beschränkung weiterer Handelsstufen
5. Zulässige Beschränkung zum Schutz des selektiven Vertriebs
5.1 Zulässige Beschränkung des Verkaufs zum Schutz des selektiven Vertriebssystems
5.2 Beschränkung des Abnehmers und seiner Kunden
5.3 Beschränkung des aktiven und passiven Verkaufs
5.4 Kombination von selektivem Vertrieb und anderen Arten von Vertriebsformen in unterschiedlichen Gebieten
6. Zulässige Standortklauseln
7. Zulässige Beschränkung der Großhandelsstufe
8. Zulässige Beschränkung in Lieferverträgen
Art. 4 lit. c -- Spezielle Regelungen für den selektiven Vertrieb
1. Art. 4 lit. c Ziff. ii – Beschränkung von Querlieferungen im selektiven Vertrieb
1.1 Zusammenfassung der speziellen Regelungen in Art. 4 für den selektiven Vertrieb
1.2 Querlieferungen zwischen zugelassenen Händlern
1.4 Einschaltung einer Einkaufsgemeinschaft im selektiven Vertrieb
2. Art. 4 lit. c Ziff. iii – Verkaufsbeschränkung auf der Einzelhandelsstufe im selektiven Vertrieb
2.1 Verkauf an Endverbraucher
2.2 Verkauf durch auf der Einzelhandelsstufe tätige Mitglieder
2.3 Beschränkung des aktiven und passiven Verkaufs
2.4 Selektiver Vertrieb in Kombination mit anderen Wettbewerbsbeschränkungen
2.4.1 Kombination mit Alleinvertrieb unter zugelassenen (Einzel-)Händlern
2.4.2 Kombination mit Alleinvertrieb auf der Großhandelsstufe
2.4.3 Kombination mit Bezugspflichten oder Wettbewerbsverboten
2.5 Anwendungsfälle für einen Entzug der Vertikal-GVO
2.6 Prüfung außerhalb der Vertikal-GVO
2.6.1 Echte Markterprobung
2.6.2 Alleinvertrieb auf Großhandelsebene im selektiven Vertriebssystem zum Schutz von Investitionen
2.6.3 Allgemeine Erwägungen zur Legalausnahme, Art. 101 Abs. 3 AEUV
2.7 Selektiver Vertrieb und Kfz-GVO
Exkurs – Franchiseverträge
1. Anwendbarkeit des Art. 101 Abs. 1 AEUV auf Franchiseverträge
1.1 Pronuptia-Rechtsprechung des EuGH
1.2 Konsequenzen aus dem Pronuptia-Urteil
2. Zulässige Beschränkungen in Franchisesystemen
2.1 Beschränkungen zum Schutz von Know-how
2.1.1 Notwendige Beschränkungen zum Schutze von Know-how
2.1.2 Beschränkungen zum Schutz der Einheitlichkeit und des Rufs des Franchisesystems
2.2 Typische Beschränkungen in Franchiseverträgen
2.2.1 Wettbewerbsverbot
2.2.2 Nachvertragliches Wettbewerbsverbot
2.2.3 Beurteilung von ehemals weißen Klauseln nach der Vertikal-GVO
2.3.4 Beurteilung von in der Franchise-GVO ehemals schwarz gelisteten Klauseln
3. Franchise und selektiver Vertrieb
4. Online-Vertrieb in Franchisesystemen
Art. 4 lit. e -- Internetvertrieb
1. Hintergrund
2. Bedeutung des Internetvertriebs und Erkenntnisse aus dem Evaluierungsprozess der Vertikal-GVO
3. Kursorische Darstellung der in Leitlinien aufgezählten Beschränkungen, die entweder als Kernbeschränkungen qualifizieren oder freigestellt sind
3.1 Totalverbote des Internetvertriebs
3.1.1 Typische Beispiele von nicht freigestellten Totalverboten des Internetvertriebs
3.1.2 Rechtfertigungsmöglichkeiten eines Totalverbots der Nutzung des Internets zum Schutze von Gesundheit oder Sicherheit?
3.1.3 Keine Rechtfertigung des Verbots des Internetvertriebs zum Schutz eines spezifischen Vertriebssystems
3.1.4 Totalverbot des Internetvertriebs zum Zwecke der „echten Markterprobung“?
3.2 Vorgaben zur Ausgestaltung eines Online-Shops und Äquivalenzprinzip
3.3 Nichtbelieferung oder Ausschluss reiner Online-Händler
3.4 Internetspezifische Elemente von Preissetzung und Preisbindung
3.5 Geoblocking
3.6 Internetbeschränkungen zum Schutz von Vertriebssystemen
3.6.1 Zulässige Beschränkungen des aktiven Internetverkaufs zum Schutz von Alleinvertriebsgebieten oder -kundengruppen
3.6.1.1. Kommissionsbeispiele für aktive Verkaufsformen im Internet
3.6.1.2 Kommissionsbeispiele für passive Verkaufsformen im Internet
3.6.2 Schutz von selektiven Vertriebssystemen
3.7 Verbot bzw. Beschränkung der Nutzung von Online-Werbung
3.7.1 Markenspezifische Einschränkung der Sichtbarkeit und Auffindbarkeit des Online-Shops
3.7.2 Einschränkungen der Nutzung von Preisvergleichsseiten
3.7.3 Spezifische Einschränkung der Nutzung von Suchmaschinen sowie der Suchmaschinenoptimierung
3.8 Verbot des Verkaufs über Webseiten Dritter oder sog. Drittplattformverbote
Art. 4 lit. f -- Verkaufsbeschränkungen für Anbieter
1. Systematik
2. Ausnahme zur Freistellung von Alleinbelieferungspflichten
Exkurs – Zuliefervereinbarungen
1. Horizontale und vertikale Zuliefervereinbarungen
2. Zulieferbekanntmachung
3. Gruppenfreistellungsverordnung
4. Zusammenfassung
Art. 5 -- Nicht freigestellte Beschränkungen
Art. 5 Abs. 1 lit. a, Abs. 2 -- Zeitliche Beschränkung von Wettbewerbsverboten
1. Art. 5 Abs. 1 lit. a – Keine unbestimmte Dauer oder Laufzeit von mehr als fünf Jahren
2. Stillschweigende Verlängerung nach Ablauf der Laufzeit von fünf Jahren
3. Kombinationen von befristeten Wettbewerbsverboten und unbefristeten Mindestabnahmepflichten
4. Kettenverträge und Verlängerungsoptionen
5. Keine geltungserhaltende Reduktion der Laufzeit
6. Art. 5 Abs. 2 – Ausnahme zur Befristung bei Räumlichkeiten des Anbieters
7. Bewertung außerhalb der Vertikal-GVO
7.1 Wettbewerbsbeschränkung, Art. 101 Abs. 1 AEUV
7.2 Anwendbarkeit der Legalausnahme, Art. 101 Abs. 3 AEUV
Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 -- Nachvertragliche Wettbewerbsverbote
1. Art. 5 Abs. 1 lit. b – Reichweite des grundsätzlichen Verbots
2. Art. 5 Abs. 3 – Befristete Ausnahme vom Verbot bei Verkauf aus denselben Räumlichkeiten und Übertragung von Know-how
3. Art. 5 Abs. 3 zweiter Unterabsatz – Unbefristet zulässige Beschränkung zum Schutz von Know-how
4. Keine nachvertraglichen Wettbewerbsverbote zulasten des Anbieters
Art. 5 Abs. 1 lit. c -- Wettbewerbsverbote in selektiven Vertriebssystemen
1. Verhältnis zu Art. 5 Abs. 1 lit. a und lit. b
2. Marken bestimmter konkurrierender Anbieter
3. Selektiver Vertrieb mit Wettbewerbsverboten außerhalb der Vertikal-GVO
Art. 5 Abs. 1 lit. d -- Plattformübergreifende Paritätsverpflichtungen auf Einzelhandelsebene
Art. 6 -- Entzug des Rechtsvorteils im Einzelfall
1. Voraussetzungen
2. Entzug durch die nationale Wettbewerbsbehörde, Art. 6 Abs. 2
3. Nachweispflichten
Art. 7 -- Nichtanwendung dieser Verordnung
1. Voraussetzungen
2. Verfahren
3. Verordnungsinhalt
4. Rechtsfolgen
Art. 8 -- Anwendung der Marktanteilsschwelle
1. Vorangegangenes Kalenderjahr
2. Absatzwert
3. Dualer Vertrieb
4. Bestimmung des Marktanteils
5. Marktanteil unter 30%
Art. 9 -- Anwendung der Umsatzschwelle
Art. 10 – Übergangszeitraum
Art. 11 – Geltungsdauer
Anhang
Anhang 1 Prüfungsschema der Vertikal-GVO
Anhang 2 Liste vertikaler Wettbewerbsbeschränkungen
Anhang 3 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Auszug)
Anhang 4
Anhang 5
Anhang 6
Anhang 7
Anhang 8
1. EINLEITUNG
1.1. Zweck und Aufbau dieser Leitlinien
1.2. Anwendbarkeit des Artikels 101 AEUVauf vertikale Vereinbarungen
2. AUSWIRKUNGEN VERTIKALER VEREINBARUNGEN
2.1. Positive Auswirkungen
2.2. Negative Auswirkungen
3. GRUNDSÄTZLICH NICHT UNTER ARTIKEL 101 ABSATZ 1 AEUV FALLENDE VERTIKALE VEREINBARUNGEN
3.1. Keine Beeinträchtigung des Handels, Vereinbarungen von geringer Bedeutung und kleine und mittlere Unternehmen
3.2. Handelsvertreterverträge
3.2.1. Handelsvertreterverträge, die nicht unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen
3.2.2. Anwendung des Artikels 101 Absatz 1 AEUVauf Handelsvertreterverträge
3.2.3. Handelsvertretung und Online-Plattformwirtschaft
3.3. Zuliefervereinbarungen
4. ANWENDUNGSBEREICH DER VERORDNUNG (EU) 2022/720
4.1. Durch die Verordnung (EU) 2022/720 geschaffener Safe Harbour
4.2. Definition vertikaler Vereinbarungen
4.2.1. Einseitiges Verhalten fällt nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2022/720
4.2.2. Die Unternehmen sind auf verschiedenen Stufen der Produktions- oder Vertriebskette tätig
4.2.3. Die Vereinbarung bezieht sich auf den Bezug, Verkauf oder Weiterverkauf von Waren oder Dienstleistungen
4.3. Vertikale Vereinbarungen in der Online-Plattformwirtschaft
4.4. Grenzen des Anwendungsbereichs der Verordnung (EU) 2022/720
4.4.1. Vereinigungen von Einzelhändlern
4.4.2. Vertikale Vereinbarungen mit Bestimmungen zu Rechten des geistigen Eigentums
4.4.2.1. Marken
4.4.2.2. Urheberrechte
4.4.2.3. Know-how
4.4.3. Vertikale Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern
4.4.4. Vertikale Vereinbarungen mit Anbietern von Online-Vermittlungsdiensten, die eine Hybridstellung innehaben
4.5. Verhältnis zu anderen Gruppenfreistellungsverordnungen
4.6. Spezielle Arten von Vertriebssystemen
4.6.1. Alleinvertriebssysteme
4.6.1.1. Definition von Alleinvertriebssystemen
4.6.1.2. Anwendung des Artikels 101 AEUV auf Alleinvertriebssysteme
4.6.1.3. Orientierungshilfe zur Einzelfallprüfung von Alleinvertriebsvereinbarungen
4.6.2. Selektive Vertriebssysteme
4.6.2.1. Definition von selektiven Vertriebssystemen
4.6.2.2. Anwendung des Artikels 101 AEUV auf selektive Vertriebssysteme
4.6.2.3. Hinweise zur Einzelfallprüfung selektiver Vertriebsvereinbarungen
4.6.3. Franchising
5. MARKTABGRENZUNG UND BERECHNUNG DER MARKTANTEILE
5.1. Bekanntmachung über die Definition des relevanten Marktes
5.2. Berechnung der Marktanteile nach der Verordnung (EU) 2022/720
5.3. Berechnung der Marktanteile nach der Verordnung (EU) 2022/720
6. ANWENDUNG DER VERORDNUNG (EU) 2022/720
6.1. Kernbeschränkungen nach der Verordnung (EU) 2022/720
6.1.1. Preisbindung der zweiten Hand
6.1.2. Kernbeschränkungen nach Artikel 4 Buchstaben b, c, d und e der Verordnung (EU) 2022/720
6.1.2.1. Einstufung als Kernbeschränkung nach Artikel 4 Buchstaben b, c, d und e der Verordnung (EU) 2022/720
6.1.2.2. Unterschied zwischen „aktivem Verkauf“ und „passivem Verkauf“
6.1.2.3. Kernbeschränkungen in Bezug auf bestimmte Vertriebssysteme
6.1.2.3.1. Anbieter betreibt Alleinvertriebssystem
6.1.2.3.2. Anbieter betreibt selektives Vertriebssystem
6.1.2.3.3. Anbieter betreibt freies Vertriebssystem
6.1.3. Beschränkungen des Verkaufs von Ersatzteilen
6.2. Beschränkungen, die von der Verordnung (EU) 2022/720 ausgenommen sind
6.2.1. Wettbewerbsverbote, die eine Dauer von fünf Jahren überschreiten
6.2.2. Nachvertragliche Wettbewerbsverbote
6.2.3. Wettbewerbsverbote, die den Mitgliedern eines selektiven Vertriebssystems auferlegt werden
6.2.4. Plattformübergreifende Einzelhandels-Paritätsverpflichtungen
7. ENTZUG UND NICHTANWENDUNG
7.1. Entzug des Rechtsvorteils der Verordnung (EU) 2022/720
7.2. Nichtanwendung der Verordnung (EU) 2022/720
8. DURCHSETZUNG IM EINZELFALL
8.1. Grundlagen der Prüfung
8.1.1. Maßgebliche Faktoren für die Prüfung nach Artikel 101 Absatz 1 AEUV
8.1.2. Maßgebliche Faktoren für die Prüfung nach Artikel 101 Absatz 3 AEUV
8.2. Prüfung von spezifischen vertikalen Beschränkungen
8.2.1. Markenzwang
8.2.2. Alleinbelieferung
8.2.3. Beschränkungen hinsichtlich der Nutzung von Online-Marktplätzen
8.2.4. Beschränkungen der Nutzung von Preisvergleichsdiensten
8.2.5. Paritätsverpflichtungen
8.2.5.1. Plattformübergreifende Einzelhandels-Paritätsverpflichtungen
8.2.5.2. Einzelhandels-Paritätsverpflichtungen in Bezug auf direkte Vertriebskanäle
8.2.5.3. Beurteilung von Einzelhandels-Paritätsverpflichtungen nach Artikel 101 Absatz 3 AEUV
8.2.5.4. Paritätsverpflichtungen auf vorgelagerter Ebene
8.2.5.5. Meistbegünstigungsverpflichtungen
8.2.6. Vorauszahlungen für den Zugang
8.2.7. Produktgruppenmanagement-Vereinbarungen
8.2.8. Kopplungsbindung
Literaturverzeichnis
Sachregister
Abkürzungsverzeichnis
a.A.
andere Ansicht
a.a.O.
am angegebenen Ort
ABl.
Amtsblatt
Abs.
Absatz
Abschlussbericht zur e-Commerce Sektoruntersuchung
Bericht der Kommission an den Rat und das europäische Parlament, Abschlussbericht über die Sektoruntersuchung zum elektronischen Handel (SWD (2017) 154 final), 10.5.2017, COM (2017) 229 final
a.E.
am Ende
AEUV
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Konsolidierte Fassung, ABl. EU 2010 C 83/47
a.F.
alte Fassung
AG
Die Aktiengesellschaft (Zeitschrift)
Alleinbezugs-GVO
Verordnung (EWG) Nr. 1984/83 der Kommission vom 22. Juni 1983 über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von Alleinbezugsvereinbarungen, ABl. EG 1983 L 173/5
Alleinvertriebs-GVO
Verordnung (EWG) Nr. 1983/83 der Kommission vom 22. Juni 1983 über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von Alleinvertriebsvereinbarungen, ABl. EG 1983 L 173/1
Anm.
Anmerkung
Art.
Artikel
Art. 81 Abs. 3 – Leitlinien
Bekanntmachung der Kommission, Leitlinien zur Anwendung von Art. 81 Abs. 3 EG-Vertrag, ABl. EG 2004 C 101/8
Aufl.
Auflage
Az.
Aktenzeichen
BB
Betriebs-Berater (Zeitschrift)
Bd.
Band
Bekanntmachung Relevanter Markt
Bekanntmachung der Kommission über die Abgrenzung des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der Union, ABl. EU C/2024/1645
Bekanntmachung Relevanter Markt 1997
Bekanntmachung der Kommission über die Definition des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft, ABl. EG 1997 C 372/5
Beschl.
Beschluss
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl.
Bundesgesetzblatt
BGH
Bundesgerichtshof
BGHZ
Entscheidungssammlung des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen
BKartA
Bundeskartellamt
BKartA-Bagatellbekanntmachung
Bekanntmachung Nr. 18/2007 des Bundeskartellamtes über die Nichtverfolgung von Kooperationsabreden mit geringer wettbewerbsbeschränkender Bedeutung vom 13. März 2007
Bonusregelung
BKartA, Bekanntmachung Nr. 9/2006 über den Erlass und die Reduktion von Bußgeldern in Kartellsachen – Bonusregelung – vom 7.3.2006 („Bonusregelung“)
bzw.
beziehungsweise
CR
Computer & Recht (Zeitschrift)
DB
Der Betrieb (Zeitschrift)
De-minimis-Bekanntmachung
Mitteilung der Kommission, Bekanntmachung der Kommission über Vereinbarungen von geringer Bedeutung, die im Sinne des Artikels 101 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union den Wettbewerb nicht spürbar beschränken (De-minimis-Bekanntmachung), ABl. EU 2014 C 291/1
De-minimis-Bekanntmachung 2001
Bekanntmachung der Kommission über Vereinbarungen von geringer Bedeutung, die den Wettbewerb gemäß Art. 81 Abs. 1 des Vertrages nicht spürbar beschränken (de minimis), ABl. EG 2001 C 368/13
d.h.
das heißt
DStR
Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift)
E.C.L.R.
European Competition Law Review (Zeitschrift)
EFTA
Europäische Freihandelsassoziation
EG
Europäische Gemeinschaft
EGV
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, ABl. EG 2001 C 80/1
Entsch.
Entscheidung
etc.
et cetera
EU
Europäische Union
EuG
Gericht der Europäischen Union
EuGH
Gerichtshof der Europäischen Union
EUV
Vertrag über die Europäische Union, Konsolidierte Fassung, ABl. EU 2010, C 83/13
EuZW
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (Zeitschrift)
EWG
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWiR
Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht (Zeitschrift)
EWR
Europäischer Wirtschaftsraum
EWS
Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht (Zeitschrift)
Expert Report – Information exchange in dual distribution, 2022
Expert Report on the review of the Vertical Block Exemption Regulation, Information exchange in dual distribution, 2022, Final report prepared by COMMEO Rechtsanwälte und Notar
f.
folgende
F&E
Forschung und Entwicklung
F&E-GVO
Verordnung (EU) Nr. 2023/1066 der Kommission vom 1. Juni 2023 über die Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung, ABl. EU 2023 L 143/9
ff.
fortfolgende
Fn.
Fußnote
Franchise-GVO
Verordnung (EWG) Nr. 4087/88 der Kommission vom 28. Dezember 1988 über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von Franchisevereinbarungen, ABl. EG 1988 L 359/46
GA
Generalanwalt
Geoblocking-VO
Verordnung (EU) 2018/302 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2018 über Maßnahmen gegen ungerechtfertigtes Geoblocking und andere Formen der Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung des Kunden innerhalb des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2006/2004 und (EU) 2017/2394 sowie der Richtlinie 2009/22/EG, ABl. EU 2018 L 601/1
ggf.
gegebenenfalls
GRUR Int
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (Zeitschrift)
GVO
Gruppenfreistellungsverordnung
GWB
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 3245), zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 400) geändert
GWB 1999
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, in der Fassung vom 1. Januar 1999, BGBl. I 1998, S. 2546
Handelsvertreterrichtlinie
Richtlinie 86/653/EWG des Rates vom 18. Dezember 1986 zur Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten betreffend die selbständigen Handelsvertreter, ABl. EG 1986 L 382/17
HGB
Handelsgesetzbuch
Hinweispapier zum Preisbindungsverbot im LEH
Bundeskartellamt, Hinweise zum Preisbindungsverbot im Bereich des stationären Lebensmitteleinzelhandels, Juli 2017
h.M.
herrschende Meinung
Horizontale Leitlinien
Mitteilung der Kommission, Leitlinien zur Anwendbarkeit des Artikels 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit, ABl. EU 2023 C 259/1
i.V.m.
in Verbindung mit
K&R
Kommunikation & Recht (Zeitschrift)
Kfz
Kraftfahrzeug
Kfz-GVO
Verordnung (EU) Nr. 461/2010 der Kommission vom 27. Mai 2010 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen im Kraftfahrzeugsektor, ABl. EU 2010 L 129/52
Kfz-GVO 2002
Verordnung (EG) Nr. 1400/2002 der Kommission vom 31. Juli 2002 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen im Kraftfahrzeugsektor, ABl. EG 2002 L 203/30
Kfz-Leitlinien 2010
Bekanntmachung der Kommission, Ergänzende Leitlinien für vertikale Beschränkungen in Vereinbarungen über den Verkauf und die Instandsetzung von Kraftfahrzeugen und den Vertrieb von Kraftfahrzeugersatzteilen, ABl. EU2010C138/16
Kfz-Leitlinien Ergänzung 2023
Mitteilung der Kommission, Änderung der Bekanntmachung der Kommission – Ergänzende Leitlinien für vertikale Beschränkungen in Vereinbarungen über den Verkauf und die Instandsetzung von Kraftfahrzeugen und den Vertrieb von Kraftfahrzeugersatzteilen, ABl. EU 2023 C 133 I/1
KG
Kammergericht
KMU
kleine und mittlere Unternehmen
Know-how-Richtlinie
Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung, ABl. EU 2016 157/1
Komm.
Kommission der Europäischen Union
Konsolidierte Kfz-Leitlinien
Kfz-Leitlinien 2010 und Kfz-Leitlinien Ergänzung 2023 zusammen
Leitlinien
Mitteilung der Kommission, Bekanntmachung der Kommission, Leitlinien für vertikale Beschränkungen, ABl. EU 2022 C 248/1
Leitlinien 2000
Mitteilung der Kommission, Leitlinien für vertikale Beschränkungen, ABl. EG 2000 C 291/1
Leitlinien 2010
Mitteilung der Kommission, Leitlinien für vertikale Beschränkungen, ABl. EU 2010 C 130/1
Leitlinien zum Kronzeugenprogramm
Bekanntmachung Nr. 14/2021 des Bundeskartellamtes vom 23. August 2021 über allgemeine Verwaltungsgrundsätze über die Ausübung des Ermessens bei der Gestaltung des Verfahrens und der Anwendung des kartellrechtlichen Kronzeugenprogramms nach §§ 81h–81n GWB
LG
Landgericht
lit.
litera (Buchstabe)
MMR
Multimedia und Recht (Zeitschrift)
MüKoWettbR
Münchener Kommentar zum Wettbewerbsrecht
m.w.N.
mit weiteren Nachweisen
NJW
Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)
Nr.
Nummer
NZG
Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht (Zeitschrift)
OEM
Original Equipment Manufacturer
OFT
Office of Fair Trading
OLG
Oberlandesgericht
RIW
Recht der Internationalen Wirtschaft (Zeitschrift)
rkr.
rechtskräftig
Rn.
Randnummer
Rs.
Rechtssache
Rspr.
Rechtsprechung
s.
siehe
S.
Seite
Slg.
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofs und des Gerichts der Europäischen Union
Sp., li. Sp., re. Sp.
Spalte, linke Spalte, rechte Spalte
Spezialisierungs-GVO
Verordnung (EU) Nr. 2023/1067 der Kommission vom 1. Juni 2023 über die Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf bestimmte Gruppen von Spezialisierungsvereinbarungen, ABl. EU 2023 L 143/20
st. Rspr. Staff Working Document 2020 – Vertikal-GVO
ständige Rechtsprechung Commission Staff Working Document, Evaluation of the Vertical Block Exemption regulation, SWD (2020) 172 final
Staff Working Document – De Minimis
Commission Staff Working Document, Guidance on restrictions of competition “by object” for the purpose of defining which agreements may benefit from the De Minimis Notice – Accompanying the document Communication from the Commission, Notice on agreements of minor importance which do not appreciably restrict competition under Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (De Minimis Notice), SWD (2014) 198 final – revised version of 3.6.2015
Staff Working Document e-Commerce Sektoruntersuchung
Commission Staff Working Document, Report from the Commission to the Council and the European Parliament, Final report on the E-commerce Sector Inquiry, COM (2017) 229 final 10.5.2017, SWD (2017) 154 final
Staff Working Document, Geo-blocking practices in the EU
Commission Staff Working Document, Geo -blocking practices in e-commerce, Issues paper presenting initial findings of the e-commerce sector inquiry conducted by the Directorate-General for Competition, 18.3.2016, SWD (2016)70 final
TT-GVO
Verordnung (EU) Nr. 316/2014 der Kommission vom 21. März 2014 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen, ABl. EU 2014 L 93/17
TT-GVO 2004
Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission vom 27. April 2004 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen, ABl. EG 2004 L 123/11
TT-Leitlinien
Mitteilung der Kommission, Leitlinien zur Anwendung von Artikel 101 des Vertrages für die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Technologietransfer-Vereinbarungen, ABl. EU 2014 C 89/3
Tz.
Textziffer
Urt.
Urteil
v.
von, vom
verb.
verbunden
VertBek-Erläuterungen
Erläuterungen der Wettbewerbskommission zur Bekanntmachung über die wettbewerbsrechtliche Behandlung vertikaler Abreden vom 12. Dezember 2022
Vertikalbekanntmachung
Bekanntmachung über die wettbewerbliche Behandlung vertikaler Abreden, Beschluss der Wettbewerbskommission vom 12. Dezember 2022, Bundesblatt 2022, 3231
Vertikal-GVO
Verordnung (EU) Nr. 720/2022 der Kommission vom 10. Mai 2022 über die Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen, ABl. EU 2022 L 134/4
Vertikal-GVO 2010
Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission vom 20. April 2010 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen, ABl. EU 2010 L 102/1
Vertikal-GVO 1999
Verordnung (EG) Nr. 2970/1999 vom 22. Dezember 1999 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen, ABl. EG 1999 L 336/21
vgl.
vergleiche
VO
Verordnung
VO Nr. 1/2003
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrages niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABl. EG 2003 L 1/1
VO Nr. 17
Erste Durchführungsverordnung zu den Artikeln 85 und 86 des Vertrages, ABl. EG 1962 Nr. 13/204, zuletzt geändert durch VO Nr. 1216/99, ABl. EG 1999 L 148/5
VO Nr. 19/65
Verordnung (EWG) Nr. 19/65 des Rates vom 2. März 1965 über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen, ABl. 1965 Nr. 36/533
VO Nr. 240/96
Verordnung (EG) Nr. 240/96 der Kommission vom 31. Januar 1996 zur Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen, ABl. EG 1996 L 31/2
VO Nr. 1215/1999
Verordnung (EG) vom 10. Juni 1999 zur Änderung der Verordnung Nr. 19/65/EWG über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen, ABl. EG 1999 L 148/1
WRP
Wettbewerb in Recht und Praxis (Zeitschrift)
WuW
Wirtschaft und Wettbewerb (Zeitschrift)
WuW/E
Wirtschaft und Wettbewerb, Entscheidungssammlung
z.B.
zum Beispiel
Ziff.
Ziffer
zit.
zitiert
Zulieferbekanntmachung
Bekanntmachung der Kommission vom 18. Dezember 1978 über die Beurteilung nach Art. 85 Abs. 1 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, ABl. EG 1979 C 1/2
ZVglRWiss
Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaften (Zeitschrift)
ZWeR
Zeitschrift für Wettbewerbsrecht (Zeitschrift)
Zwischenstaatlichkeits-Bekanntmachung
Bekanntmachung der Kommission, Leitlinien über den Begriff der Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels in den Art. 81 und 82 des Vertrages, ABl. EG 2004 C 101/81
Einleitung
1. Entstehungsgeschichte
1
Auch wenn die Notwendigkeit, die Geschichte der Vertikal-GVO zu kennen, 25 Jahre nach ihrer erstmaligen Verabschiedung immer geringer wird und die Kenntnis der Geschichte immer weniger Bedeutung für das richtige Verständnis der Vertikal-GVO hat, soll der auch insoweit interessierte Leser nicht auf nicht immer vorhandene Vorauflagen verwiesen werden, sondern seinem Interesse nach wie vor in der Einleitung nachgehen können.
2
Die Ablösung der früher im Bereich vertikaler Wettbewerbsbeschränkungen geltenden Gruppenfreistellungsverordnungen für Alleinvertriebs1-, Alleinbezugs2- und Franchise3-Vereinbarungen durch die Vertikal-GVO 19994 begann mit der Verabschiedung des Grünbuchs zur EG-Wettbewerbspolitik gegenüber vertikalen Beschränkungen5 durch die Kommission am 22. Januar 1997; sie war mit dem endgültigen Außerkrafttreten der zitierten Gruppenfreistellungsverordnungen und der Anwendung der Vertikal-GVO auch auf alle am 31. Mai 2000 bereits in Kraft befindlichen vertikalen Vereinbarungen nach Art. 12 Abs. 2 Vertikal-GVO 19996 zum Ende des Jahres 2001, also fast fünf Jahre später, beendet. Seitdem spielt die Vertikal-GVO in der Anwendungspraxis eine herausragende Rolle, ohne dass dies wirklich seinen Niederschlag in umfangreicher Behörden- oder Gerichtspraxis gefunden hätte. Offenbar ist die Vertikal-GVO mit Hilfsmitteln wie diesem Praxiskommentar doch einfacher zu handhaben als ursprünglich von vielen befürchtet. Zudem waren vertikale Wettbewerbsbeschränkungen, nachdem im letzten Jahrhundert die wesentlichen Grundlagen der Rechtsanwendung gelegt waren, nicht im Fokus der Behörden. Das hat sich in den letzten etwa zehn Jahren allerdings geändert.
3
Mit der jetzt geltenden Vertikal-GVO7 wird diese Erfolgsgeschichte fortgeschrieben. Und mittlerweile gibt es auch wieder berichtenswerte Entscheidungen von Behörden und Gerichten, insbesondere zu den klassischen Kernbeschränkungen Preisbindung und Weiterverkaufsverbote sowie den modernen Themen wie z.B. Vorgaben für den Internetvertrieb, Plattformverboten oder Bestpreisklauseln. Diese Bereiche sind nun auch in der Vertikal-GVO und den Vertikalen Leitlinien ausführlich abgehandelt.
4
Das 1997 veröffentlichte Grünbuch enthielt eine Darstellung der wirtschaftlichen Bedeutung von Wettbewerbsbeschränkungen im Vertrieb, der seinerzeitigen Behandlung solcher Wettbewerbsbeschränkungen, der Vor- und Nachteile dieser Behandlung sowie einen Vergleich mit der Behandlung vertikaler Wettbewerbsbeschränkungen in Drittstaaten. Auf dieser Grundlage stellte die Kommission dann vier „Optionen“ für die künftige Behandlung vertikaler Wettbewerbsbeschränkungen zur Diskussion:
Option I
– Beibehaltung des bisherigen Systems.
Option II
– Fortentwicklung der bisherigen Gruppenfreistellungsverordnungen mit dem Ziel, sie flexibler und weniger dirigistisch zu machen sowie ihren Anwendungsbereich auf mehr unterschiedliche Situationen zu erweitern.
Option III
– Einführung einer Marktanteilsschwelle von 40% in Option I oder II, bei deren Überschreiten die Gruppenfreistellungsverordnungen keine Anwendung mehr finden.
Option IV
– Einführung einer Marktanteilsschwelle von 20%, unterhalb derer es eine von der Kommission widerlegbare Vermutung für die Zulässigkeit vertikaler Wettbewerbsbeschränkungen geben sollte. Oberhalb von 20% wäre dann gemäß Option II oder Option III verfahren worden.
5
Dies waren nicht vier völlig getrennte Möglichkeiten, sondern der Sache nach der einheitliche Vorschlag, für vertikale Wettbewerbsbeschränkungen bei einem Marktanteil der Beteiligten von bis zu 20% eine Vermutung der Zulässigkeit einzuführen und den Anwendungsbereich der Gruppenfreistellungsverordnungen sachlich zu erweitern, aber auf Situationen zu beschränken, in denen die Beteiligten über Marktanteile von nicht mehr als 40% verfügen. In jedem Fall würden absolute Exportverbote und die Preisbindung per se verboten bleiben.
6
Gegen die Einführung von Marktanteilsschwellen wurden seinerzeit viele Argumente vorgebracht.8 Die Kommission hatte jedoch letztlich abzuwägen, ob sie weiterhin mit engen Gruppenfreistellungsverordnungen mit umfassender Anwendung, also hoher Rechtssicherheit, oder mit weiten Gruppenfreistellungsverordnungen arbeiten wollte, die dann aber oberhalb eines bestimmten Marktanteilsniveaus weniger oder gar keine Rechtssicherheit mehr bieten.
7
In der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der EU-Wettbewerbsregeln auf vertikale Beschränkungen9 hat sich die Kommission für keine der Optionen des Grünbuchs, sondern grundsätzlich für den dann direkt in die Vertikal-GVO einmündenden Weg entschieden: Grundlage ist eine sehr weite Gruppenfreistellungsverordnung, die mit Ausnahme einiger weniger Kernbeschränkungen alles erlaubt und die oberhalb einer bestimmten Marktanteilsschwelle nicht mehr anwendbar ist. Ende 1998 war lediglich noch die Frage offen, ob es eine Marktanteilsschwelle (im Rahmen von 25–35%) oder in Anlehnung an Option IV des Grünbuchs zwei Marktanteilsschwellen (20% und 40%) geben sollte.
8
Im Zusammenhang mit der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der EU-Wettbewerbsregeln auf vertikale Beschränkungen aus 1998 wurde als „flankierende Maßnahme“ der Entwurf derjenigen Verordnung vorgelegt, mit der Art. 4 Abs. 2 VO Nr. 1710 dergestalt geändert wurde, dass er alle vertikalen Vereinbarungen erfasst.11 Art. 4 Abs. 2 erlaubte nach der Änderung für alle vertikalen Vereinbarungen die (Einzel-)Freistellung rückwirkend auf den Tag des Vertragsbeginns, nicht wie bis dahin auf den Tag der Anmeldung.12 Damit war sichergestellt, dass auch dann, wenn sich die Parteien bei der Einschätzung des Marktanteils geirrt hatten, noch nicht alles verloren war; die gegebenenfalls notwendige Einzelfreistellung konnte noch Jahre danach mit Rückwirkung vom ersten Tag an erteilt werden.
9
Zeitgleich mit dieser Änderung wurde auch die Ermächtigungsverordnung Nr. 19/6513 durch die Verordnung Nr. 1215/1999 vom 10. Juni 199914 geändert.Die umfangreichen Erwägungsgründe zu der Änderungsverordnung enthalten eine gute Zusammenfassung der Entstehungsgeschichte sowie der Überlegungen und Ziele der Kommission.
10
Auf der Grundlage der Ausführungen in der Mitteilung erstellte die Kommission dann sowohl den Entwurf der Vertikal-GVO 199915 als auch der sie begleitenden Leitlinien und veröffentlichte beide am 24. September 1999 im Amtsblatt.16 Der Marktanteil, oberhalb dessen die Verordnung keine Anwendung mehr finden sollte, wurde im Sinne eines Kompromisses auf 30% festgezurrt.
11
Drei Monate später, am 29. Dezember 1999, wurde der endgültige Text der Vertikal-GVO 1999 veröffentlicht.17 Die endgültigen Leitlinien für vertikale Beschränkungen wurden allerdings in ihrer englischen Form erst wenige Tage vor Inkrafttreten der Vertikal-GVO 1999 (am 1. Juni 2000) im Internet veröffentlicht; die Publikation in allen Gemeinschaftssprachen im Amtsblatt erfolgte erst 4½ Monate später am 13. Oktober 2000.18
12
Mit Einführung der Vertikal-GVO wurde der „form-based approach“ der alten Gruppenfreistellungsverordnungen zu Grabe getragen und durch den „effectsbased approach“ ersetzt.19
13
Nach Art. 13 Vertikal-GVO 1999 galt diese für zehn Jahre bis zum 31. Mai 2010. Rechtzeitig vor diesem Datum führte die Kommission im Frühjahr 2008 eine Erhebung bei den Mitgliedstaaten durch, um deren Auffassung und gegebenenfalls Erfahrungen kennenzulernen.20 Im weiteren Verlauf wurde dann schnell klar, dass der grundsätzliche Ansatz der Vertikal-GVO nicht in Frage gestellt werden sollte. Vielmehr konzentrierte sich die öffentliche Diskussion vor allem auf den Internet-Vertrieb: Bei der Einführung der Vertikal-GVO 1999 hatte die Kommission in den Leitlinien 200021 das „Machtwort“ gesprochen:
„Jeder Vertriebshändler muss die Freiheit haben, im Internet für Produkte zu werben und auf diesem Wege Produkte zu verkaufen.“22
14
Von Anfang an reichten die seinerzeit in den Leitlinien 2000, Tz. 51, niedergelegten wenigen Grundsätze nicht aus,23 und nach zehn Jahren galt es, diesen Missstand zu beheben. Als Ergebnis eines umfassenden öffentlichen Konsultationsverfahrens waren die Ausführungen zum Internet-Vertrieb in den Leitlinien 201024 wesentlich ausführlicher und detaillierter; Eingang in den Verordnungstext fand das Internet aber 2010 noch immer nicht.
15
Die Entwürfe der Vertikal-GVO 2010 und der Leitlinien 2010 wurden mehr als zehn Monate vor dem Auslaufen der Vertikal-GVO 1999 am 28. Juli 2009 veröffentlicht. Wenn man von, allerdings wesentlichen, Änderungen bei der zweiten Marktanteilsschwelle (Abstellen auf den Nachfrage- anstatt des ursprünglich vorgesehenen Angebotsmarktes des Abnehmers) und beim Handelsvertreter (neues Risiko nicht auf anderen, sondern auf demselben Markt) absieht, sind die Entwürfe später praktisch unverändert Gesetz geworden.
16
Während die Kommission vor Inkrafttreten der Vertikal-GVO noch eigene Erfahrungen mit Beschränkungen in Vertriebs- und Lieferverträgen sammelte,25 war sie nach dem Wechsel zur unternehmerischen Selbsteinschätzung von Verträgen im Vertikalkontext fast 15 Jahre (von 2003 bis 2017) praktisch inaktiv. Die Vertikal-GVO wurde im mit der VO (EG) 1/2003 eingeführten System der Legalausnahme somit vor allem durch Unternehmen und deren Berater und nur in geringem Umfang durch Kartellbehörden und Gerichte angewandt.
17
Mit der im Jahre 2017 durchgeführten e-Commerce Sektoruntersuchung meldete sich die Kommission mit der Anwendung vertikalen Kartellrechts zurück und führte im Gefolge dieser Untersuchung zahlreiche Bußgeldverfahren gegen Unternehmen insbesondere aus den Branchen Kleidung (Guess,26 Nike,27 Sanrio,28 Elektronik (Asus,29 Denon & Marantz,30 Philips,31 Pioneer32), Video-Spiele undFilme (Valve u.a. (Steam),33 NBCUniversal34) sowie Zahlungsmittel (mastercard35).
18
Unabhängig von Bußgeldverfahren, die Verhalten außerhalb der Vertikal-GVO sanktionieren, kann sich die Kommission für die Gestaltung und die Beurteilung von Verträgen, die für eine allgemeine oder individuelle Ausnahme vom Kartellverbot qualifizieren, jetzt nicht mehr auf eigene Erfahrungen, sondern nur noch auf im Rahmen der Evaluierungsphase gewonnene Erfahrungen Dritter stützen.36
19
Trotz der Laufzeit der Vertikal-GVO von zwölf Jahren begann die Evaluierungsphase im Hinblick auf die aktuelle Vertikal-GVO schon im Oktober 2018.37 Dabei hat die Kommission Interessierte schon früh in den Reformprozess der Vertikal-GVO einbezogen. Zunächst wurden die betroffenen Verkehrskreise in der Zeit von Februar bis Mai 2019 befragt. Nach Auswertung der erhaltenen Antworten fand im November 2019 ein Workshop in Brüssel statt, an dem ausschließlich Betroffene teilnehmen konnten, die sich im Rahmen der öffentlichen Befragung geäußert hatten. Die Evaluierungsphase endete mit Vorlage des Staff Working Document38 im September 2020.
20
In diesem setzte die Kommission sich ausführlich mit ihrer Fallpraxis auseinander und skizzierte, an welcher Stelle sie welchen Korrekturbedarf sah, um zu verhindern, dass wettbewerbsbeschränkende Vertikalvereinbarungen von der neuen Vertikal-GVO zu weitgehend geschützt werden („false positives“) oder wettbewerbsfördernde Vereinbarungen zu stark beschnitten werden („false negatives“). Das Staff Working Document 2020 – Vertikal-GVO ist im Rahmen der öffentlichen Konsultation dann umfassend kommentiert worden und mündete im Juli 2021 in einen ersten Entwurf der neuen GVO und ihrer begleitenden Leitlinien.
21
Die Entwürfe lösten vor allem im Hinblick auf die Behandlung des Informationsaustauschs im dualen Vertrieb Kritik aus. Nach Einholung eines durch die Verfasser39 erstellten Expert Reports wurde dieser Punkt in den finalen Texten nochmals grundlegend verändert. Interessant ist, dass die neue Vertikal-GVO im Ergebnis nur sehr behutsam „false positives“ korrigiert, und dies im Wesentlichen durch Klarstellungen zum Informationsaustausch im dualen Vertrieb und bei Plattformen.40 Nur in Ausnahmefällen ist deshalb für vertikale Verträge eine Anpassung durch die neue Vertikal-GVO zwingend veranlasst, sodass der Ablauf der Übergangsfrist von einem Jahr nach Art. 10 Vertikal-GVO in der Praxis unbemerkt blieb.
22
Unmittelbar im Anschluss begann die „Impact assessment phase“, an deren Beginn die Kommission ein „inception impact assessment“ veröffentlichte und weiteres und spezifischeres Feedback zu ihren Überlegungen erbat. Besonders tief stieg die Kommission in die Bereiche „active sales restrictions“, „online sales and online advertising“ sowie „information exchange in dual distribution“ ein, zu denen sie Expert Reports beauftragte, von denen der zuletzt genannte von zwei Autoren dieses Kommentars verfasst wurde.41
23
Die Entwürfe für die neue Vertikal-GVO wurden am 9. Juli 2021 veröffentlicht und konnten bis zum 17. September 2021 kommentiert werden. Dabei bekamen insbesondere die Vorschläge der Kommission zum Informationsaustausch im Zusammenhang mit dualem Vertrieb, vor allem der Vorschlag der Einführung einer neuen 10%-Marktanteilsschwelle, heftigen Gegenwind. Die Kommission nahm sich das zu Herzen und beauftragte einen Expert Report zu diesem Thema, der von zwei der Autoren erstellt und am 2. Februar 2022 der Kommission vorgelegt wurde. Diese startete daraufhin am 4. Februar 2022 eine zweite Konsultationsphase nur für den Bereich des Informationsaustausches im dualen Vertrieb und legte dazu neben dem Expert Report auch ein Guidance Paper vor, in dem sie ihre in die Vertikalen Leitlinien zu übernehmenden Gedanken ausführte und auch Hinweise zum möglichen neuen Wortlaut des Art. 2 Abs. 5 gab.42
24
Die aktuelle Vertikal-GVO wurde schließlich am 17. Mai 2022 und die Vertikalen Leitlinien am 30. Juni 2022 von der Kommission verabschiedet, sodass sie einheitlich am 1. Juli 2022 in Kraft treten konnten.
1 Verordnung (EWG) Nr. 1983/83 der Komm. v. 26.6.1983 über die Anwendung von Art. 85 Abs. 3 des Vertrages auf Gruppen von Alleinvertriebsverordnungen, ABl. EG 1983 L 173/1 („Alleinvertriebs-GVO“, siehe auch Abkürzungsverzeichnis).
2 Verordnung (EWG) Nr. 1984/83 der Komm. v. 22.6.1983 über die Anwendung von Art. 85 Abs. 3 des Vertrages auf Gruppen von Alleinbezugsvereinbarungen, ABl. EG 1983 L 173/5 („Alleinbezugs-GVO“, siehe auch Abkürzungsverzeichnis).
3 Verordnung (EWG) Nr. 4087/88 der Komm. v. 28.12.1988 über die Anwendung von Art. 85 Abs. 3 des Vertrages auf Gruppen von Franchisevereinbarungen, ABl. EG 1988 L 359/46 („Franchise-GVO“, siehe auch Abkürzungsverzeichnis).
4 Verordnung (EG) Nr. 2790/1999 der Komm. v. 22.12.1999 über die Anwendung von Art. 81 Abs. 3 des Vertrages auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, ABl. EG 1999 L 336/21 („Vertikal-GVO 1999“, siehe Abkürzungsverzeichnis).
5 Grünbuch der Komm. zur EG-Wettbewerbspolitik gegenüber vertikalen Wettbewerbsbeschränkungen, KOM (96) 721 vom 22.1.1997.
6 Siehe dazu Schultze/Pautke/Wagener, Vertikal-GVO, 2. Aufl. 2008, Art. 12 Rn. 771.
7 Verordnung (EU) Nr. 2022/720 der Komm. vom 10.5.2022 über die Anwendung des Art. 101 Abs. 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen, ABl. EU 2022 L 134/4 („Vertikal-GVO“, siehe auch Abkürzungsverzeichnis).
8 Siehe Veelken, ZVglRWiss 97 (1998), 278ff.
9 Mitteilung KOM(1998) 544 endg. der Komm. v. 30.9.1998 über die Anwendung der EU-Wettbewerbsregeln auf vertikale Beschränkungen; vertikale Beschränkungen des Wettbewerbs: konkrete Vorschläge im Anschluss an das Grünbuch, ABl. EG 1998 C 365/3.
10 ABl. EG 1962 Nr. 13/204; siehe Abkürzungsverzeichnis.
11 VO Nr. 1216/1999, ABl. EG L 148/5.
12Ackermann, EuZW 1999, 741, 746.
13 ABl. 1965 Nr. 36/533; siehe Abkürzungsverzeichnis.
14 ABl. EG 1999 L 148/1.
15 Siehe Abkürzungsverzeichnis.
16 ABl. EG 1999 C 270/7.
17 Siehe Abkürzungsverzeichnis; wegen der Regelung zur Fortgeltung der alten Gruppenfreistellungsverordnungen (Alleinvertriebs-, Alleinbezugs- und Franchise-GVO) in Art. 12 Abs. 1 Vertikal-GVO 1999 musste diese seinerzeit unbedingt vor dem Jahresende im Amtsblatt veröffentlicht werden.
18 Mitteilung der Komm., Leitlinien für vertikale Beschränkungen, ABl. EG 2000 C 291/1 („Leitlinien 2000“, siehe Abkürzungsverzeichnis).
19 Siehe zu diesem Aspekt ausführlich Peeperkorn/Wijckmans, E.C.L.R. 2023, 127ff.
20Simon, EWS 2010, 497.
21 Leitlinien 2000, Tz. 51 Satz 1.
22 In den Leitlinien 2000, Rn. 52 Satz 2, liest sich das so: „Prinzipiell muss es jedem Händler erlaubt sein, das Internet für den Verkauf von Produkten zu nutzen.“
23Pautke/Schultze, BB 2001, 317.
24 Mitteilung der Komm., Leitlinien für vertikale Beschränkungen, ABl. EU 2010 C 130/1 („Leitlinien 2010“, siehe Abkürzungsverzeichnis).
25 Siehe den Erwägungsgrund 2 zur ursprünglichen Vertikal-GVO 1999 (Verordnung (EG) Nr. 2790/1999 der Kommission v. 22.12.1999, ABl. L 336/21): „Aufgrund der bisherigen Erfahrungen lässt sich eine Gruppe von vertikalen Vereinbarungen definieren, die regelmäßig die Voraussetzungen von Artikel 81 Absatz 3 erfüllen.“
26 Komm., Entsch. v. 17.12.2018, AT.40428 („Guess“).
27 Komm., Entsch. v. 25.3.2019, AT.40436 Ancillary sports merchandise („Nike“).
28 Komm., Entsch. v. 9.7.2019, AT.40432 Character merchandise („Hello Kitty“).
29 Komm., Entsch. v. 24.7.2018, AT.40465 („Asus“).
30 Komm., Entsch. v. 24.7.2018, AT.40469 („Denon & Marantz“).
31 Komm., Entsch. v. 24.7.2018, AT.40181 („ Philips“).
32 Komm., Entsch. v. 24.7.2018, AT.40182 („Pioneer“).
33 Komm., Entsch. v. 20.1.2021, AT.40413 („Focus Home“); AT.40414 („Koch Media“); AT.40420 – („ZeniMax“); AT.40422 („Bandai Namco“); AT.40424 („Capcom“) („Video Games Cases“), eine Zusammenfassung dieser Entscheidungen ist veröffentlicht in ABl. 2022 C 320/41; die Nichtigkeitsklage gegen diese Entscheidungen hat das EuG zurückgewiesen, Urt. v. 27.9.2023, T-172/21, ECLI:EU:T:2023, 587.
34 Komm., Entsch. v. 30.1.2020, AT.40433 Film merchandise („NBCUniversal“).
35 Komm., Entsch. v. 22.1.2019, AT.40049 („Mastercard II“).
36 Siehe den Erwägungsgrund 2 Satz 2 zur aktuellen Vertikal-GVO vom 10.5.2022 (VO (EU) 2022/720): „Die Erfahrungen mit der Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 330/ 2010 […] waren, wie in der Evaluierung der Verordnung festgestellt, insgesamt positiv.“ Wegner/Schwenker/Altdorf, ZWeR 2022, 243 stellen die Gesetzgebungsgeschichte im Detail dar.
37 Siehe hierzu und im Folgenden die Internet-Seite der Kommission https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2018-vber_en.
38Staff Working Document 2020 – Vertikal-GVO (siehe Abkürzungsverzeichnis), Rn. 2.
39 Expert Report – Information exchange in dual distribution, 2022(siehe Abkürzungsverzeichnis), abrufbar unter https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2022-02/kd0122032enn_VBER_dual_distribution_2.pdf (zuletzt abgerufen am2.11.2023).
40 Art. 2 Abs. 5 und 6 Vertikal-GVO.
41 Siehe detailliert dazu unten → Rn. 577, 591ff.
42 Zu den Details siehe die Kommentierung zu dieser Vorschrift unten → Rn. 591ff.
2. Rechtsgrundlage
25
Die folgenden Ausführungen zur Rechtsgrundlage sind äußerst wichtig, da ohne deren Verständnis eine korrekte Anwendung der Vertikal-GVO nicht möglich ist. Im Rahmen des Kommentars werden wir deshalb immer wieder, insbesondere bei der „Anwendung“ der Leitlinien, auf diese Grundsätze zurückkommen.
26
Die Vertikal-GVO stützt sich auf Art. 101 Abs. 3 AEUV und Art. 103 AEUV sowie die VO Nr. 19/65 des Rates vom 2. März 1965, zuletzt geändert durch VO Nr. 1215/1999 vom 15. Juni 199943 und die VO Nr. 1/2003 vom 16. Dezember 2002.44 Danach ist allein die Kommission für Gruppenfreistellungs-Verordnungen zuständig;45 vermeintlich unsinnige Entscheidungen in der Vertikal- GVO sind also hinzunehmen und können nicht von den Gerichten korrigiert werden.
27
Daraus folgt auch die strenge Unterscheidung zwischen „Kernbeschränkungen nach der Vertikal-GVO“, für die die Kommission zuständig ist, und „bezweckten Wettbewerbsbeschränkungen im Sinne des Art. 101 Abs. 1 AEUV“, für die die Gerichte zuständig sind.46 Insoweit bringen Peeperkorn/Wijckmans47das Problem auf, ob eine Kernbeschränkung, die im konkreten Fall keine Wettbewerbsbeschränkung im Sinne des Art. 101 Abs. 1 AEUV darstellt, dennoch die Anwendung der [Freistellung der] Vertikal-GVO verhindert. Es scheint, dass Peeperkorn/Wijckmans die Frage für ungelöst halten, aber glauben, dass die Kommission sie mit „ja“ beantworten würde. Die Autoren sind anderer Ansicht: Nach Art. 4 sind (bezweckte) Kernbeschränkungen nur solche, die Teil einer vertikalen Vereinbarung sind. Nach Art. 2 Abs. 1 werden vertikale Vereinbarungen nur insoweit freigestellt, als sie vertikale Beschränkungen enthalten. Eine vertikale Beschränkung ist nach Art. 1 Abs. 1 lit. b eine Wettbewerbsbeschränkung in einer vertikalen Vereinbarung, die unter Art. 101 Abs. 1 AEUV fällt. Tut sie das nicht – wie im Sicherheitsbeispiel –, liegt gar keine freistellungsbedürftige vertikale Vereinbarung vor, sodass man schon beim Eingangssatz des Art. 4 wieder aus diesem herausfällt. Das aufgeworfene Problem existiert nicht bzw. lässt sich durch den Wortlaut der Vertikal-GVO lösen.
28
Was Inhalt der Vertikal-GVO ist, bestimmt allein die Kommission, die Gerichte sind insoweit schlicht unzuständig. Sie können im Rahmen ihrer Rechtsprechungstätigkeit die Vertikal-GVO nur insoweit auslegen als nicht eindeutig ist, was die Kommission meinte. Dem gesetzgeberischen Willen der Kommission ist also durch die Rechtsprechung zu folgen, die übrigen Auslegungsmethoden müssen hier zurückstehen.48 Durch diesen Umstand erledigen sich auch alle gutgemeinten Vorschläge in der Literatur, was als Inhalt der Vertikal-GVO angemessener wäre: auf Überlegungen zur Sinnhaftigkeit kommt es nicht an, wenn der Wille der Kommission klar ist. Ein „a.A. Kommission in den Leitlinien“ kann es also nicht geben.49
29
Erlaubt ist allein die Frage, ob die Vertikal-GVO wirklich der Ermächtigungsgrundlage entspricht.50 Dabei sollte es keinem Zweifel unterliegen, dass die Regelungen der Vertikal-GVO 1999, der Vertikal-GVO 2010 sowie diejenigen der Vertikal-GVO voll vom Wortlaut der seinerzeit im Jahre 1999 neu gefassten VO Nr. 19/65 gedeckt sind.51 Diskutiert wurde jedoch zu Recht, ob die neu gefasste VO Nr. 19/65 den Anforderungen von damals Art. 85 Abs. 3 und Art. 87 EGV (heute: Art. 101 Abs. 3 und Art. 103 AEUV) entspricht.52 Problematisch ist in der Tat, ob die vier Freistellungskriterien des Art. 101 Abs. 3 AEUV in der Vertikal-GVO noch hinreichend nachvollziehbar sind. Dies gilt insbesondere für die Frage der Unerlässlichkeit der Wettbewerbsbeschränkung. Denn die Vertikal-GVO stellt vieles frei, was bis zum Jahr 2000 nicht freigestellt war, insbesondere z.B. (mit der Ausnahme in Art. 4 lit. f) alle den Anbieter treffenden Wettbewerbsbeschränkungen.53 Auch die Kommission erkannte im zehnten Erwägungsgrund zur Vertikal-GVO 1999 den Grundsatz des damaligen Art. 81 Abs. 3 EGV (heute: Art. 101 Abs. 3 lit. a AEUV) noch an, wonach keine Wettbewerbsbeschränkungen freigestellt werden dürfen, die für die Herbeiführung der günstigen Wirkungen nicht unerlässlich sind. Da mit Sicherheit nicht alle Wettbewerbsbeschränkungen, welche die Vertikal-GVO freistellt, unerlässlich sind, lässt sich das Konzept nur mit Art. 101 Abs. 3 AEUV in Einklang bringen, wenn man dem Beurteilungsspielraum der Kommission sowie Aspekten der Rechtssicherheit und Praktikabilität erhöhtes Gewicht einräumt.54 Im fünfzehnten Erwägungsgrund der Vertikal-GVO heißt es deshalb im ersten Satz wie auch schon in der Vorgänger-Verordnung abgeschwächt, dass die Verordnung keine Vereinbarungen freistellen „sollte“ (statt darf),
„die wahrscheinlich den Wettbewerb beschränken und den Verbrauchern schaden oder die für die Herbeiführung der effizienzsteigernden Auswirkungen nicht unerlässlich sind“.
30
Trotz aller Begründungsakrobatik hatte die Kommission mit Erlass der Vertikal-GVO für Marktanteile bis zu 30% praktisch das seinerzeit geltende deutsche System übernommen: Vertikale Wettbewerbsbeschränkungen unterliegen im Anwendungsbereich der GVO wie auch schon im früheren bis 2005 geltenden deutschen Recht nicht mehr einem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, sondern nur noch einer Missbrauchskontrolle (Art. 6 und Art. 7 Vertikal-GVO). Mit der 7. GWB-Novelle hat das deutsche Recht sich ab 1. Juli 2005 dann dem europäischen Recht voll angepasst, indem es in § 2 Abs. 2 GWB die Gruppenfreistellungsverordnungen der EU und damit auch die Vertikal-GVO im deutschen Recht für „entsprechend“ anwendbar erklärt. Dies gilt nach § 2 Abs. 2 Satz 2 GWB „auch“ und gerade dann, wenn nicht der zwischenstaatliche Handel, sondern nur ein inländischer Markt betroffen ist.
31
Obwohl die Vertikal-GVO ein Gesetz im materiellen Sinne ist, ist sie in ihrem deutschen Text lediglich ein Werk des Übersetzungsdienstes der Europäischen Kommission, das zwar als Übersetzung von sehr hoher Qualität, den Ansprüchen an ein Gesetz aber nicht genügt. Folglich ist eine ordnungsgemäße Arbeit mit der Vertikal-GVO durch Rechtsprechung und Wissenschaft nur mit gleichzeitigem Blick auf den englischen Original-Text möglich. Ohne Übersetzungen kann die Europäische Union nicht funktionieren, aber unterschiedliche Übersetzungen für dieselben Originaltexte fördern die Rechtseinheit nicht.55
43 ABl. EG 1962 Nr. 13/24; ABl. EG 1999 L 148/5; siehe Abkürzungsverzeichnis.
44 ABl. EG 2003 L 1/1; siehe Abkürzungsverzeichnis.
45 Siehe auch Leitlinien, Tz. 51.
46 Siehe hierzu instruktiv die Ausführungen des EuGH, Urt. v. 29.6.2023, C-211/22, ECLI:EU:C:2023:529, Rn. 37–43 („Super Bock“).
47Peeperkorn/Wijckmans, E.C.L.R. 2023, 127, 135; Wijckmans/Tuytschaever, Vertical Arguments in EU Competition Law, 4. Aufl. 2025, Rn. 628 diskutieren die Frage sehr ausführlich und stimmen grundsätzlich der im Folgenden dargelegten Lösung zu.
48 Siehe auch Schultze/Pautke/Wagener, WuW 2023, 646, 647 zur Auslegung.
49Bechtold/Bosch/Brinker, EU-Kartellrecht, 4. Aufl. 2023, Art. 1 Vertikal-GVO Rn. 3 und 19, finden sich allerdings derartige Hinweise. Zur Bedeutung der Leitlinien siehe jetzt auch ausführlich die Stellungnahme der Generalanwältin Medina v. 9.1.2025, C-581/23, ECLI:EU:C:2025:5, Rn. 50f. („Beevers Kaas“), bestätigt durch EuGH, Urt. v. 8.5.2025, Rs. C-581/23, ECLI:EU:C:2025:323, Rn. 39 („Beevers Kaas“).
50 Dazu sogleich im Text.
51Ellger, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd. 1: EU, 7. Aufl. 2025, Einl Vertikal-GVO Rn. 19a.E.; so auch für die Vertikal-GVO 2010 ausdrücklich OLG Düsseldorf, Urt. v. 4.12.2017, VI-U (Kart) 5/17, Rn. 30 („Expedia“).
52Paulweber/Kögel, AG 1999, 509.
53 Siehe unten Art. 4 lit. f → Rn. 1146.
54Ellger, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Bd. 1: EU, 7. Aufl. 2025, Einl Vertikal-GVO Rn. 20.
55 So wurden in der deutschen Fassung der Vertikal-GVO 2010 die am Vertrag beteiligten Unternehmen mit den verwechslungsfähigen Begriffen „Anbieter“ und „Abnehmer“ statt vorher „Verkäufer“ und „Käufer“ bezeichnet, obwohl der englische Originaltext unverändert die Begriffe „supplier“ und „buyer“ verwandte.
3. Grundlagen und Systematik
32
Art. 101 Abs. 1 AEUV verbietet Vereinbarungen, abgestimmte Verhaltensweisen und Beschlüsse zwischen Unternehmen und Unternehmensvereinigungen, die (i) eine spürbare56 Wettbewerbsbeschränkung bezwecken oder bewirken, und die (ii) geeignet sind, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten spürbar57 zu beeinträchtigen.
33
Vereinbarungen, die gegen Art. 101 Abs. 1 AEUV verstoßen, ohne dass die Voraussetzungen der Legalausnahme gemäß Art. 101 Abs. 3 AEUV erfüllt sind, sind gemäß Art. 101 Abs. 2 AEUV nichtig und können nach Art. 23 Abs. 2 lit. a VO Nr. 1/2003 von der Kommission bzw. von den nationalen Kartellbehörden der Mitgliedstaaten mit Bußgeldern bis zu 10% des weltweiten Konzernumsatzes der an der Vereinbarung beteiligten Unternehmen belegt werden.
34
Die Nichtigkeit nach Unionskartellrecht betrifft grundsätzlich nur die wettbewerbsbeschränkenden Klauseln.58 Das Schicksal der restlichen Vereinbarung bestimmt sich nach nationalem Recht. Gemäß § 139 BGB bewirkt eine nichtige wettbewerbsbeschränkende Klausel grundsätzlich die Gesamtnichtigkeit des Vertrages, es sei denn, aus dem Gesamtkontext des Vertrages ergäbe sich etwas anderes. Darlegungs- und beweispflichtig für die Wirksamkeit des Restvertrages ist also derjenige, der sich darauf beruft.59 Anders ist es allerdings dann, wenn der Vertrag eine salvatorische Klausel enthält. Eine solche Klausel kehrt die für die Anwendung von § 139 BGB maßgebliche Beweislast der Parteien um.60 Ist sie, wie oft üblich, als allgemeine Geschäftsbedingung vereinbart, trifft die Darlegungs- und Beweislast für die Gesamtnichtigkeit nach § 139 BGB diejenige Partei, die sich entgegen der Erhaltungsklausel auf die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages beruft.61
35
Art. 101 Abs. 3 AEUV sieht vor, dass von Art. 101 Abs. 1 AEUV erfasste Wettbewerbsbeschränkungen dann vom Kartellverbot ausgenommen und folglich wirksam durchsetzbar sind, wenn – wie die Kommission in ihren Leitlinien zur Anwendung von Art. 81 Abs. 3 EGV62 vereinfacht zusammenfasst – ihre wettbewerbsfördernden Auswirkungen bei einer „Nettobetrachtung“ die negativen Auswirkungen auf den Wettbewerb überwiegen.63 Dies ist der Fall, wenn die Parteien einer beschränkenden Vereinbarung nachweisen können, dass die folgenden vier Voraussetzungen des Art. 101 Abs. 3 AEUV vollständig erfüllt sind:
Die Wettbewerbsbeschränkungen dienen der Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung oder der Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts.
Die Verbraucher werden am Gewinn angemessen beteiligt.
Die Wettbewerbsbeschränkungen sind für die Verwirklichung dieser Ziele unerlässlich.
Die Vereinbarung eröffnet den Parteien nicht die Möglichkeit, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb auszuschalten.
36
Die Vertikal-GVO 1999, die noch unter dem früheren Anmelde- und Einzelfreistellungssystem des EG-Kartellrechts in Kraft getreten war, hat bis zur Ablösung durch die jetzige Vertikal-GVO bereits sechs Jahre im Rahmen des Systems der Legalausnahme nach VO Nr. 1/2003 funktioniert, wonach die Rechtsanwender selbst nachweisen müssen, dass die vereinbarten beschränkenden Klauseln die oben aufgeführten Voraussetzungen des Art. 101 Abs. 3 AEUV erfüllen. Dieses seit der Modernisierung des europäischen Kartellrechts im Jahre 2004 für alle Gruppenfreistellungsverordnungen geltende System ist mit der 7. GWB-Novelle im Juli 2005 auch für das deutsche Recht übernommen worden. Die Selbsteinschätzung im Rahmen der Legalausnahme setzt nicht selten eine umfassende ökonomische Analyse des jeweiligen Markt- und Wettbewerbsumfelds seitens der an der Vereinbarung beteiligten Unternehmen voraus.
37
Gruppenfreistellungsverordnungen haben vor dem Hintergrund des vor mehr als 20 Jahren „modernisierten“ EU-Kartellrechts mit seiner automatischen Freistellung im Rahmen der Legalausnahme zwar in der Theorie an rechtlicher Relevanz verloren, in der Praxis aber nichts von ihrer Bedeutung eingebüßt, sondern sind in ihrer Bedeutung sogar noch gestiegen: Bei der erforderlichen Selbsteinschätzung kommt den Gruppenfreistellungsverordnungen die zentrale Rolle eines sicheren Hafens (safe harbour) zu. Ist eine beschränkende Vereinbarung durch eine Gruppenfreistellungsverordnung erfasst, sind die Parteien von ihrer Verpflichtung nach Art. 2 VO Nr. 1/2003 entbunden nachzuweisen, dass ihre Vereinbarung sämtliche Voraussetzungen des Art. 101 Abs. 3 AEUV erfüllt. Sie müssen lediglich beweisen, dass die Vereinbarung unter die jeweilige Gruppenfreistellungsverordnung fällt. Der Anwendung von Art. 101 Abs. 3 AEUV liegt dabei die Annahme zugrunde, dass die von einer Gruppenfreistellungsverordnung erfassten Vereinbarungen die vier Voraussetzungen des Art. 101 Abs. 3 AEUV mit hinreichender Wahrscheinlichkeit erfüllen.64 In der Praxis bleibt es folglich das primäre Ziel der auf die Wirksamkeit der Vereinbarung angewiesenen Unternehmen, statt einer immer mit Risiken und höheren Kosten behafteten individuellen Selbsteinschätzung, eine automatische Freistellung vom Kartellverbot zu erlangen, indem sie ihre Vereinbarung entsprechend den Voraussetzungen einer Gruppenfreistellungsverordnung gestalten.
38
Die Vertikal-GVO verkörpert, wie die Gruppenfreistellungsverordnungen für vertikale Vereinbarungen im Kfz-Bereich (Kfz-GVO sowie zuvor Kfz-GVO 2002),65 die zum 1. Juni 2023 reformierte F&E-GVO66 bzw. Spezialisierungs- GVO67 sowie die derzeit überarbeitete, noch68 aktuelle TT-GVO69 den modernen Regelungsansatz der sogenannten „Schirm-Technik“. Die Vertikal-GVO 1999 war die erste Gruppenfreistellungsverordnung, die den damals noch herrschenden legalistischen Ansatz („Was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten“) zugunsten des neuen, liberalen Ansatzes („Was nicht ausdrücklich verboten ist, ist erlaubt“) aufgegeben hat. Nach der Vertikal-GVO sind unterhalb der Marktanteilsschwelle von 30% für Anbieter und Abnehmer im sachlichen Anwendungsbereich der Vertikal-GVO alle wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen freigestellt, die nicht explizit als unzulässig bzw. als nicht freigestellt aufgeführt sind.
39
Die Vertikal-GVO stellt also nicht fest, welche Wettbewerbsbeschränkungen im Vertikalverhältnis zulässig sind, sondern nennt in Art. 4 sogenannte schwerwiegende Wettbewerbsbeschränkungen („Kernbeschränkungen“, auch als „schwarze Klauseln“ bezeichnet), die sämtlichen wettbewerbsbeschränkenden Klauselnder Vereinbarung das Privileg einer Freistellung nach der Vertikal-GVO nehmen.70 Zudem listet die Vertikal-GVO in Art. 5 „nicht-freigestellte“ Beschränkungen, deren Aufnahme in eine Vereinbarung allein die betroffene Klausel von einer automatischen Freistellung nach der Vertikal-GVO ausnimmt.71
40
In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass der EuGH zwar das letzte Wort zu Art. 101 Abs. 1 AEUV und auch zur Legalausnahme nach Art. 101 Abs. 3 AEUV hat und dass der EuGH auch über die richtige Anwendung der Vertikal- GVO befinden kann; was der EuGH aber nicht kann und was gegen die Zuständigkeitsverteilung innerhalb der Europäischen Union verstoßen würde, ist, den Inhalt der Vertikal-GVO zu verändern.72 Die Gruppenfreistellungsverordnungen sind alleiniges Hoheitsgebiet der Kommission.73 Insgesamt ist deshalb eine sehr formale Betrachtung der Vertikal-GVO angesagt: Wer sich in der heutigen Zeit manchmal fragt, ob eigentlich noch der Gesetzgeber den rechtlichen Rahmen für das Zusammenleben vorgibt oder ob das über Sinn-und-Zweck-Überlegungen nicht schon die Rechtsprechung tut, wird sich im Anwendungsbereich der Vertikal-GVO wohlfühlen: Denn wer dort mit Sinn und Zweck argumentiert, ist mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem Holzweg. Zumindest hat er die soeben beschriebene Stellung der Vertikal-GVO im System des Vertragskartellrechts noch nicht ausreichend verinnerlicht.
41
Aus diesem Verständnis der Vertikal-GVO folgt auch ein besseres Verständnis der Rechtsnatur der Leitlinien. Bei diesen handelt es sich keineswegs um die Gerichte nicht bindende Aussagen einer Behörde.74 Durchweg wird anerkannt,dass die Leitlinien eine Selbstbindung der Kommission bewirken. Zum Teil wird zusätzlich darauf verwiesen, dass die Leitlinien für nationale Wettbewerbsbehörden und Gerichte wegen des Ziels der Rechtsvereinheitlichung innerhalb der EU ein wichtiges Auslegungskriterium seien.75