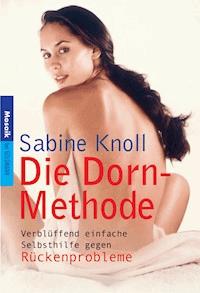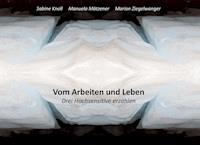
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Drei in einem: drei Autorinnen, drei Zugänge, drei Geschichten. Sabine Knoll, Manuela Mätzener und Marion Ziegelwanger, alle selbst hochsensitiv, erzählen in diesem Buch aus ihrem Erleben im Allgemeinen und aus dem Berufsleben im Besonderen. Aus Sicht der Freiberuflerin, der Unternehmerin und der Angestellten auf dem Sprung in die Selbstständigkeit schildern sie die Gaben von HSP (Hochsensitiven/Hochsensiblen Personen), ohne die Herausforderungen zu verschweigen. HSP nehmen Sinneseindrücke detaillierter wahr und verarbeiten sie auch tiefgehender, was zu Reizüberflutung führen kann. Sie empfinden sehr intensiv und haben zum Teil eine erweiterte Wahrnehmung für Energien und Übersinnliches. Das Wissen um ihre Veranlagung, die 15 bis 20 Prozent der Menschen teilen, ermöglicht ihnen, ihr Alltags- und Berufsleben ihren Fähigkeiten gemäß zu gestalten und Überstimulation zu vermeiden bzw. auszugleichen. In die drei Teile des Buches fließen Interviews mit mehr als 60 hochsensitiven Menschen aus allen Bereichen des Arbeitslebens ein. Ein Selbsttest mit Blick auf die Gaben von HSP sowie zahlreiche unterstützende Übungen machen dieses Buch zu einem positiven Begleiter für HSP im Alltagsleben und in der Arbeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sabine Knoll
Manuela Mätzener
Marion Ziegelwanger
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
Dieses Buch reifte in mir im Sommer 2014, als ich nach einer Operation vier Wochen in der Klinik Pirawarth auf Rehabilitation war. Einerseits lernte ich eine Vielzahl von wunderbaren – privat oder beruflich – verwundeten Menschen kennen, welche dort u. a. zur Burn-out-Prävention oder -Behandlung waren. Andererseits hatte ich im Rahmen meines Aufenthaltes einige Zeit, um über mich selbst, mein Leben, mein Unternehmen, mein Team und meine – zunehmend mehr – hochsensitiven Kunden und Kundinnen nachzudenken.
Deshalb fragte ich zunächst Mag. Sabine Knoll, die Gründerin des „hochsensitiv.netzwerk von hsp für hsp“, was sie von meiner Idee, ein Buch über das Thema „Hochsensitivität im Arbeitskontext“ zu schreiben, halten würde. Dabei betonte ich, dass es mir wichtig wäre, das Thema ausschließlich positiv zu behandeln, da ich kein weiteres Buch über das Stigma Hochsensitivität herausgeben wollte. Sie sagte zu und so trafen wir uns nach meiner Reha zu einem ersten Gedankenaustausch dazu.
Da ich nahezu all meinen Büchern qualitative Interviews zugrunde lege, holte ich – die ebenfalls hochsensitive – Expertin für Storytelling Mag. Marion Ziegelwanger ins Boot. Gemeinsam erarbeiteten wir das Buchkonzept und einen standardisierten Fragebogen. Von Oktober 2014 bis März 2015 führten wir sehr ambitioniert die 67 Interviews durch und teilten uns die Analyse auf die Berufsgruppen Künstler/-innen und Freiberufler/-innen, Angestellte und Arbeitslose sowie Unternehmer/-innen auf.
Während des Schreibprozesses veränderte sich durch einen Traum von Marion Ziegelwanger das Buchkonzept in die nun vorliegende Richtung, nämlich über unsere eigenen Lebensgeschichten zu schreiben; so verschob sich die geplante Fertigstellung letztlich um ein Jahr.
Das vorliegende Buch soll Ihnen mehr Hintergründe zum Thema Hochsensitivität bieten und Ihnen somit die Selbsteinschätzung auf die Frage „Bin ich eine HSP?“ erleichtern. Es erhebt keinerlei wissenschaftlichen Anspruch, wenngleich wir bestehende Literatur erwähnt und im Anhang im Literaturverzeichnis angeführt haben. In diesem Buch erzählen drei sehr unterschiedliche Menschen von ihrem Leben und Arbeiten als Hochsensitive. Das Geschriebene ist also subjektiv gefärbt, auch wenn es Gleichgesinnte in anonymisierten Interviewten sucht und findet.
Die gemeinsame Intention von uns dreien war es, vor allem die Stärken von Hochsensitiven zu beleuchten, selbst wenn – oder gerade weil – auch wir schwierige Lebens- und Arbeitssituationen erfolgreich gemeistert haben. Wir haben die Gewissheit, dass es sich bei Hochsensitivität um eine Gabe handelt, die „(aus)gelebt“ werden will. Darum enthält das Buch auch praktische Übungen für das eigene Leben.
Mögen Sie sich selbst oder Menschen, die Sie kennen, in unseren Zeilen wiederfinden und den einen oder anderen hilfreichen Gedanken herauspicken. Mögen Sie Orientierung für den eigenen beruflichen Weg als Freiberufler/-in, Selbstständige/-r und Angestellte/-r finden.
Manuela Mätzener für das Autorentrio Kreta, im August 2016
Hochsensitive Freiberufler/-innen Sabine Knoll
Hochsensitiv – ahaaa!
Ich war ein introvertiertes Kind. Manche dachten, ich könnte nicht sprechen, obwohl ich bei vertrauten Menschen durchaus sprudeln konnte. In meiner Schulzeit hielten mich Klassenkolleginnen für arrogant, bis sie mich besser kannten. Ich war immer eine gute Schülerin, fleißig und gewissenhaft. Heute weiß ich, das sind HSP-Eigenschaften.
HSP (Hochsensible/Hochsensitive Personen) nehmen über ihre Sinne (und Übersinne) mehr wahr als der Großteil der Menschen. Sie empfinden tiefer, verarbeiten Eindrücke detaillierter, sind die Perfektionist(inn)en und Anwälte der Schwachen, Hilfsbedürftigen. Sie haben ein ethisch tiefes Empfinden, spüren viel von anderen, Stimmungen und Raumenergien können sie intensiver fühlen als viele andere Menschen.
Es stimmt, ich habe ein Sensorium für dicke Luft und empfange Gedanken von anderen oft telepathisch. Ich war schon als Kind und Jugendliche ein Medium für außersinnliche Erfahrungen. Als Kind in der
Nacht um die Decke zu fliegen und übers Hausdach hinaus war für mich völlig normal, obwohl ich von Astralreisen damals noch keine Ahnung hatte. Ich konnte Pendeln und mit Geistwesen kommunizieren, bis ich Angst davor bekam und es eine Weile wieder sein ließ. Viele Hochsensitive sind übersinnlich veranlagt, aber nicht alle HSP sind medial oder leben diese Veranlagung.
Unsere Interviewpartner/-innen beschreiben ihre Hochsensitivität so:
„Absolut starke Sinneseindrücke in allen Bereichen. Ich sehe Kleinigkeiten, Besonderheiten. Wenn ich das sage, merke ich, dass die anderen es nicht sehen. Ich denke viel nach – als Kind soll ich gesagt haben: Warum heißt es nicht vordenken? – Bei mir ist viel Vordenken – bevor ich etwas sage, sind viele Schritte im Kopf schon abgehandelt – und viel Nachdenken auch.“
„Die Wahrnehmung von Vielschichtigkeit, von mehreren Ebenen und Perspektiven. Es gibt auch viele Phasen, in denen ich nur mit mir bin. In meinem Elternhaus habe ich deshalb oft gehört: Du ziehst dich so zurück, das ist gefährlich, du bist ein Eigenbrötler. Kommunikation ist manchmal für mich anstrengend – so verstanden zu werden, wie ich es gemeint habe.“
„Ich habe das Gefühl gehabt, in der falschen Zeit geboren zu sein und mit dem, wie die Welt gerade ist, gar nicht zurande zu kommen, weil die Welt so brutal ist und rau. Und ich halte Lärm ganz schlecht aus. Ich war zum Beispiel nur zwei Mal in einer Diskothek. Die Vibrationen sind mir zu viel. Auch im Café ist es mir zu viel, Musik und Stimmen.“
„Ich vertrage zu viele Menschen nicht. Auch wenn die Beleuchtung überhandnimmt, wie in einem Einkaufszentrum, das ist unerträglich.“
Den Begriff „Highly Sensitive Person (HSP)“ prägte 1996 die amerikanische Psychologin und Psychotherapeutin Elaine N. Aron in ihrem Buch „The Highly Sensitive Person – How To Thrive When the World Overwhelms You“ (Titel der deutschen Ausgabe: „Sind Sie hochsensibel? Wie Sie Ihre Empfindsamkeit erkennen, verstehen und nutzen“). Gemeinsam mit ihrem Mann Arthur Aron erforscht sie intensiv seit 1991 diese Veranlagung unter anderem mithilfe der Magnetresonanztomografie, die Vorgänge im Gehirn sichtbar macht. Diese Forschungen ergaben: 15 bis 20 Prozent der Menschen (und Tiere) sind – unabhängig von ihrer Kultur und ihrem Geschlecht – offener für Reize, haben also eine geringere Reizschwelle, filtern weniger Eindrücke aus. Der Thalamus, der größte Teil des Zwischenhirns, stuft bei HSP mehr Reize als wichtig ein, es handelt sich also tatsächlich um ein Phänomen des Nervensystems.
Elaine N. Aron nennt in ihren neueren Arbeiten vier Indikatoren, die bei HSP zusammentreffen, und beschreibt sie mit der Abkürzung DOES: Depth of Processing (Verarbeitungstiefe), Overarousability (Übererregbarkeit), Emotional Intensity (Emotionale Intensität) und Sensory Sensibility (Sinnessensibilität). Die Sensibilität der fünf Sinne und Empfindungen aus dem Körper ist für Aron nicht die Kerncharakteristik von Hochsensitivität, sondern die sensitive Reizverarbeitung. Sie stellte fest, dass HSP Gedanken und Gefühle intensiver und vernetzter verarbeiten als Nicht-HSP und dadurch auch sehr intuitiv veranlagt sind. HSP lösen komplexe Wahrnehmungsaufgaben leichter aufgrund ihrer schnellen Auffassungsgabe. Sie sinnieren oft tiefgründig über Gott und die Welt und sind häufig spirituelle Menschen.
Die Sinnesinformationen, Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen sind bei HSP sehr ausgeprägt. Sie empfangen eine Vielzahl an körperlichen, geistigen, emotionalen und seelischen Eindrücken.
Auf Deutsch wird die Bezeichnung HSP sowohl als Hochsensible Person als auch als Hochsensitive Person übersetzt. Nachdem es um die Reizoffenheit der Sinne geht und sich der Begriff von „high sensory processing sensitivity“ ableitet, der menschlichen Sensitivität für sensorische Verarbeitungsprozesse, finde ich die Übersetzung „hochsensitiv“ passender. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen die „Senses“, die Sinne, nicht das „Sensibelchen“, das manchmal mitschwingt. Deutsche Autorinnen differenzieren in letzter Zeit gerne und verstehen unter Hochsensibilität die Empfindlichkeit der fünf Sinne, unter Hochsensitivität die Empfänglichkeit der Übersinne (Empathie, Intuition, Fühligkeit für Energien, bis zu medialen Wahrnehmungen). Eine Unterscheidung, die Elaine N. Aron selbst nicht getroffen hat. Auch die Verquickung mit dem Thema Hochbegabung stammt nicht von ihr.
Nichtsdestotrotz können Hochsensitive in manchen Bereichen überdurchschnittlich begabt sein. Es geht dabei nicht um einen besonders hohen IQ, sondern häufig um emotionale und soziale Intelligenz oder kreative Begabungen.
Auch unsere freiberuflichen Interviewpartner/-innen haben derartige Gaben:
„Ich sehe viel und kann es auch ausdrücken – mit Reden und künstlerisch. Die Kunst ist ein Ventil, Philosophisches und Poetisches wird ebenfalls darin ausgedrückt. Zwischenmenschlich, in der Familie, bin ich die Harmonisiererin. In Gremien kann ich etwas auf den Punkt bringen und vertiefen.“
„Ich sehe Bilder, wenn ich Kleider entwerfe. Die Menschen erzählen mir. Sie sprechen nie von Kleidern, sondern von Lebensumständen. Ich höre zu. Und ich brauche dann nur die Kleider aufzuzeichnen. Wenn ich eine Kollektion entwerfen will, dann stelle ich mir mich als Gefäß vor und ‚pluff‘ – da ist sie.“
„Ich kann die Gedanken und Emotionen von anderen auf- und wahrnehmen und Ereignisse bei anderen vorhersehen. Es ist, als würde ich in den anderen Körper hineinsteigen.“
„Ich stamme aus einer Druidenfamilie. Bei uns war immer alles sehr mystisch. Das habe ich von meinen Großeltern mitgekriegt. Die ganze Familie beschäftigte sich seit 300 Jahren mit diesen Sachen, mit Heilen und Handauflegen. Ich habe das schon als Kind gemacht. Das Handauflegen bis heute.“
Auch Birgit Trappmann-Korr, eine deutsche Sozialpsychologin, stellt in ihrer Arbeit mit HSP häufig ein Zusammentreffen von Hochsensitivität und Hochbegabung fest und schätzt, dass etwa 10 Prozent der Bevölkerung hochbegabte HSP sind. Hochbegabte zeigen ebenfalls eine hohe Erregbarkeit, sowohl intellektuell (sie machen sich früh Gedanken über Ethik, Moral, Spiritualität etc.) als auch kreativ (sie sind sehr fantasiebegabt, imaginativ, visionär), emotional (sie sind sensibel, empathisch, mitfühlend), psychomotorisch (sie haben das Bedürfnis, zu handeln, sind sehr energetisch und aktiv) und sensorisch (sie nehmen Gesehenes, Gehörtes, Gerüche, Geschmack, Gefühle und Berührungen intensiver wahr).
Birgit Trappmann-Korr macht Hochbegabung nicht an den klassischen IQ-Tests fest, bei denen HSP durch ihre Übererregtheit unter Leistungs- und Zeitdruck häufig schlechter als erwartet abschneiden. Bei diesen Tests wird Intelligenz an kognitiven Fähigkeiten festgemacht, zum Beispiel Verstehen, Wissen, Logik, Sprache und Problemlösung. Unter Hochbegabung versteht man jedoch eine überdurchschnittliche Begabung in einem Bereich, ein besonderes Talent. Das kann im kreativen, aber auch im sportlichen Bereich etc. sein. Auch andere Arten der Intelligenz, wie soziale und emotionale Intelligenz oder eine ausgeprägte Intuition, zählen dazu.
Eine Form der Hochbegabung weisen auch die sogenannten Scanner auf. Sie sind vielseitig interessiert und begabt, häufig Multitalente mit „unstetem Lebenslauf“, da sie sich schwer entscheiden können, welchem ihrer Talente sie ausschließlich folgen wollen. So leben sie meist mit mehreren Standbeinen und probieren vieles aus. Sie sind nichts für Routineaufgaben und sind sie gerade der Meinung, sie müssten sich spezialisieren und dafür einige Türen schließen, gehen wieder neue auf. Ich kenne das gut aus meinem Leben und schätze die Vielfalt mittlerweile als eine wertvolle Qualität. Um mich mit der Flut der Ideen, die förmlich aus mir heraussprudeln, nicht zu überfordern und zu stressen, habe ich mir mittlerweile selbst die Erlaubnis gegeben, nicht alle Ideen auch immer umsetzen zu müssen.
Hochsensitive sind in der Regel ganzheitlicher in ihrer Wahrnehmung als Nicht-HSP, verfügen über vernetztes Denken, haben den Blick für die größeren Zusammenhänge. Sie denken nicht vorwiegend analytisch („linkshirnig“), sondern auch kreativ („rechtshirnig“). Das unterscheidet hochsensitive Kinder von Kindern mit ADS oder ADHS. Hochsensitivität wird manchmal mit dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom verwechselt. Birgit Trappmann-Korr beschäftigt sich mit dieser Abgrenzung ebenfalls in ihrem Buch „Hochsensitiv: Einfach anders und trotzdem ganz normal“. Symptome der Unaufmerksamkeit sind unter anderem Flüchtigkeitsfehler, Konzentrationsprobleme, Zerstreutheit, Verträumtheit, Desorganisiertheit, Vergesslichkeit, Sensibilität, Probleme mit Routineaufgaben, wenig Selbstbewusstsein. Emotionale Schwankungen, gereizte Stimmungen, verminderte emotionale Belastbarkeit, Depressionen und Angststörungen etc. sind weitere Kennzeichen des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms.
Die Reizoffenheit und ihre Auswirkungen haben Menschen mit ADS/ADHS gemeinsam mit HSP. Schaut man jedoch näher hin und vergleicht man den Wahrnehmungs- und Denkstil bei ADS/ADHS und bei Hochsensitivität, fällt auf, dass Menschen mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom einen analytischen und Hochsensitive einen holistischen (ganzheitlichen) Wahrnehmungs- und Denkstil haben.
Der deutsche Psychotherapeut, Coach und Gründer des HSP-Instituts Stuttgart, Rolf Sellin, sieht verschiedene mögliche Ursachen für eine Aufmerksamkeitsdefizit-Störung im Alltag. Dazu zählen eine Überreizung durch Medienkonsum, Unverträglichkeiten von künstlichen Zusatzstoffen in Lebensmitteln, hoher Zuckerkonsum, aber auch systemische Verstrickungen in der Familie und hirnorganische Ursachen. Seiner Erfahrung nach werden einige Hochsensitive auch immer wieder fälschlicherweise mit anderen Diagnosen konfrontiert, zum Beispiel Neurosen, Depressionen und Angststörungen, emotionale Instabilität, Co-Abhängigkeit, Süchte, Autismus und Borderline-Persönlichkeitsstörung.
Hochsensitivität ist keine Störung und keine Erkrankung, sondern eine Veranlagung, die laut Elaine N. Aron angeboren ist. Sie stützt sich dabei vor allem auf Studien mit eineiigen Zwillingen, die zwar getrennt aufwuchsen, aber ähnliche Verhaltensmuster zeigten. Daraus schloss sie, dass das Verhalten zumindest zum Teil genetisch bedingt ist. Bei intensiven Reizen entsteht in Hochsensitiven eine hochgradige Erregung des Nervensystems bis zur sogenannten „transmarginalen Hemmung“ (eine Schutzfunktion des Körpers, der ihn vor Überstimulation bewahren soll). Diese wurde schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts vom russischen Physiologen Iwan Pawlow beschrieben. Er meinte, der grundlegendste vererbbare Unterschied zwischen Menschen bestünde darin, wie schnell diese Schwelle erreicht würde, und dass das Nervensystem jener, die sie schnell erreichten, ganz anders funktioniere als bei Menschen, die sie langsam erreichen. Der Unterschied liegt auf dem Weg zwischen Nerv und Gehirn oder im Gehirn selbst, in der Verarbeitung von Informationen, stellte Aron fest.
Bei HSP ist das Wahrnehmungssystem weit geöffnet und häufig auch die energetische Wahrnehmung sehr geschärft. Andere Menschen trainieren in Meditationen und Ausbildungen, um diesen Zustand zu erreichen, der in HSP natürlich angelegt ist und unter dem sie auch immer wieder leiden, wenn zu viele Reize auf sie einströmen. Was von manchen gerne pathologisiert wird. Die Frage ist nur: Was ist unnatürlicher? Die laute Welt da draußen mit ihrer ständigen Reizüberflutung oder die Wahrnehmung einer hochsensitiven Person? In einer natürlichen Umgebung, im Wald, am Wasser, bei Vogelgezwitscher oder Meeresrauschen sind wir nicht reizüberflutet, sondern aufgetankt mit Energie.
Einsiedler haben sich in ihre Höhle, Einsiedelei zurückgezogen, um die Verbindung mit dem Göttlichen deutlicher wahrzunehmen. Genauso brauchen HSP von Zeit zu Zeit ihre „Höhle“, um der Reizüberflutung der äußeren Welt zum Beispiel in Städten etwas entgegenzusetzen und wieder aufzutanken. Das ist kein Plädoyer dafür, sich völlig vom urbanen gesellschaftlichen Leben zurückzuziehen oder abzuschotten, es kommt nur aufs richtige Maß an und auf das Wissen um Möglichkeiten und Methoden, die uns dabei unterstützen, Reizüberflutung abzubauen. (Mehr dazu auf den folgenden Seiten und in den Übungen sowie Tipps in diesem Buch.)
In puncto Reizüberflutung können jedoch nicht nur äußere Reize, sondern auch innere Reize wie starke Emotionen und die bei HSP sehr reiche Innenwelt mitspielen. Bei allen Hochsensitiven spielt die Gefühls- und Empfindungswelt eine sehr große Rolle. Im Gehirn von HSP wird das Emotionsbeziehungsweise Empfindungssystem offenbar leichter aktiviert.
Faktoren zur Selbsteinschätzung
Im Zuge ihrer HSP-Forschung führte Elaine N. Aron eine Studie mittels einer Telefonumfrage unter 300 zufällig ausgewählten Personen aller Altersgruppen durch, die im Laufe der weiteren Forschungsarbeit durch mehr als 1000 zusätzliche Gespräche mit HSP ergänzt wurde. Das Ergebnis: 20 Prozent der Befragten schätzten sich auf einer Skala von eins bis fünf als extrem oder ziemlich sensibel ein. 27 Prozent hielten sich für mäßig sensibel. Dann gab es einen radikalen Bruch. Acht Prozent sagten, sie seien nicht sensibel und 42 Prozent hielten sich für überhaupt nicht sensibel. Kein Wunder, dass HSP sich häufig wie eine eigene Spezies fühlen – sie sind es wahrscheinlich auch. Arons im Buch veröffentlichter Test zur Selbsteinschätzung enthält 23 Fragen, die Beantwortung von 12 und mehr mit „Ja“ lässt einen Schluss auf die Hochsensitivität zu (auch weniger Ja-Antworten, wenn die erwähnten Kennzeichen umso stärker zutreffen).
Faktoren zur Feststellung der Hochsensitivität sind in diesem Zusammenhang: Feinheiten um sich herum wahrnehmen, ein reiches und komplexes Innenleben, durch laute Geräusche ein Unwohlsein empfinden, zu Schmerzempfindlichkeit und/oder Schreckhaftigkeit neigen, sehr gewissenhaft sein, bei vielen Eindrücken schnell gereizt und unter Zeitdruck fahrig reagieren, durch helles Licht sowie unangenehme Gerüche und kratzige Stoffe beeinträchtigt werden, Hunger gepaart mit Unkonzentriertheit und schlechter Laune empfinden, als Kind sensibel und schüchtern gewirkt haben etc. Hochsensitive reagieren stärker auf Genussmittel (zum Beispiel Kaffee und Alkohol) und andere Nahrungsinhaltsstoffe, können von Musik und Kunst tief bewegt sein und intensiv genießen. Sie haben ein großes Gerechtigkeitsempfinden und Harmoniebedürfnis, sind sehr reflektiert und ernsthaft, häufig spirituell, können von der Vielfalt an äußeren und inneren Eindrücken und Gefühlen aber auch überflutet werden. Häufig reicht die Dauerberieselung mit Musik, das Ticken von Uhren oder das stundenlange Rauschen eines Computers, um ein Gefühl der Überreiztheit bei HSP auszulösen. – Manchen HSP ist der Test zu problemzentriert und zu negativ formuliert. Wir haben auf Basis des Aron-Tests einen positiv formulierten Selbsttest entwickelt, der im Anhang zu finden ist.
Menschen in außerordentlichen Belastungssituationen können auch hochsensitiv reagieren, ohne eine hochsensitive Veranlagung zu haben. Wenn man sich permanent an der Grenze zur Erschöpfung bewegt und immer nur den „Reservetank“ wieder auftankt, wird auch recht schnell alles zu viel. Hilfreich zur Feststellung, ob man tatsächlich eine HSP ist, kann es sein, die Fragen im Selbsttest mit dem Blick auf die Vergangenheit und Kindheit noch einmal zu beantworten. Wie war das früher? Kenne ich das schon länger?
70 Prozent der Hochsensitiven sind introvertiert, 30 Prozent extrovertiert. Das entdeckte Elaine N. Aron in ihren Studien. Sozial extrovertierte HSP haben einen großen Freundeskreis und finden Gefallen an Gruppen sowie fremden Menschen. Der Unterschied zu anderen Extrovertierten: Nach übererregenden Reizen wie etwa einem langen Arbeitstag oder viel Zeit in der belebten Innenstadt meiden extrovertierte HSP gerne den Kontakt. Extrovertierte Nicht-HSP entspannen besser in Gesellschaft von anderen Menschen.
Besonders anstrengend kann das Leben für HSP werden, wenn sie obendrein das sind, was Marvin Zuckerman „High Sensation Seeker (HSS)“ nannte. Sie suchen dann nämlich nach Abwechslung und neuen, komplexen, starken Eindrücken und Erfahrungen. Dafür sind sie auch bereit, Risiken einzugehen. Studien haben ergeben, dass auch hier ein Einfluss der Gene vorhanden ist. Diese Unterschiede zeigen sich bereits in den ersten Lebenstagen durch eine hohe Aktivität bei Säuglingen, die HSS sind. Ein Selbsttest für Sensation Seekers findet sich in Elaine N. Arons Buch „Hochsensibilität in der Liebe. Wie Ihre Empfindsamkeit die Partnerschaft bereichern kann“.
Elaine N. Aron macht sowohl die Veranlagung von HSP als auch von HSS an Vorgängen im Gehirn fest. Das sogenannte Verhaltenshemmsystem (Behavioral Inhibition System) – oder Achtsamkeitssystem, wie Aron es nennt – hilft, Situationen einzuschätzen und mit der Vergangenheit zu vergleichen, um adäquate Handlungsmöglichkeiten zu finden. HSP haben offenbar ein starkes Achtsamkeitssystem. Das dürfte die Ursache für ihre oft langen und gründlichen Überlegungen sein.
Das Verhaltensaktivierungssystem (Behavioral Activation System) macht Menschen neugierig, Lust darauf, etwas zu erforschen, und gespannt auf die Belohnung. Die daran beteiligten Bereiche des Gehirns und der dafür wesentliche Neurotransmitter Dopamin sind deutlich getrennt von den Gehirnregionen, die für das Achtsamkeitssystem zuständig sind. Der wichtigste Neurotransmitter des Achtsamkeitssystems ist das Serotonin. Bei HSS arbeitet vor allem das Verhaltensaktivierungssystem auf Hochtouren. HSP, die auch HSS sind, können sich zwischen diesen beiden Systemen innerlich hin-und hergerissen fühlen.
Über- und Unterstimulierung können bei HSP näher beieinanderliegen als bei weniger sensitiven Menschen. Sehr starke Schwankungen diesbezüglich erleben HSP, die zugleich High Sensation Seekers sind. Einerseits vertragen sie weniger Reize, andererseits können ihnen die Reize manchmal nicht stark genug sein. Sie suchen auch oft Herausforderungen und gehen gerne Risiken ein, sie lieben Kampf und Wettbewerb, was für HSP sonst eher untypisch ist.
HSP/HSS sind also risikobereiter als HSP/Nicht-HSS, jedoch weniger risikobereit als Nicht-HSP/HSS. Letztere neigen laut Aron außerdem weniger zum Innehalten und eine Situation überdenken, was typisch für HSP ist. HSP/Nicht-HSS sind nachdenkliche, nicht impulsive Menschen mit wenig Lust auf Risiken. Die High Sensation Seekers unter den HSP paaren Weitsicht meist mit Tatendrang. Sie können leicht überfordert und ebenso schnell gelangweilt sein. Sie finden sich in inneren Konflikten wieder, weil sie neue Erfahrungen machen wollen, jedoch trotzdem keine großen Risiken eingehen oder Überstimulation hinnehmen möchten. HSP/HSS haben oft das Gefühl, mit einem Fuß auf dem Gaspedal und mit dem anderen auf der Bremse zu stehen. Kein Wunder, dass da der Motor zuweilen aufheult. HSP/HSS sind besonders gefordert, die richtige Balance zwischen Anregung und Entspannung zu finden – für HSP generell ein zentrales Lebensthema.
HSP in Partnerschaften – privat und beruflich
Die unterschiedlichen Veranlagungen und Temperamente – HSP/Nicht-HSS, HSP/HSS, Nicht-HSP/ Nicht-HSS, Nicht-HSP/HSS – ergeben eine Vielfalt an möglichen Beziehungskonstellationen mit spezifischen Gemeinsamkeiten, aber auch Herausforderungen, sowohl privat als auch beruflich. Ähnlich veranlagte Partner/-innen freuen sich über das Verständnis, die Gemeinsamkeiten und das Verbindende, unterschiedlich Veranlagte genießen oft das Ergänzende, leiden aber auch darunter, sich nicht verstanden zu fühlen. HSP/HSS mit HSP/Nicht-HSS als Partner lassen den anderen meist seinen HSP-Anteil ungehindert ausleben. Ein hochsensitiver Partner, der kein HSS ist, kann wiederum den inneren Konflikt eines HSP/HSS verringern. Das kann auch auf Arbeitskolleg(inn)en, Firmen- und Geschäftspartner/-innen zutreffen. Partnerschaften, die sich aus einem HSP/Nicht-HSS und einem Nicht-HSP/HSS zusammensetzen, haben mit mehr Schwierigkeiten zu kämpfen als jene, die aus einem HSP/HSS und einem Nicht-HSP/HSS bestehen.
Selbst wenn man die Veranlagung High Sensation Seeker weglässt, ergeben sich sowohl in den Partnerschaften von HSP mit HSP als auch HSP mit Nicht-HSP zahlreiche häufig auftretende unterstützende ebenso wie herausfordernde Aspekte:
HSP mit HSP – mögliche Vorteile einer Partnerschaft/Zusammenarbeit von zwei Hochsensitiven:
Gleichklang und Gemeinsamkeiten, Gefühl von „verwandten Seelen“
ähnliche Art des Denkens und der Weltsicht (ethisches Empfinden)
gegenseitiges Verständnis, Rücksichtnahme, meist behutsamer Umgang
tiefgründige Gespräche und wortloses Verstehen
Wahrnehmung feiner Zwischentöne, Einfühlungsvermögen
Anerkennung und Wertschätzung
Auflösung von klassischen Rollenklischees
Unkonventionalität und Kreativität in der Lebens- und Arbeitsgestaltung
Mögliche Herausforderungen für Hochsensitive Partnerschaften:
Schwierigkeit, bei sich zu bleiben und sich abzugrenzen
Gefahr, sich von der Welt in eine „gemeinsame Sphäre“ zurückzuziehen
Einschränkungen durch Überempfindlichkeit in verschiedenen Bereichen
bei Überlastung und Überstimulation beider doppeltes Konfliktpotenzial
beidseitige Genervtheit durch besondere Anforderungen des Berufslebens
früher erreichte Belastbarkeitsgrenze
weniger Möglichkeiten, einander zu ergänzen
konfliktscheu, Flucht und Rückzug statt Klärung von Problemen
HSP mit Nicht-HSP – mögliche Vorteile dieser Partnerschaft/Zusammenarbeit:
Attraktivität der Verschiedenartigkeit
gegenseitige Ergänzung, Chance auf Arbeitsteilung
unterschiedliche Blickwinkel können bereichernd sein
Chance, voneinander zu lernen, Horizonterweiterung
Vielfalt durch verschiedene Ansätze bei Toleranz für die Andersartigkeit
Gefühl, sich als HSP in der materiellen Welt gut aufgehoben zu fühlen
Mögliche Herausforderungen für Partnerschaften von HSP und Nicht-HSP:
Unverständnis für emotionale Andersartigkeit
mangelnde Toleranz im Umgang mit Verschiedenheit
das Gefühl, aneinander vorbeizureden, einander nicht wirklich zu verstehen
Probleme durch unterschiedliche Empathie
Konfliktpotenzial durch unterschiedliche (auch emotionale) Stressresistenz
Belastungen durch verschiedenartiges Konfliktverhalten
HSP haben meist eine tiefe Sehnsucht nach Seelenverwandtschaft. Nicht-HSP ist dieser Anspruch manchmal zu hoch. Die Sehnsucht nach Einheit und Ganzheit kann auf Widerstand stoßen. Sie ist jedoch bei HSP vorhanden und will ausgelebt werden. HSP sind oft sehr spirituelle Menschen. Wenn sie ihre Spiritualität selbst voll und ganz leben und ihre Sehnsucht nach Harmonie und Vollkommenheit auf das Transzendente richten, entlasten sie ihre Partner/-innen. Sehnsucht nach Nähe und gleichzeitig Angst vor Verletzung, Selbstaufgabe und sich zu verlieren gehen häufig bei Hochsensitiven Hand in Hand. Gut bei sich zu sein und für seine Bedürfnisse einzutreten, kann diese Ängste lindern.
Hochsensitive Männer haben es in unserer Gesellschaft meist schwerer als Männer, die keine HSP sind. Sie entsprechen weniger dem Bild vom „Marlboro-Man“, das immer noch als das Bild eines „richtigen Mannes“ herumspukt. Der coole, starke, erfolgreiche Mann. HS-Männer sind hingegen sensibler, einfühlsamer, weicher, leben auch ihre „weiblichen“ (Yin-)Anteile. Eigenschaften, die nicht in allen Berufen und Firmen zählen.
Selbstverleugnung und einen Teil von sich auszublenden, rächen sich allerdings auf Dauer. Sie bedeuten Stress im Innersten, emotionalen Stress. Wenn die Flut der Reize innen und außen zu viel wird, fühlen sich HSP schnell erschöpft. „Festplatte voll“ bedeutet dann die Notwendigkeit, sich Zeit zum Verarbeiten und für den Rückzug zu nehmen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, aufzutanken, zu entspannen, in die Natur zu gehen – diese ist für HSP eine große Kraftquelle. Gehen Hochsensitive ständig über ihre Grenzen, kann es sein, dass gar nichts mehr geht – sie landen schneller als Nicht-HSP in einem Burn-out, wenn sie bei aller Pflichterfüllung oder beim Dasein für andere auf sich selbst vergessen. Ein Phänomen, das auch eine unserer Interviewpartnerinnen aus ihrem Leben kennt:
„Ich glaube, letztes Jahr war ich nah dran. Ich war am Ende. Was tust du für dich? Nichts. Was macht dir Freude? Da war nichts mehr. Ich habe erfahren, dass man – egal, was man selber kann – irgendwann an einen Punkt kommt, wo man externe Hilfe braucht. Sollte ich wieder eine Partnerschaft haben, werde ich darauf achten, einen eigenen (inneren) Raum zu haben, der mir guttut und der mir heilig ist.“