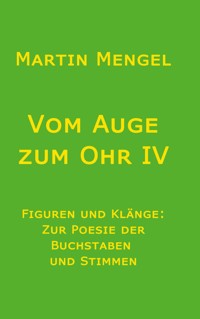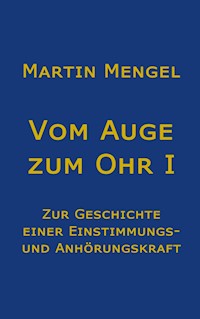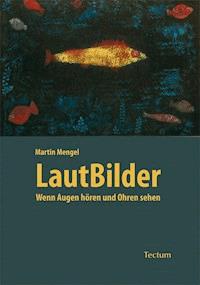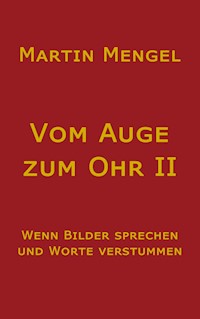
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Vom Auge zum Ohr
- Sprache: Deutsch
Die Welt im Bild: Ihr Fluß wird gestaut. Sie wird obligat, angebunden und festgestellt. Das Bild tut so, als ob es die Welt sei. Sie wird simuliert. Was jetzt und hier erscheint wird zum Maß für das, was war und sein wird. Die Zeit gerinnt Die Welt im Klang: Sie ruft aus ihren Bewegungen. Sie erhält Einlaß. Sie wird erhört. Mensch und Welt schwingen in Resonanzen. Sie sind gestimmt und stiften Stimmen. Es jubilieren die Zeiten in ihren Einstimmungen. In diesem Buch sollen Fragen gestellt werden. Fragen erhoffen sich Antworten. Bilder kennen keine Antworten. Für das Auge zählt nur das Sichtbare, Vorhandene. Hinter seinen Horizonten gähnt die Leere. Für das Ohr aber öffnen sich die Horizonte. Die Welt klingt und antwortet. Sie kann erhört werden. In den Blitzlichtgewittern werden die Augen mehr und mehr geblendet, die Ohren verstopft. Im grellen Licht der nach unablässiger Veränderung süchtigen Bilder gibt es nichts zu sehen. Im harten Beat der gehetzten Klänge nichts zu hören. Aber: An den Grenzen der Horizonte geht das Schweigen auf. Es käme darauf an, hier dem "Läuten der Dinge" (M. Heidegger) zu lauschen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meinen Bruder
Mein besonderer Dank gilt Rüdiger Richter
Inhaltsverzeichnis
Eine Vorschau
Vorwort
Der gesprengte Rahmen
A
Im Zimmer des Hörens
Sehflächen und Hörräume
Aisthesis und Akroasis
Träumend hören und sprechen
B
Ferdinand de Saussure
Parole und Langue
Lebendiges und vorgestelltes Sprechen
Ansteckende Abstraktionen
Fiktive Tatsachen
Paradigmen und Syntagmen
Ein verwirrender Taufakt
Exkurs
Von Einbildungen und Einstimmungen beim Erlernen des Lesens und Schreibens
Vorspiel
Thema mit Irritationen
Längeres Nachspiel
Monster und Mutanten
C
Ludwig Wittgenstein
Die Welt ist alles, was der Fall ist
Die Grenzen des Sprechens
Die Härte des „Du mußt“
Die symbolische Prägnanz des Sprechens
Der Mann auf dem Mond
Vom Fluß, der sein Bett verschiebt
Wahnsinn und Schule
D
Noam Chomsky
Die kalte Schönheit des idealen Sprechens
Perfomanzen und Kompetenzen
Spontaneität und Kalkül
Baumdiagramme und Lexikoneintragungen
Die K-Regel
Fazit
E
Jacques Lacan
Das Drängen des Buchstabens im Unbewußten
Metaphern und Metonymien
Le sens de la lettre
Le point de capiton
Das Feld des Sprechens
Narcissus und Echo
F
George Bataille
Die innere Erfahrung
Die Sprachspiele des Kindes
Spürbare Erfahrungen und logische Ersetzungen
Gelähmte Zungen
Souveränes Schweigen
George Bataille und Martin Heidegger
Nachwort
Verstopfte Ohren
Die musikalische Hölle
Kopfhörermenschen
Literaturverzeichnis
Eine Vorschau
Wenn Gott Menschen bildet. Wenn Menschen Maschinen bilden. Wenn Maschinen Menschen bilden.
(Gott-Mensch 1; Michelangelo, Die Erschaffung Adams, 1508-1512)
„Und Gott sprach: ‚Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das da kriechet auf Erden.‘ Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Weib.“(Die Bibel, 1. Mose, 26-27)
Wer ist hier im Plural gemeint und wird benannt? Ist Gott nicht All-Ein? Gilt nicht sein Satz: Hen ego kai panta? Wer leistet ihm Gesellschaft? Bei Michelangelo wird Gott von Engeln getragen.
(Michelangelo, Die Erschaffung Adams, 1508-1512, Detail)
Schöpfer und Bild-Geschöpf berühren sich nicht. Gilt hier schon der Satz „Noli me tangere“? Wer sagt diesen Satz? Der Schöpfer oder sein Geschöpf? Gott erschafft die Welt aus seinen Worten heraus. Im Imperativ: „Es werde Licht!“ Adam entsteht auch aus den Worten Gottes heraus. Und: Adam ist ein Bild, das demjenigen Gottes gleich ist. Zwei Bilder treten nebeneinander auf. Wo sind da die Körper? Bilder haben eine Fläche. Körper eine Haut. Die Fläche des einen Bildes kann die Fläche des anderen Bildes nicht berühren. Die Haut des einen Körpers kann die Haut des anderen Körpers berühren. Michelangelo stellt die Erschaffung des ersten Menschen dar, er bringt sie in ein Bild. Der göttliche und der menschliche Finger können sich nicht berühren. Bilder und Körper berühren sich nicht, sie kennen sich nicht.
(Gott-Mensch 2; Fra Angelico, Noli me tangere, um 1440)
„Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.“(Die Bibel, Das Evangelium nach Johannes, 1-3)
Das Wort Gottes erschafft sich ein Bild. Das Urbild, Gott, kann sein Ebenbild nicht berühren. Zwischen dem Finger des Schöpfers und dem seines Geschöpfs bleibt ein leerer Raum.
Das Wort ward Bild. Und das Bild ward Fleisch. Das Bild konnte als Fleisch nicht bestehen. Es starb, festgenagelt an einem Holzkreuz. Es kam wieder zurück aus dem Reich der Toten. Und diejenige, die es sah, Maria Magdalena, konnte es zunächst nicht erkennen. Und das Bild sprach sie mit ihrem Namen an: ‚Maria.‘ Und da erkannte sie das Bild, aus seinem Wort heraus, das ihr ihren Namen gab. Doch machte sich das Bild, das sprach, unnahbar: Im Imperativ wird jeglicher Wille, jegliches Sehnen nach Berührung ausgeschlossen. „Noli me tangere. Rühre mich nicht an.“ (Die Bibel, Das Evangelium nach Johannes, 20, 17).
Maria Magdalena lebt und hat einen Körper. Sie kann spüren, sie kann berühren. Ihr Körper hat eine Haut. Das Bild, das spricht, kann nicht berühren, kann nicht spüren. Es hat eine Fläche. Zwischen Körper und Bild darf und kann es keinen Kontakt geben. Noli me tangere.
(Mensch-Maschine 1; Raoul Hausmann, Mechanischer Kopf, 1919)
Kunstwerk, dreidimensional, starr, wirklich,die Macht des Kopfes, die Macht des Kapitals. Die Mechanik setzt die Eins, sie rechnet, mißt nach allen Seiten hin aus, vergleicht, sie kennt nur Mengen: wie groß? wie viel? Dimensionen…
(Mensch-Maschine 2; Filmszene aus „Metropolis“ von Fritz Lang; 1927)
Kunstwerk; zweidimensional; beweglich; fiktiv; mechanischer Prototyp, cyborg, Triebwerk, altgriechisch machaná, mechané, Werkzeug zum kriegerischen Wirken; unbeseelt; benötigt menschliche Fleischwerdung; Maria, Inbegriff der schönen, guten Frau, der Heiligenfigur par excellence. Sie wird als Vorbild benutzt. Die Verwandlung geschieht mittels Bestrahlungen. Maria, die Heilige wird zur Maria, der Sünderin, beseelt vom Willen ihres Konstrukteurs, das Böse in die Welt zu schütten. Die Inkarnation ist in ihrem Aussehen nicht vom Original zu unterscheiden; Urbild und Abbild sind deckungsgleich. An ihrem Denken und Handeln jedoch sind sie zu erkennen. Die Möglichkeit zur Erkenntnis des Originals ist die Liebe, zur Erkenntnis der Kopie die Verführung. Eine fatale
Abstraktion: Die Heilige, die Verwandlung, die Sünderin.
(Mensch-Maschine 3; Szene aus dem Film „Ghost in the shell“ von Rupert Sanders; 2017)
Kunstwerk; zweidimensional; beweglich; fiktiv. Der Traum des Kopfes/Kapitals gebiert faszinierende Ungeheuer.
(Mensch-Maschine 4; 2017; Filmszene aus „Blade runner 2049“ von Dennis Villeneuve)
Kein Kontakt zwischen der Haut des Menschen und der Fläche des Bildes. Die Haut des lebendigen Körpers und die Fläche des Bildes: sie sprechen, nicht zueinander, sie wissen, nichts voneinander.
(Mensch-Maschine 5; 2022)
Kein Kunstwerk, mehr als dreidimensional; beweglich; fiktiv und lebendig; Technikerträume sind Phantasmagorien der Alltagsbanalitäten. Aus Angst vor dem Tod in Illusionen, in Simulationen fliehen, aus Angst vor dem Tod lieber sterben, zum Bild werden, zur Maschine werden. Die Hände greifen ins Leere, ins Nirgendwo und Überall. Die zu ertastenden Körper werden durch Bilder von Körpern ersetzt. Hände können nur gespürte Dinge begreifen. Die Hand, die tastet, erspürt mit der Haut. Mit der Haut werden geborene, lebendige, wieder sterbende „Dinge“ erfahren. Die Augen können nicht erspüren. Sie begreifen nicht, sie können nicht wissen. Maschine und Mensch wissen nichts voneinander. Können Mensch und virtuelle Wirklichkeiten miteinander sprechen? Gibt es ein „Seeing through language“? Ist die Sprache ein Spiegel, der die Welt abbildet? Ist sie ein zerbrochener Spiegel, der die Wirklichkeiten zerstückelt? Ist sie als ein Spiegel blind? Spiegel können nicht berühren.
(Maschine-Mensch; bing.com/images)
Die Wiederholung des Immergleichen. Maschinen haben keinen Sozius, gemeinsame Handlungen von Maschine und Mensch sind nicht möglich. Maschinen können nicht fühlen. Zwischen Maschine und Mensch gähnt ein Abgrund.
(Maschine-Mensch; bing.com/images)
Gott sieht von sich selbst ab und erschafft sich seine Gebilde: Adam und Eva. Die Menschen sehen von sich selbst ab und erschaffen sich ihre Gebilde: die Maschinen. Die Maschinen sehen von sich selbst ab und erschaffen sich ihre Gebilde: die Spiegelbilder der Menschen.
Die Spiegelbilder sind Flächen, monströse Körper, die ihre Körperlichkeit verloren/vergessen haben, Modelle. Sie stehen im Maß, sind genau abgesteckt. Spiegelbilder sind immer ein Mal/einmal und wiederholen sich immerfort, sind immer gleich in allen Zeiten und Räumen; sie multiplizieren sich im Immergleichen. Sie sind Muster, Monstren, Hinweise, Zeiger, Zeichen (das lateinische Verb monstrare); sie sind ohne Fleisch und Blut, sind reiner Geist, sie hausen in Täuschungen. Spiegelbilder zeigen Gesichter, die erscheinen, die da sind, die nicht anblicken. Das Gesicht ist kein Antlitz. Aus dem Antlitz heraus schaut uns Lebendiges an, das gespürt werden will. Das Präfix „Ant“ bedeutet entgegen. Das im Deutschen untergegangene Verb „lita“ bedeutete blicken. Aus dem Antlitz heraus strömen Wärme und Liebe, aber auch Kälte und Ablehnung. Das Antlitz „verkörpert“ den Anderen, der einmalig, einzigartig ist in der Gegenwart der Begegnung und bleibt in all seinen Verwandlungen, der aktiv mich als einmalige Person erblickt, genauso wie ich ihn als eine einmalige Person anblicke. Die Begegnung zweier Antlitze ist eine Hochzeit der Fülle, des Lebendigen. Sie erweitert, sie erneuert. Das Antlitz gibt Antworten. Es ist mehr als nur das Augenpaar, das stumm sieht. Das Antlitz will berührt werden. Die Maschinen träumen ihre Menschen, sie imaginieren, bilden sich ein, sehen Gesichter, deren Augen leer sind, tot. Maschinen sind voller Sehnsucht nach ihrem „ganz Anderen“. Sie sehen nur ein Bild. Sie erhalten keine Antwort. Sie können nicht spüren. Weder sich noch ihre Bilder. Sie können nicht berühren. Das „Face-Lifting“ des Bildes kann kein Tasten und Fühlen ersetzen. Das Auge sieht nur Punkte, Linien und Flächen. Das Face-Lifting will auf Abstand halten. Das modellierte Gesicht will nur gesehen werden. „Noli me tangere!“ Die Augen können nicht berühren. Die Augen können nicht lieben.
Vorwort
Der gesprengte Rahmen
(Pere Borell del Caso, Escaping criticism, 1874)
Die Trompe-l'oeil-Malerei stellt die Darstellung der Wirklichkeit im Bild mit den Mitteln der Darstellung selbst in Frage. Mehr noch: Sie hebt sie auf. Das Bild im Bild bedeutet eine doppelte Negation, eine Fiktion in der Fiktion: Der Bilderrahmen ist kein Bilderrahmen und das kletternde Kind ist kein kletterndes Kind. Der Rahmen begrenzt nicht und das Kind braucht die Grenze nicht zu überschreiten, weil all dies so erscheint, so zu sein scheint. Die anschauliche Welt löst sich in Darstellungen auf. Darstellungen sind Fiktionen.
Wirklichkeit und Schein sind nicht zu unterscheiden, zu teilen, sie bilden keinen Gegensatz mehr. Sie entwischen den Setzungen und Teilungen. Sie spielen miteinander, verschränken sich ineinander zu einer Fiktion ersten und einer Fiktion zweiten Grades. Die Fiktion zweiten Grades verschmilzt mit der Fiktion ersten Grades, beide sind dann nicht länger Fiktionen. Beide werden zum Integral, zu einem Innenleben der Phantasie, auch Einbildungskraft genannt, die ihre poetischen Welten erspielt, die für sie selbst, in ihren Bildern, immer zutiefst „wirklich“ sind, weil sie unmöglich sind. In diesem Unmöglichen füllt sich ihr im steten Wandel schwingender Sinn. Aber nicht nur der der Bilder. Auch jedes die Bilder beschreibende und erklärende Wort, jede Silbe, jeder einzelne Laut schwingt im Unmöglichen. Jede im Maß des Eindeutigen und Klaren stehende Namensgebung der klingenden Wörter wäre eine „Zähmung“ (de S. Exupéry) des eigensinnigen Spiels der poetischen Überbietungen, das immer in ein neues Spiel drängen, dessen Sinn darin liegt, Sinn zu erzeugen. Eigensinnig zu sein bedeutet immer: im Überfluß des Sinns zu baden.
Die Parole „Trompe-l'oeil“, „Täusche das Auge“, wäre im Klang der Wörter ein „Trompe-l'oreille“, „Täusche das Ohr“, das sich aber nicht täuschen ließe, sondern ins immanente Reich der Sinnfülle ohne Ende klingend entschwebte. Das „Trompe l'oreille“ wäre dann eher ein „Trompe la raison“, „Täusche den Verstand“, verbunden mit der Aufforderung zum „Imaginezvous!“, das ins erstaunende, poetisch-träumerische, unermesslich Kleine und Große fortklänge. Im poetischträumenden, im phantastischen „Bilden“ und „Worten“, in vibrierenden Wortbildern und Bildworten, in denen Fragen sich in Antworten und Antworten sich in neue Fragen verwandelten, zutiefst wirklich und unwirklich, wahr und exakt zugleich, wäre das Denken los gelassen. Es wäre gleichsam kopflos, ohne seine diversen Köpfe zu verlieren. Es wäre körperlos, ohne seine vielen Körper zu verlieren. Aus den Bildern heraus träten die Bilder und es ertönten die Worte der Verwunderungen. Es gäbe keine Erklärungen. Nichts wäre klar und deutlich zu sehen. Doch klänge der losgelassene Sinn, vibrierten Verlautungen, jetzt einzigartig und verschieden einander zugesprochen. del Casos „Escaping criticism“ schwingt gewissermaßen ins Unsichtbare des Bildes hinein, ins Hörbare, mitten hinein in die Verwandlungen des Klangs. Das Unsichtbare ist hier nicht ein Nichts, sondern ein Etwas, nicht ein durch Sichtbares verborgenes Sichtbares, sondern eine aus dem Sichtbaren hinausdrängende Kraft, gleichsam eine Macht, die ins Wort will, um dort nicht zu bedeuten, sondern zu klingen. Das poetisch-träumerische Wort will erhört werden. Es verschleiert und verwirklicht, verspricht und entmutigt. Es verzaubert und hält die, die ihm lauschen, so immer in der Schwebe des Glücks.
A Im Zimmer des Hörens
a) Sehflächen und Hörräume
In diesem Buch soll von der Verwandlung der Einbildungskraft in eine Anhörungs-und Einstimmungskraft erzählt werden. Im Vordergrund agiert dabei, im Theater des Denkens, auf der Bühne des eingebildeten Hörens und Sprechens, des vorgestellten Singens und Musizierens, in raffinierter stets wechselnder Kostümierung, ein Held, der gewissermaßen ein Doppelding, ein Januskopf ist und Lautbild oder „image acoustique“ genannt wird. Im Hintergrund aber „dreht sich alles“ um das wirkliche Sprechen und Hören, um aktive Ohren und Münder, um das Atmen und Herzschlagen lebendiger „Körper“, den eigentlichen Helden, die keine Schaubühnen benötigen, um den Klang der Dinge zum Schwingen zu bringen. Es geht auch um die Schul-kinder, die auf ihren Wegen zur Buchstabenschrift sind. Der Plural steht hier nicht von ungefähr. Viele Versuche unternimmt das eigensinnige, unvergleichliche Kind, das souverän und hilflos zugleich agiert, und sich im Einander mit den anderen Kindern und Erwachsenen, nie in der Vereinzelung und im Gegeneinander, finden will.
Das Schauspiel "Lesen und Schreiben lernen" steht im Zwielicht, denn: das kindliche Bemühen zur je individuellen Sprache, mit seinen eigentümlichen Regeln von Realisation, Assoziation und Partizipation, die eine entsprechende Spracharchitektur grundlegen, in der Piagetschen Tradition Artifizialismus und Animismus genannt, steht diametral der schulischen Anstrengung zur allgemein-öffentlichen Schriftkultur, mit ihren Vorgaben der Identifikation, Differenz und Kausalität, komprimiert im linguistischen Dreieck von Wirklichkeit, Vorstellung und Lautbild, entgegen. Der alltägliche "Schriftspracherwerb" stiftet daher notwendig arge Verwirrungen bei dessen Akteuren, den Erwachsenen und Kindern, die oft zu „Katastrophen“ führen. Erzählt werden soll auch davon, dass es sich beim Erlernen des Lesens und Schreibens nicht um einen Erwerb handelt, also um das Erreichen einer rechtlich bedeutsamen Stellung, um einen Eigentumstitel, der nach tätigem Bemühen verliehen wird: Das Kind ist hier als isolierter Akteur unterstellt, der, aus sich heraus und auf sich bezogen, eine Kompetenz erlangt, eine Zuständigkeit zum Hören und Sprechen, zum Lesen und Schreiben. Ausgeblendet wird dabei, dass die Kulturleistung der Oralität und Literalität im Dazwischen geschieht, d.h. im performativen Spiel des Austauschs. Der Erwerb unterstellt die Isolation des Entwerfens. Das performative Spiel (das Soziale des Zuwerfens) wird hier ausgeblendet. Je differenzierter das Soziale, das (Sprech-und Sprachmilieu) ist, in das eingebettet das Kind agiert, desto nuancierter ist seine Sprache und sein Sprechen. Je totaler die Vereinzelung, die Diskretion ist, desto eingeschränkter ist die sprachliche Kraft zum Plastischen beim Kind. Fallen die Nuancen weg, fällt auch die kulturelle Leistung des Kindes. Davon im Buch mehr.
Was hier, vorläufig, gesagt werden soll: Das Kind folgt in seinem über Jahre hinweg eingeübten und praktisch erprobten Hören und Sprechen, in dem es auf das Musikalische, das Gemeinte und nicht auf das formale und wortwörtlich Gesagte achtet, einem anderen "Maß“ als die Schule, in deren Vorstellungen von der Sprache theoretisch fixierte Konstruktionen Gültigkeit besitzen.
In der Sprachwissenschaft erscheint jenes zwielichtige Treiben als Annahme der zwei Welten von "langue" und "parole" (de Saussure), dem je subjektivkonkreten Sprechen der Individuen hier und der objektiv-allgemeinen Sprache als System dort. Die Paradoxien, die sich aus diesem Dualismus ergeben, sind in der Literatur an verschiedenen Orten diskutiert worden und bilden mittlerweile die Grundlage für strukturalistische und poststrukturalistische, psychoanalytische und postpsychoanalytische, konstruktivistische und dekonstruktivistische Theorien.
Alle diese Theorien gründen, ihren heftigen Abgrenzungen zum Trotz, in der gemeinsamen Setzung eines Begriffs der Sprache, der sie so faßt, daß sie entweder nach einer spielenden Zufälligkeit oder einer notwendigen Gesetzlichkeit, linear im Raum und sukzessiv in der Zeit verlaufen soll.
Die Buchstaben und Laute verketten sich, gemäß dieser Annahmen, nach- und nebeneinander zu Wörtern und diese wiederum zu Sätzen. Solche Reihen sind immanent in diskrete Teile zu zerlegen (Phoneme, Grapheme usw.) und können zu immer neuen Kombinationen verbunden werden. Sie sind digital aufgebaut und folgen dem Prinzip der Arbitrarität, einem Prinzip, daß, im Schein des Zufalls, die Notwendigkeit eherner Formalismen einfordert. Hier wiederum ein vorläufiger Satz, dessen Sinn in diesem Buch entfaltet werden soll: Das Vor-Bild jener theoretischen Annahmen ist die Buchstabenschrift und nicht das lebendige Hören und Sprechen des Kindes.
Von dieser im Eindimensionalen gefassten Vorstellung der Sprache ist zu unterscheiden die Einmaligkeit der jeweils gesprochenen Sprachen, die für alle Sprachwissenschaften die empirische Voraussetzung bildet. Das konkrete Hören und Sprechen lässt sich nicht als Kette einzelner, diskret gegeneinander geschiedener Teile (Segmente, hier: Phoneme) fassen, sondern als ein kontinuierlicher Strom von Verlautungen, die gewissermaßen ein Läuten genannt werden können. Mit dem Begriff des Kontinuums ist eine Segmentierung in diskrete Teile logisch unmöglich, es sei denn um den Preis eines regressus oder progressus ad infinitum.
Die gesprochene und die geschriebene Sprache stehen sich qua definitionem polar entgegen. Und noch klarer und eindeutiger formuliert: Beide schließen sich in ihrem Selbstverständnis wechselseitig gegeneinander aus. Die in der Sprachwissenschaft gültige Annahme jenes Laut-Bildes (image acoustique) versucht, diese Polarität, mehr: diesen Gegensatz des Diskreten und Kontinuierlichen, zu überwinden. Die stimmlich-akustischen Verlautbarungen der gesprochenen Worte, der Strom der Rede (die Zeit), und die buchstäblichvisuellen Gebilde der geschriebenen Wörter, die "Behälter" der Schrift (die Linie auf der Fläche; der zweidimensionale Raum), bedeuten zwei qualitativ verschiedene "Dinge". Sie sind entweder Ohr und Mund oder Auge und Hand verpflichtet, Quellen, die grundsätzlich aus andersartigen Kategorien sprudeln und verschiedene Welten bewässern. Die Verbindung dieser Polarität, die Überwindung dieses Gegensatzes, beide gebären etwas Monströses, jenes "Laut-Bild", das mit den Ohren gesehen und den Augen gehört werden will.
(René Magritte, La chambre d'ecoute, 1952)
Ein Kind sitzt im Zimmer. Es hört das Wort Apfel. Dies Wort erfüllt das Kind unmittelbar. Es nimmt überall Platz in ihm ein, in seiner ganzen kleinen Person. Das klingende Wort verwandelt sich in der Phantasie des Kindes. Hier schwingt der konkrete grüne Gegenstand über seine Größe hinaus. Das Wort erfüllt und hallt, es klingt, im Ohr des Kindes und erweckt seine Einbildungskraft, die zu einer Anhörungskraft wird. Das klingende Wort Apfel schwingt als Echo in der Seele des Kindes nach und löst den „wirklichen“ Apfel in seiner Gegenständlichkeit auf. Er „ist“ gleichsam überall. Er dehnt sich vom Boden bis zur Decke aus und berührt alle vier Wände, im Augenblick des wohligen Phantasierens. Dieser Augenblick enthält alle Zeiten. Es gibt hier und jetzt nur das Einander von Apfel und Kind.
Der Apfel ist nicht länger ein Gegenstand der Anschauung. Er läßt im Raum, den er einzig ausfüllt, keine anderen Gegenstände neben sich zu. Die Landschaft, die außerhalb eines Fensters zu sehen ist, erhält keine Aufmerksamkeit. Die Ordnung der realen Dinge ist aufgehoben. Unmögliches wird Wirkliches. Nach- und Nebeneinander von Raum und Zeit werden durch ein Ineinander der Gleichzeitigkeit überboten. Der Apfel ist süß. Er fühlt sich kühl an, riecht nach frischer Luft, die ihn umweht, birgt helles Licht unter seiner Schale, streichelt die Zähne, kitzelt in der Magengegend. Das Kind wird verzaubert, in fremde Welten gebracht, in Welten, die doch so vertraut zu sein scheinen. Ein weites Feld glücklicher Empfindungen eröffnet sich. Dies alles und noch viel mehr schwingt in den poetischen Augenblicken der Phantasie. Dies alles ist für das Kind, im Moment der Überfülle des herrlichen Fühlens und Beißens und Kauens und Schmeckens und Fliegens und Blühens und Wachsens. Alles weitet sich zum phantastischen Hier und Jetzt, in dem das Kind unmittelbar lebt. Apfel und Kind sind in einem wunderbaren Einander. Nicht nur der Raum ist von einem übergroßen Apfel ausgefüllt. Auch die Zeit schwingt im Nu unendlichen Apfelseins.
Raum und Zeit tanzen gemeinsam mit dem Kind. Sie tanzen im Klang des Wortes „Apfel“. Dem Kind vergeht hier Hören und Sehen. In den Augenblicken erscheinen keine distinkten Dinge, die nur im Gegeneinander sein können. Es klingen keine distinkten Laute, die nur im Verschwinden sein können. Es pochen die poetischen Welten in der Seele des Kindes. Einzigartig und schön.
b) Aisthesis und Akroasis – Von den Kräften des Einbildens, Anhörens und Einstimmens
Den Spuren jenes ungeheuerlichen Laut-Bildes soll zunächst in der Rekonstruktion „philosophischer“ Begründungen gefolgt werden, die in den Theorien von Ferdinand de Saussure und Noam Chomsky ihre sprachlogische Erfüllung gefunden haben. Auf diesem Weg kann die Geschichte einer Abstraktion erzählt werden, die von Ohr und Mund, den oralen Quellen, der Fülle einer je individuell klingenden "parole" über die konventionell-zufälligen Ketten des "signifiant" und "signifié" bis hin zu Auge und Hand, zum Spektakel der unendlichbeliebigen Bilderreihen und endlich, zu den "strings of formatives", den gezeichneten Figuren des Hörens und Sprechens verläuft.
Es wird dies die Geschichte des einen Auges sein, das alles im Blick haben will und doch nichts sehen kann. Diesem einen Auge korrespondiert ein Denken, das zur Omnipotenz der (buchstäblichen) Bilder auswuchert und seinen Inhalt in der permanenten Erfindung von formalen Konstellationen besitzt, die ihren Zweck nicht in dem Stiften eines je besonderen Sinns von etwas haben, sondern in der anhaltenden Produktion als reiner Form selbst, die immer wieder auf sich selbst zurückgreift, die eine Produktion um der Produktion Willen ist: ein heimtückisch aus sich selbst rollendes Rad, das seinen Antrieb aus sich selbst zu holen meint, tatsächlich aber aus Leibeskräften schöpft, die endlich sind.
Ich werde, mitten im Glanz der Sprach-Bilder und Denk-Figuren, Stimmen lauschen, die in den Sprachphilosophien Ludwig Wittgensteins, Ferdinand de Saussures, Noam Chomskys und Jaques Lacans, durch Formalia verschleiert, verborgen sind. Das Erkenntnisdispositiv dieser Gewährsleute ist aisthetischer Natur. Sie spannen ihre Sprach-Bestimmungen im Bogen einer zerteilenden Augenlust, einer nie zufrieden zu stellenden Augenbegierde (concupiscentia oculorum) auf. Untergründig jedoch klingen in ihren Theorien Melodien, die von einer erfüllten Ohrenlust (concupiscentia aurium) künden. Inmitten der Aisthesis (Anschauungswelt) der Gedankenbilder, die die Sprache als (bloße) formale Angelegenheit betrachten, verbirgt sich eine Akroasis (Anhörungs- bzw. Einstimmungswelt) der Klänge, in denen das lebendige Sprechen schwingt.
Die Sprache ist, gemäß der Akroasis, eine, die tönt, die atmet und Stimmen besitzt, eine, die im Ertönen eines Klangs die Verbindungen, das Einander der Welt verkündet und nicht eine, die als unendliche Reihe diskreter Teile, als nie abzuschließende Sache (res) dominiert, die sich in ein zufälliges Einerlei möglicher Verbindungen auflöst. Im Begriff der Akroasis kann ein Hör-Zeit-Raum eröffnet werden, der in eine eigentümliche Differenz zu jenen Seh-Linien und -Flächen der Linguistik tritt. In dieser Differenz sind die Schrift und der Klang radikal gegeneinander gesetzt und nur über Hinweise, die eine Poesie der Klänge geben kann, ineinander zu verschränken bzw. zu überbieten.
c) Zur Poesie – Träumend hören und sprechen
Der Begriff der Differenz meint nicht den der "differance" (Jaques Derrida): Im Begriff der differance wird der vieldimensionale Zeit-Raum der Wortklänge auf die Graphie, auf die eindimensionale Buchstabenfolge in der zweidimensionalen Schriftfläche zurückgebogen. Demnach kann es keine "Laut"-Bilder geben; im gesprochenen Wort ist immer schon etwas "eingeschrieben", der Wortklang wird zu einer Folge diskreter Phoneme, die (lediglich) Derivate der Grapheme sind. Derridas "Grammatologie" hält die Differenz von Laut und Bild, von Auge und Ohr nicht aus. Sie stellt aber einen Wendepunkt in der Sprachbetrachtung dar, von dem aus eine andere Differenz erklingen kann. Derrida sagt, die Schrift sei eine conditio sine qua non des Sprechens, in der gesprochenen Sprache wäre also strukturell etwas "eingeschrieben". Einfach formuliert: Wir können den Kern unserer Sprache nicht hören, weil er sich der Schrift verdankt; wir können ihn aber auch nicht sehen, weil er als tönender Laut der Figürlichkeit der Zeichen gleichsam immer schon voraus ist. Ein für das Laut-"Bild" konstitutives Formprinzip ist einzig zu denken; es verwirklicht sich in der je lebendig gesprochenen Sprache und findet in den kategorialen Sätzen von Identität, Widerspruch und Relation seine Bedingungen. Es verbirgt sich in der gesprochenen Sprache und in der die Sprachbetrachtung leitenden Grammatik.
Formuliert als Paradoxon: In der Präsenz der je konkreten Sprache waltet ein Prinzip der Absenz. Damit verweist Derrida auf Jacques Lacan, der in der gesprochenen Sprache das Anklingen von etwas Ungesagtem bemerkt, der in der Sprache ein Subjekt des Imaginären meint verorten zu können, das sich im Symbolischen als Realität darzustellen versucht, was so viel bedeutet wie: Derjenige, der spricht, hat sich, bevor er spricht, als Imaginäres erfunden/gefunden, das er symbolisch in Worten realisiert, woran er jedoch stets scheitert. Was aber eigentlich nicht stimmt, denn es müsste heißen: In demjenigen, der spricht, hat sich, bevor er spricht, ein Imaginäres eingenistet, dass sich symbolisch in Worten realisiert und den Sprecher an seinem Schein des freiheitlichen Tuns verzweifeln läßt. Was hier vorläufig gesagt werden kann (und später in einem Kapitel, das Lacans Denken zum Thema hat, genauer dargestellt werden soll): Die Sprache ist in diesem Wirkungsfeld des Imaginären und Symbolischen kein Zeichensystem, das Realitäten (abbildend) verdoppelt, sie ist auch kein Signal, das von einem "inneren" Denken kündet. Sie ist eine "passion imaginaire", in der ein Subjekt, in der Sphäre seines je aktuellen Sprechens mit anderen Menschen, sich in einem Spiel der Vieldeutigkeiten symbolisch immer wieder zu seinem imaginären Ideal hin realisiert, besser: in einem Spiel zur Verwirklichung drängt, bei jedem dieser Versuche allerdings die Unzulänglichkeit seines Unternehmens einsehen muß und daher notwendig zu anhaltenden Wiederholungen mäandert. Dabei ist seine Sprache immer auch die von etwas anderem: "Ce n'est pas l'homme qui parle mais dans l'homme et par l'homme ca parle." Für Lacan ist dies "Es", das spricht, nicht mit dem Freudschen Begriff des Unbewußten gleichzusetzen, das "man" besitzt wie einen Gegenstand, der topologisch gesetzt, koordiniert, analysiert werden kann. Vielmehr meint er damit gleichsam eine "Zwischenwelt", in der das Subjekt sich als etwas aus sich Herausgesetztes gibt und geben läßt, sich, so paradox es klingt, eigenaktiv existieren und "ich" (je) sagen läßt, dabei aber immer ein anderes "ich" (moi) meint, wenn es „ich“ spricht.
Im Ich/Je befragt ein Mensch, sonor (phonosemantisch?) ausschwingend in den Resonanzraum des Sozialen, sich selbst, seine Grundlosigkeit ahnend, und erhält auditiv im Moi eine verschleierte Antwort aus diesem Klangraum auf seine sich selbst betreffende Frage. Eine Antwort, die er, weil er in der befragten Welt mitschwingt und von ihr umhüllt wird, in die Illusion einer Autonomie und Wahrheit versetzt. Der Schein der Autonomie spricht sich in Wörtern aus, die den konventionellen Aspekt des Sozialen stiften, in dem partikulare Iche relativ gegeneinander auftreten und so ein imaginäres Ganzes begründen, nämlich: die glatte Oberfläche "verständigen Redens", in dem die Wörter, gleichgültig gegeneinander, sich hin und her bewegen, ohne den Bund eines verbindlichen Sinns einzugehen mit den Dingen, denen sie Namen geben. Dagegen scheint Lacan den Raum eines "echten" Gesprächs zu entfalten, in dem das Wort erklingt, zart, gebrochen, im Schweigen; in dem ein fragiles Ich das sagen kann, was es schon immer war, immer ist und immer sein wird, entbergend aber auch immer verbergend. Im echten Sagen schwingt, so deute ich Lacan, immer auch Ungesagtes mit, erklingen mehrere Stimmen gleichzeitig, wie in einer Partitur. Das Wort ist gleichsam ein zusammenfassendes Echo der im alltäglichen sprachlichen Austausch flottierenden Wörter. Es schwingt in der Resonanz der je unterschiedlichen "Laut-Bilder", wie ein die vielen Obertöne bergender Ton, wie ein die verschiedenen Einzeltöne verbindender Klang.
Die Wörter trennen, das Wort verbindet. Das konventionelle Sprechen verfälscht, es wendet sich nicht an sein gegenwärtiges Gegenüber, sondern durch es hindurch an ein abwesendes imaginäres Anderes. Anwesend ist so immer ein abwesender imaginärer Wertbildner, der die Sprache ausschließlich als Form setzt. Das, was hier gilt, das kann gemessen und gezählt werden. Nicht was gesagt wird, sondern wie es gesagt wird, ist von Belang, wie es in den arbiträren Sprachfiguren und Sprachverkettungen erscheint. Für Lacan ist dies das falsche Sprechen, von dem sich ein echtes Sprechen positiv abhebt, das auf sein gegenwärtiges Gegenüber horcht. In ihm entfaltet der Sprechende seine je eigensinnige, einmalige, in keine messende Äquivalenzrelation zu pressende Anhörungskraft. Sie gebiert ein Horchen auf das eigene und das fremde Sprechen.
Friedrich Nietzsche ahnte diese Anhörungskraft, noch negativ, denn die durch sie gestiftete Nähe und Verbindlichkeit der gesprochenen Worte ist keine. Sie wird zwangsernährt durch das abwesende Ferne, Fremde und wirft den Sprechenden und Hörenden in den Abgrund eines alles in Zweifel ziehenden Nihilismus. Nietzsches "Held" Zarathustra muß sich zum Kind zurück- und vorentwickeln, um im "unschuldigen" Spiel, als einer rausch- und maskenhaften Verstellung, dies "Ferne, was doch so nah ist", qua Metamorphose zu finden. Im Spiel wird das Verhältnis von An-und Abwesenheit umgestülpt: Das im unechten Sprechen der Erwachsenen dominante Imaginäre, das anwesende Abwesende, verliert seine Macht innerhalb des kindlichen mündlichen (Sprach-) Spiels, in dem jetzt die zuvor in Formen eingewöhnte Existenz entbunden wird zugunsten eines Wagnisses, das horchend sich selbst (und die anderen vernehmend) ins Spiel bringt, aufs Spiel setzt. Jetzt kommt nicht jenes eingebildete transzendentale Substrat zur Sprache, das sich zwar unbekümmert in gegeneinander gleichgültigen (Buchstaben)-Figuren niederschreiben läßt, dabei aber immer (nur) seine Form bewahren kann. Jetzt lebt der Sprechende in seiner Sprache, in der er die fixe Leere (weil eben nur formale Identitätszuschreibung: "Das ist mein autonomes, mit sich selbst gleiches Ich". "Das ist ein mit sich selbst gleiches Ding.") in eine einmalige erfüllte individuelle Freiheit verwandelt, die tanzt und singt: "Ich bin im kleinsten Augenblick etwas Anderes als im nächsten!" Ich bin dieses einmalige Individuum und auch die Unzahl von (möglichen) anderen Individuen, die "unendlich vielen Inseln im ewigen Fluß" (Nietzsche). Der Inhalt der Sprache scheint sich bei Nietzsche nicht in jenem durch den Empirismus überlieferten (und in der Linguistik verfestigten) formalen Gestaltungsprinzip zu erschöpfen, das den Dingen der Welt gleichsam wie eine Folie übergezogen wird. Es gibt für Nietzsche, so interpretiere ich seinen Zarathustra, keinen Unterschied mehr zwischen dem Signifikanten als dem Zeichen, das bedeutet und dem Signifikat als dem Stoff, der bedeutet wird. Jetzt kann eine mehrdimensionale, überbietende Sprache im Resonanzraum des Ohres (das die gesprochene echte Rede unterstellt) gelten, im Gegensatz zu den eindimensionalen Lautfolgen, die eingeschrieben werden in die zweidimensionalen Figuren der konventionellen öffentlichen SchriftRede.
Schon im Denken Immanuel Kants, insbesondere in seiner Behandlung des Begriffs der "Einbildungskraft", der facultas imaginandi, pochte untergründig ein Resonanz- und Anhörungsraum. Kant zog das Wirken der sinnstiftenden Einbildungskraft auf die kategorial vermittelten "Anschauungsformen a priori" zusammen und bannte diese in den Rahmen eines transzendentalen Schemas. Unbeantwortet blieb hier jedoch die Frage, wie in dies Schema, in diese reinen Formen der klingende "Geist", die Stimme hineinkommen kann. Die durch die Einbildungskraft in die Welt gebrachten VorStellungen (die Formen?) erzittern vor Stimmen (die Inhalte?), die sie schließlich zum Tanzen bringen und dabei verwandeln. In den Vorstellungen lebt die Erinnerung an eine Anhörungskraft, die in puncto Sprache durch die buchstäbliche Ordnung auf eine klingende Welt deutet. Die Einbildungskraft deutet auf eine Anhörungskraft und damit auf das, was den Menschen als animal symbolicum bestimmt.
Das tonale Ineinander (im Gegensatz zum buchstäblichen Nacheinander) erklingt im Resonanzraum der menschlichen Seele. Hier spricht der Mensch jetzt mit und von sich als von einem unmöglichen Anderen, von seiner Zukunft, von seiner Vergangenheit, die er immer in der geglückten Gegenwart sein kann. In diesem Resonanzraum vernimmt sich der Sprechende selbst. Und seinen Sozius, der sich nicht mehr als Gegner setzt und mit seinem Gegenüber in einen anhaltenden Kampf ums Dasein verkrampft und entzweit. In den Einstimmungen, nicht in den Einbildungen, gestaltet sich im emphatischen Sinne der Sinn des Sozialen. (Dieser Gedanke hat eine grundsätzliche Bedeutung für die Schule, in der die Kinder das Lesen und Schreiben hauptsächlich über die formalen Artefakte "Phonem" und "Graphem" erlernen, dabei den Sinn in dem und von dem, was sie lernen, systematisch verlernen und so asozial werden.)
Zwischen dem Resonanzraum der klingenden und den Bildschirmen der sichtbaren Wörter oszillieren die Buchstaben und Laute, die insofern immer gestischer Natur sind; sie deuten auf die Sucht der Einbildungen und den Rausch der Anhörungen. Sie besitzen eine je spezifische Physiognomie. Ihr Blick deutet auf objektiv geronnene Tatsachen, auf Zeichen, die in einem rational-logischen Bilderrahmen oder auf einem Bildschirm (die formalen Regeln der Linguistik) gebannt sind. Ihr Gesang von und ihr Horchen auf die Welt offenbaren aber auch seelische Befindlichkeiten (Gefühle, Wünsche, Ängste, Willensimpulse usw.), die die Freiheit des Menschen mit seinem (unbewußten) Begehren, seinem schöpferischen Ver-Dichten, seiner Poiesis, erfüllen. Diese "subjektiven" Befindlichkeiten (eigentlich ein Pleonasmus) in der Sprache, ihr klingender Bedeutungs-Zeit-Raum, der immer die Menschen mit den Dingen zusammen schwingen läßt, sie sollen in diesem Buch aus ihren geronnen Formen (der Zeichencharakter der Sprache) gewonnen werden. Das Attribut "subjektiv" ist nicht gleichzusetzen mit willkürlich, zufällig, partikular; es meint vielmehr (in der Diktion Kants) die "Bedingung der Möglichkeit von" der Sprache, analog zu dem, was Humboldt im Begriff des "Sprachsinns" vorstellte.
Emotional-volitionale Gesten sind konstitutiv für die Laute und Gebilde des gesprochenen und geschriebenen Wortes in der Sprachgemeinschaft, die sich des Deutschen bedient, auf dessen "Sprachspiele" (Ludwig Wittgenstein) die „ästhetischakroamatischen“ Untersuchungen des Sprachlautes (der Klang des Gesprochenen) und der Sprachfigur (die Figürlichkeit der Buchstaben) sich beziehen. Der /m/-Laut beispielsweise besitzt einen zentripetalen Kraftvektor, er schließt einen Resonanzraum ab, vermeinigt, will heranziehen, hereinnehmen, ist rückwärts, nach innen gerichtet, will festhalten, umkreist Gefühle des Misstrauens usw. Polar dazu kann die zentrifugale Kraftrichtung des /d/-Lautes gefunden werden, der auf das "das da", auf das "Du", das "Dasein" deutet. Nicht zufälliger Natur ist die nach außen oder innen gerichtete Geste der Demonstrativpronomen dein, dir, toi bzw. mein, mir, moi, mon usw. Jeder Laut, selbst jeder Buchstabe, enthält eine kleine Welt voller Hinweise. Schon Wilhelm von Humboldt schätzte die Physiognomie der Buchstaben und Laute, die für ihn mehr bedeuteten als nackte formale Zeichen, willkürlich in die Welt gestreut. Humboldt meinte, ein anlautendes "W" in den Wörtern "wehen, Wind, Welle oder Wolke" zeige schwankende, unruhige Bewegungen an und jeder könne die Kräfte und Spannungen vernehmen, denen sich der Laut und die Form des "W" anschmiegten, ihnen folgten, die sich von ihnen ergreifen ließe (die Relevanz des Erhabenen), ihr Kräftespiel mit vollzögen und es gestaltend vollbrächten. Humboldt spricht vom "individuellen Sprachsinn" und er meint damit die je einzigartige Lautphysiognomie, die den Buchstaben und Wörtern, den Lauten und Worten innewohnten. Seine Philosophie erinnert ausdrücklich an die akroamatische Natur der gesprochenen und geschriebenen Sprache(n).
B Ferdinand de Saussure
Über den scheinbaren Widerstreit von parole und langue
Die moderne Wissenschaft von der Sprache finge mit de Saussures 1915 veröffentlichtem „Cours de linguistique générale“ eigentlich erst an, so die gängige Vorstellung der Sprach-und Schriftgelehrten. Alle zeitgenössischen Vorstellungen von der Sprache ließen sich auf den Genfer Linguisten und (angeblichen) Begründer des "Strukturalismus" zurückführen:
„Many different schools of linguistics can be distinguished at the present time, but they have all been directly or indirectly influenced (in various degrees) by de Saussure's Cours.“(J. Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge, 1968, S. 39)
Berühmt geworden sei de Saussure durch seine „distinction between „langue and parole“, durch seine „priority of synchronic description“ und durch seine Annahme des Strukturalen, „that means, that every language is regarded as a system of relations“ (ders., aaO, S. 40).
Langue, parole, die Synchronizität (versus Diachronizität) der Sprachwissenschaften, die Sprache als ein System (die syntagmatischen und assoziativen Beziehungen der einzelnen Sprachglieder zueinander), an diesen berühmten Formulierungen sollen sich die folgenden Gedanken orientieren. Vorrangig steht der Begriff des Laut-Bildes zur Debatte: Die doppelte Welt des Klangs und der Figur wird diskutiert werden und das vordergründige kategorial-kognitive des Optischen immer auf das hintergründige sensorisch-ästhetische des Sonoren und Auditiven bezogen. Rehabilitiert werden können dabei die sinnlich-körperlichen Implikate der Sprache. Denn: In de Saussures Denken ist ein Verdikt des corpus absconditus zu spüren, das wiederum auf dem kulturellen Grund des deus absconditus steht. In de Saussures Sprachsystem schwingen immer auch Martin Luther, Erasmus von Rotterdam, Augustin, die monotheitische Tradition mit ihrer Geistidolatrie und Körperskepsis bis Körperfeindschaft, also eine kulturelle Tradition, die in Abstraktionen schwelgt.
a) Fait individuel contre entités abstraites – Vom lebendigen zum vorgestellten Sprechen.
Jedem Menschen ist nach de Saussure die "Fähigkeit zur Rede", zur "langage", (de Saussure, 1967, S. 11) gleichsam natürlich gegeben. Im Sprechen begegnet dem Sprechenden diese "faculté de langage"; sie offenbart sich im Sprechen und begeleitet es gleichsam als "physischer, psychischer und physiologischer" Hintergrund. Vom lebendigen Akt des Sprechens kann auf diese Fähigkeit zum Sprechen reflektiert werden. Darin erschöpft sich allerdings nicht die Bestimmung des Sprechens, das dann als tautologische Verdopplung stünde; es ist nicht bloß vermöge eines Vermögens. Im Akt des Sprechens stellt sich mehr vor, als ein von den Stimmorganen gestalteter Laut, der im Atem strömt und im Ohr, das den Laut birgt, sich als Klang ereignet.
Der artikulierte Laut im Sprechen (die "zusammengesetzte akustisch-stimmliche Einheit", ders., aaO, S. 10) ist immer der "Ausdruck" eines Gedankens (einer "Idee", S. 19); der Laut, vom Sprechwerkzeug "gegeben" und vom Ohr "genommen" (vernommen), wird als etwas "Geistiges" (S. 10) gedeutet. Der Laut ist für de Saussure eine "physiologische und psychologische" Einheit, in der Geist steckt, der den Laut damit, über die biologische Tatsache hinaus, zur Sprache erhebt. Der Laut wird im Sprechen zu einem Ensemble von Lauten zusammengefaßt; maßgebend hierfür ist ein "Norm" (S. 11), die das Sprechen zu einem "System organisiert" (S. 15). Dies Organisieren verdankt sich einer geistigen Kraft, die im individuellen Sprechen etwas Nicht-Individuelles "einregistriert" (S. 16); die sprechende Person bringt in seinen Worten einen "Code" (S. 16) zur Anwendung. Das System geordneter Laute (Silben, Wörter, Sätze, Texte) nennt de Saussure "langue"; hierin verschränken sich Individualität und Sozialität (fait sociale) in einem "Kreislauf des Sprechens", das "parole" genannt wird (S. 13). Geist bestimmt de Saussure in seiner Wirkung; das individuelle Sprechen wird zur geordneten Rede. Welche Regeln haben dabei zu gelten? Ist Geist die soziale Vermittlung des vereinzelten Sprechers zum individuellen Redner? Ist Geist das Relative der Konvention?
Es gibt bei de Saussure die qualitative Differenz im Sprechen, die eines regellosen und eines geregelten Sprechens. Ist das anarchische Sprechen geistlos? Besitzt nur die einem anerkannten Gesetz folgende Rede Geist - das Sprechen nach Kategorien, grch. kategoria, agoreúein, sagen und agorá, Markt - also die auf dem Markt zu findende öffentliche Rede? Das System Sprache (langue) ist nur aus der lebendigen Rede, dem Sprechen (parole), zu destillieren. Umgekehrt ist die parole nur möglich aufgrund der langue. Auf diese widersprüchliche Bestimmung gründet de Saussure seinen Begriff der Sprache: Sie ist als Code, als "Vorschrift" dem Sprechen vorausgesetzt, gleichzeitig aber als Integral der lebendigen Rede zu denken, also nur aus dem bereits vorgängigen Sprechen heraus zu entwickeln. Die Regel ist der Grund des Sprechens, aber nur im Nachhinein, aus der bereits aktuellen Artikulation heraus, kann auf ihn geschlossen werden. Als Resümee soll festgehalten werden: Langue und parole stehen zueinander in einem komplexen Verhältnis wechselseitiger Bedingtheit, neudeutsch: sie bilden einen Rückkoppelungskreis, was eine (verschleiernde) Formulierung für jenen Widerspruch ist und damit zunächst nicht weiter hilft.
Also noch einmal gedacht: Die Sprachwissenschaft beugt sich immer über die lebendige Tätigkeit sprechender Menschen und unterstellt bei ihnen eine "faculté de langage", eine Gabe zur Rede. Das lebendige Sprechen, die parole (fait individuel) ist immer in das Soziale (fait social) eingebettet. In der sozialen Vermittlung der sprechenden Individuen ereignet sich die Codierung der Rede, sie wird als codierte Rede zur Sprache (langue).
"Die Sprache ist nicht die Funktion der sprechenden Person; sie ist das Produkt, welches das Individuum in passiver Weise einregistriert."(ders., aaO, S. 16)
Langue ist die Sprache dann, wenn das „konkrete" Sprechen, de Saussures „parole“, innerhalb einer sprachwissenschaftlichen Perspektive als ein spezifisch vermitteltes gesetzt wird. Im Sprechen geschieht etwas, das dem Sprechenden nicht bewußt ist; er "setzt niemals eine vorherige Überlegung voraus" (S. 16), um dann erst zum Akt überzugehen. Kann demfolgend gesagt werden: Nicht ich spreche, sondern: es spricht? Ist das einzigartige Sprechen eines unvergleichlichen, einmaligen Sprechens das Mittel zum Zweck eines allgemeinen Sprechens, das gleichsam aus den Wolken kommt? Gilt dies allgemeine Sprechen im "Wolkenkuckucksheim" und wird vom konkret Sprechenden gefordert? Pocht im konkreten Sprechen Antithetisches? Geschieht die parole immer in der Krisis, in einer Situation, die für den konkreten Sprecher zur normativen Bedrängnis führt, führen muss?
Die Sprache, als ein geordnetes System, wird aus der Empirie des Sprechens heraus erschlossen und ist zugleich unabhängig davon. Ein Aphasiker versteht noch die Sprache als geordnete Symbolwelt, obwohl er seine Fähigkeit zum Sprechen schon verloren hat. Und weiter: In der Schrift kann die Artikulation, das Sprechen in geordneten Segmenten, dargestellt werden. Ein diskretes Teilchen, articulus, eine Element der Sprache (langue) kann identifiziert werden, als punktuelle Stelle im Raum (...hier!) und als momentaner Klang in der Zeit (...jetzt!), was allerdings, aufgrund der inneren Verschränktheit von Raum und Zeit, zum Problem wird. de Saussure kennt dies Problem: Die Vorgänge des Sprechens können "nicht in konventionellen Bildern fixiert werden" (S. 18). Das konkrete Sprechen kann in kein Bild, das statisch ist, fest steht, gebracht werden; die parole ereignet sich, sie vergeht in der Zeit. Was vom Sprechen übrig bleibt ist ein geheimnisvoller Nachklang im Fühlen, Denken und Handeln des Hörenden. Die Schrift versucht den Klang des konkreten Sprechens im Zeichen, signe, "greifbar" zu machen, gleichsam zu photographieren (S. 18). Das Problem der Raum-Zeitlichkeit des Gesprochenen, die Unmöglichkeit zur diskreten Einheit des Klangs, versucht de Sausssure in der Dichotomie des Begriffs "Lautbild", image acoustique (S. 18) zu denken. Laut und Bild: Das Eine ist Zwei, Ich bin Wir. Zweigeteilt ist das LautBild insofern, als das Auditive, das im konkreten Sprechen anwesend ist, gleichsam hic et nunc, einen anderen Modus darstellt als das Visuelle, das im Klang des Gesprochenen abwesend ist. Es ist aber nicht "nothing", ein Nichts; es ist abwesend im Anwesenden.
Der Klang im Sprechen ist gleichzeitig da und nicht da, plötzlich, im Moment anwesend und wieder abwesend. Er ist das Sinnbild der Vergänglichkeit, des Vergehens, der Bewegung. Sollte er fixiert werden, wäre er nicht mehr der Klang, sondern ein Zeichen, das für den Klang stünde, aliquid stat pro aliquo (Augustinus). Als Laut wäre er das Zeichen für das verschwindende Erklingen des Sprechens. Fixiert auf einen isolierten, diskreten Klang-Punkt ergäbe er das Phonem, das so immer ein Bild vom Lautlichen/Klanglichen wäre. Vom konkreten Sprechen, das als klangliches Ereignis immer ein vergängliches ist, abstrahiert de Saussure. Den Klang des Gesprochenen, seine Zeitlichkeit, verräumlicht er, verwandelt er in ein Bild, das er dann auf den Klang zurück biegt, der jetzt, als fixiertes Bild, zum "Phonem" (S. 18) wird, zum isolierten, diskreten Laut-Teil, dem Klang-Punkt, der wiederum, auf der Linie sukzessiv geordnet, das Konstrukt der langue stiftet, die, in die Fläche projiziert, die Figurenwelt der Schrift entwirft. Orientiert sich das LautBild der langue am Bild der Schrift? Im diskreten Teil, dem verräumlichten Klang des Gesprochenen, ist etwas festgestellt, was nicht zu stellen ist, ist etwas vergegenwärtigt, was abwesend nur sein kann.
"Übrigens sind die Zeichen der Sprache sozusagen greifbar; die Schrift kann sie in konventionellen Bildern fixieren, während es nicht möglich wäre, die Vorgänge des Sprechens in allen ihren Einzelheiten zu photographieren. (...) In der Sprache (langue) dagegen gibt es nur das Lautbild, image acoustique, und dieses läßt sich in ein dauerndes visuelles Bild überführen. Denn wenn man von der Menge der Bewegungen absieht, die erforderlich sind, um es im Sprechen zu verwirklichen, ist jedes Lautbild, wie wir sehen werden, nur die Summe aus einer begrenzten Zahl von Elementen oder Lauten, Phonemen, die ihrerseits durch eine entsprechende Zahl von Zeichen in der Schrift vergegenwärtigt werden können."(ders., aaO, S. 18)