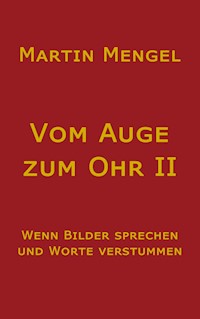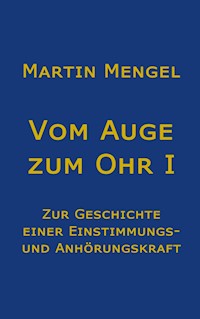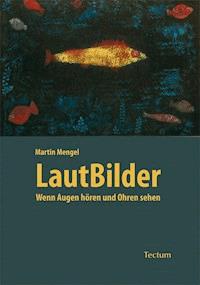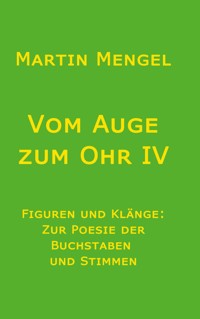
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Vom Auge zum Ohr
- Sprache: Deutsch
Im 4. Teil der Reihe "Vom Auge zum Ohr" stehen Laute und Buchstaben, Wörter und Sätze im Zentrum des Geschehens. Doch sollen sie nicht als äußere Formen, als Figuren, Zeichen, als Bilder "angeschaut" und gedacht werden. Es sind keine Spiegel, die die Welt abbilden. Durch sie soll auch nicht "hindurchgegangen" werden kann, um dann lediglich umgekehrte Bilderwelten zu eröffnen. Vielmehr sollen in den Bilderwelten der Buchstaben Klangwelten gespürt werden. Es geht um Spuren, die bereits da sind und etwas bekunden und es geht um ein Spüren, das etwas erkundet. Qualitäten sind im Figürlichen verborgen, sie zittern und beben. Es sind auratisch- poetisch übervolle Stimmen, die erschwungen, ersungen und erhört, die vernommen werden können. Die figürlichen Zeichen öffnen sich. In ihnen klingen Stimmen, die aus fernen Mündern kommen und ins horchende Ohr wehen. Ihr Verkünden ereignet sich euphorisch in einer unmittelbaren Resonanz. Mensch und Ding werden hier gleichsam ins Leben gerufen. Die Welt schwingt im Klang, bevor sie buchstäblich wird. Es kommt darauf an, seinen Spuren, die im Wind wehen, zu folgen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Max und Lotte
Mein besonderer Dank gilt meiner lieben Frau
Wertvolle Hinweise gab, wie immer, Rüdiger Richter
Inhaltsverzeichnis
A Das Kind und die Buchstaben – Liliput und die Sprache
a) Die Buchstaben träumten, sie sängen – Die Figuren
Exkurs:
Experimenrum crucis I – horizontal/vertikal
b) Das Runde – Lesen und Schmecken
c) Das Kleine – Wärmestrom und Klang
d) Das Große – Schwanenrufe
e) Das Unermeßliche – Im Anderswo
f) Das Musikalische – Übertönungen
g) Die Ecken – Verstecken
h) Die Macht – Atmen
Exkurs:
Arthur Rimbaud und Ernst Jünger
B Die Koordinationen des Lautbildes
a) Janusköpfiges – Farbenbäder im Labyrinth des Ohres
b) Leibhaftiges – Halbdinge melden sich
c) Systemisches – Unscharfes und Undurchsichtiges
d) Atmosphärisches – Stimmungen
e) Onduliertes – Verschleierungen
f) Synästhetisches – Klanghäute
C Das Kind und das Wort – Offene Grenzen und rhythmische Überlagerungen
a) Überdeutliches und Überklares – Ausgefranste Ränder
a)a Das Thomas- Theorem – „self- fullfilling prophecy“
a)b Das Worttrommeln – Schlagende Gleichgültigkeiten
a)c Die Seligkeiten der Stimmen – „Septembermorgen“
a)d Das Schweigen – In der Luft nach Wörtern graben
a)e Wirklicher als das Wirkliche – Überschreitungen
a)f Das vorgegebene Wort – Schweigen
a)g Überschäumende Wörter – Unmögliches
b) Takt und Rhythmus – Zerteilen und Gestalten
b)a Der Takt – Schlagen und Stoßen
b)b Der Rhythmus – Fließen und Stauen
b)c Paradoxa – Kastanien, Sandkörner und Wasserwellen
b)d Die Stetigkeit der Bewegungen – Wachen und Schlafen
b)e Wiederholen und Erneuern – Stellen und Schwingen
b)f Rhythmus und Polarität – Vergehen und Wiederkommen
c) Das Metrum
c)a Inspirationen und Schonungen – Atmen
c)b Trochäus und Jambus – Sprechen
d) Prosodie – Singen
d)a Die Silbe – Schweres und Leichtes
d)b Die Klangfülle der Laute – Volles A und leichtes P
d)c Betonung uhd Silbengewicht – Onsets und Moras
d)d Quantitätssensitive Füße – Minimal und Supraminimal
d)e Das dritte Ohr – Schwellen und Biegen
d)f Die gleichschwebende Aufmerksamkeit – Überraschungen
d)g Die rauhe Stimme – Unmögliche Erzählungen
d)h Sprechen und Artikulieren – Situationen
d)i Sprechende Blitzlichtgewitter – Schwindende Sinne
D Das Improvisieren – Sprachkonsens und Ausschluß
a) Mit den Buchstaben spielen – Neuschaffen
b) Das anwesende Kind – Verzaubern
c) Das forschende Kind – Können
d) Alles hat seine Zeit – Gedeihen
e) Zusammenfassung – Verwandlungen
E Anhang
F Literaturverzeichnis
Marc Chagall, Le Cirque bleu, o. J.
A Das Kind und die Buchstaben – Vom liliputanischen Denken und Sprechen
Dr. Lemuel Gulliver überlebt ein Schiffunglück und wacht am Strand des Landes Liliput auf. Die Bewohner dieser Insel sind viel kleiner als er, genau zwölfmal kleiner – und, anstatt ihn zu begrüßen, versuchen sie, nachdem sie ihn entdeckt haben, ihm sofort Fesseln anzulegen, was ihnen aber nur schwer gelingt. Überhaupt ereignen sich in diesem Zwergenland eigenartige Dinge. Am merkwürdigsten ist der sinnlose Krieg, den die Liliputaner mit ihren Nachbarn führen: Sie streiten sich darüber, wie ein gekochtes Ei korrekt aufzuschlagen sei.
Das gewissermaßen nanologische Denken der Liliputaner ist dem Erwachsenen Gulliver nur schwer zugänglich. Die Liliputaner scheinen sich in absurden Spielen zu verschwenden. Umgekehrt erleben sie den „Menschenberg“ wie eine Fata Morgana. Die beiden Welten, das Große und das Kleine, passen nicht zueinander. Die gleichsam makroskopische Erfahrung der sogenannten Wirklichkeit, in der Sachverhalte aus unmittelbaren Raum-und Zeiterfahrungen und kategorialen, mathematisch strukturierten Setzungen schematisch- systematisch konstruiert werden, scheint nicht zu den mikroskopischen Figurationen zu passen. Was wäre, wenn Makro- und Mikroskopisches sich über das Phonische fänden? Wenn in ihnen Entsprechungen zitterten? Entsprechungen „vermählten“ die Unterschiede im Klingen. Makrophonisches und Mikrophonisches kämen in einer poetisch- magisch aufgeladenen Sprache zusammen.
«Correspondances La nature est un temple où de vivants piliers Laissent parfais sortir de confuses paroles L' homme y passe à travers des fôrets de symboles Qui l' observent avec des regards familiers.
Comme de longs échos qui de loin se confondent Dans une ténébreuse et pro fonde unité Vaste comme la nuit et comme la clarté Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. » (…) (Charles Baudelaire, Les fleurs du mal)
„Entsprechungen Die Natur ist ein Tempel, wo aus lebendigen Pfeilern zuweilen wirre Worte dringen; der Mensch geht durch die Wälder von Symbolen, die ihn betrachten mit vertrauten Blicken.
Wie langer Hall und Widerhall die fern vernommen eine finstere und tiefe Einheit schmelzen, weit wie die Nacht und wie die Helle, antworten die Düfte, Farben und Töne einander.“(…) (Charles Baudelaire; Die Blumen des Bösen, übersetzt von Friedhelm Kemp, Frankfurt 1966)
Farben, Düfte und Töne „antworten einander“, sie sind verwoben in magischen Taten, dicht und auch weit, „vaste“. Sie können nicht gesehen werden, auch nicht begriffen, doch schwingen sie in eindringlichen Empfindungen, im Lauschen und Horchen, im erregten Geist, der in die Ewigkeiten der Wörter hinüberweht, im Beben und Zittern des Körpers. Moschus und Weihrauch singen die Verzückungen des Geistes und der Sinne: „le muscet l' encens chantent les transports de l' esprit et des sens.“
Liliput kann auch Atlantis heißen, oder Böhmen am Meer oder Avalon und Camelot: Es sind ortlose Orte, nebelverhangen, verborgen, voller Magie: Adynata (altgriechisch: adynatos, deutsch: unmöglich) im Zentrum des Notwendigen. Die notwendigen Topoi erleben ihre Umstülpungen ins Utopische. Im Utopischen schwingen die unmöglichen, die poetischen
Verdichtungen und Verschiebungen. Es klingen die Welten? Böhmen liegt doch am Meer, im Utopischen, denkbar, aber nicht zu verorten, nicht darstellbar. Aber hörbar?
Für die Liliputaner ist ihre aus Gullivers Sicht verrückte, utopische, unmögliche Kultur immer sinnvoll: Sie ist durchdrungen vom spielerischen Gegensinn, von den poetischen Verwandlungen. Was auf Gulliver komisch wirkt, erfüllt die Liliputaner mit einem tiefen Ernst. Nebensächliches ist Bedeutsam, Gerades ist krumm – wie im Traum.
a) Den Buchstaben träumte, sie sängen – Von den Mächten des Figürlichen
„A, E, I, O, U – der Mund geht immer weiter zu.“ (Kinderspruch)
„Ooooooooooooooooooooooooooooooo (leise) Bee bee bee bee bee --- --- --- Ooooooooooooooooooooooooooooooo Zee zee zee zee zee --- --- --- Ooooooooooooooooooooooooooooooo Rinnzekete --- bee ---bee Ooooooooooooooooooooooooooooooo änn ze --- ---änn ze --- --- Ooooooooooooooooooooooooooooooo Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (laut) Bee bee bee bee bee.“ (….) (Kurt Schwitters, Ursonate, zweiter Teil, largo)
Das Kind liest die figürlichen Zeichen, die Buchstaben genannt werden und deren einzelne Formen einen Namen besitzen: das O, das A usw. In diesem Buch stehen nicht die Laute und Buchstaben als Zeichen im Zentrum des Geschehens. Vielmehr soll durch ihre “bloßen äußeren Formen“, ihr Figürliches, Anschauliches, durch ihren Bildcharakter, gleichsam hindurch gegangen werden.
(Lewis Caroll, Alice hinter den Spiegeln, S. 54, 1974)
Zu erinnern ist an Alice, die durch einen Spiegel hindurch geht und sich dann in einer „anderen“ Welt wiederfindet. Eine märchenhafte „Landschaft“ eröffnet sich ihr. Die Dinge sind übervoll mit atmosphärischen Ein- und Ausflüssen, ineinander verwobenen Synästhesien, die allerdings im anschaulichkategorialen Kreis eingeschlossen bleiben, denn: Alice kann (nur) im Modus von Ja und Nein darüber sprechen, in klaren und deutlichen Worten, in Unterscheidungen, die ehern das „tertium non datur“ formulieren. Hinter den Spiegeln erscheinen neue Wort- Bilder, immer wieder neue Wort-Bilder. Sie bleiben im Binären: Sie kennen das Schnelle und das Langsame, das Große und das Kleine, das Laute und das Leise. Zwar eröffnet sich in entscheidenden Situationen der Non-Sens, wenn alles, was ist, auch das Gegenteil von dem ist, was es ist. Je schneller Alice einen sonderbaren Hügel auf direktem Weg zu erreichen versucht, desto weiter entrückt er ihr. Schlägt sie die entgegengesetzte Richtung ein, wählt sie Umwege, dann kann sie ihn schnell erklimmen. Die Schwarze Königin formuliert das Bewegungsgesetz der Welt hinter den Spiegeln: „Hierzulande mußt du so schnell rennen, wie du kannst, wenn du am gleichen Fleck bleiben willst.“ Den unerschütterlichen logischen Gesetzmäßigkeiten ist Alice aber auch im Non- Sens ausgeliefert. Die Ordnung der Dinge wird auf den Kopf gestellt und bleibt so doch, ex negativo, immer im Bilde.
Alice ist einer totalen Faktizität der Bilder ausgeliefert, in der ausschließlich positive oder negative Selbstreferenzen produziert werden. Es sind endlose Rekursionen, unaufhörliche Rückläufe in das Selbe. Hier gilt das oberste Gebot: Regeln werden immer wieder auf ein Objekt angewendet, das sie selbst erzeugt haben. Non- Sens Sätze wie „Je mehr Sichtbares, desto mehr Unsichtbares“ oder „Je mehr Hier desto mehr Dort“ werden ohne Herzschlag und Atem gesprochen. Es sind chiasmatische Wiederholungen des Immergleichen. Überkreuzstellungen geschehen gewaltsam. Lebendige Körper, die rhythmisch, atmend, endlich sprechen, sind auch im Non- Sens ausgeschlossen. Im Non- Sens triumphiert die Anwesenheit der Bilder. Bilder schließen immer ein oder aus. Die totalitäre Präsenz der Bilder setzt die Absenz der einmaligen, nicht im homogenen Feld feststellbaren unvergleichbaren Körper aus beseeltem Fleisch und Blut. In der totalitären Bilderwelt, vor und hinter den Spiegeln, ist immer das Selbe zu sehen. Hier gibt es kein Anfangen und wieder Aufhören, nicht das Eine und das Andere. Das Leben findet in einer Bilderhöhle statt, es steht fest am immergleichen Ort: stásis, die Stelle, statio, der Standort. In der Bilderhöhle kann das Leben nicht spielen, zufällig sich ereignen, unmöglich und wirklich zugleich sein, nicht nur ins Entweder – Oder eingespannt. Das totalitäre Imaginäre kennt kein Spüren, kein Hören, kennt nicht die Überschreitungen, die durch die Haut des lebendigen Körpers kommen und gehen. Das Imaginäre kennt nur die Oberflächen der Bilder. Die Berührungen der Bildflächen sind steril, leer, formal. Im absurden Theater der sterilen Handhabungen elektronischer Apparaturen steigern sich die künstlichen Berührungen maßlos. Hier gilt der Satz: Je mehr Berührungen, desto weniger wirkliche Körper. Das Wischen über Bildschirme stiftet keine wirklichen Berührungen: Noli me tangere. Don’t touch me. Flächen kennen keine lebendigen Körper, nur die Illusionen der Körper. Das Imaginäre kennt auch keine Stimmen, keine Rufe und Erhörungen. Die Rufe der Stimmen, das Hören der Stimmen, sie sind geborgen in den Worten und im Herzschlag der „Mutter“. Sie sind nicht „objektiv“, nach vorne geworfen, hingestellt, festgestellt, eher „circumjektiv“, umgebend, umhüllend. Sie leben in ihren Berührungen.
Dies Buch will nicht Bilder, sondern Klänge finden, Klangspuren entdecken, die auch in den aufgeschriebenen Wörtern zu vernehmen sind. Jedes klingende Wort ist umgeben mit auratisch- poetischen Stimmen, die Lieder aus „fernen“ Landen singen und in dem, der sie spricht, singt und hört, Resonanzen voller Aufladungen, Neuschöpfungen und „Überschreitungen“ stiftet. Diese Resonanzen gilt es auch im Buchstaben zu verspüren. Spuren finden heißt immer auch, im Vibrieren des Spürens, des Berührens zu sein. In den Berührungen klingt die Aura der Dinge. Im auratischen Klang, im poetischen Lufthauch der benannten Dinge, erscheint keine „Ferne, so nah sie auch sein mag“ (Walter Benjamin). Vielmehr sind Hörer und Sänger, Lauscher und Verkünder unmittelbar in einer Resonanz. Im Sprechen und Hören werden Mensch und Ding gleichsam ins Leben gerufen. Im Klang sind Ruf und Echo immer beisammen. Im Klang gibt es keine narzißtischen Autismen. Es klingt die Welt, bevor Worte und Bilder dafür gefunden werden. Wie kann das Flüstern, das Sprechen, das Singen der Buchstaben, Wörter und Sätze erhört werden?
In den folgenden Zeilen soll erzählt werden von
den „Ausstrahlungen“ eines Dings, hier des Buchstabens,
den „Einstrahlungen“ dieses Buchstabens im Kind,
seinen Verwandlungen in „Stimmungen“,
den „träumenden“ Hingaben des Kindes, seinen „Anhörungen“,
dem Einatmen, in und mit dem das Kind in die Farben, Klänge, Gerüche usw. des Buchstabens einschwingt und
dem Ausatmen, in dem sich all dies in klingenden Stimmen „sublimiert“, in das wundersame, zauberhafte Sprechen.
Exkurs: experimentum crucis I – Vom horizontalen und vertikalen Richten
Jeder Buchstabenfigur wohnt eine eigentümliche Dynamik inne, eine Kraft nicht nur, eher eine Macht. Wäre es nur eine Kraft, dann dehnte sich die Form in einer typischen Weise, dann wäre sie gespannt, verkrampft, wie die zwei Linien, deren horizontales und vertikales Drängen, ihr Richten, im Kreuz übereinandergespannt und so, im Kreuzpunkt, in höchster Verdichtung ihres Drängens, in eins gelegt und gehalten werden. experimentum crucis: Hier winden sich die Richtungen, die Ziele, hier verkrampfen sich gleichsam die Muskeln, die bestimmte Verrichtungen vollführen wollen. Hier wird hingerichtet, in den Galgenformen, den gekreuzigten Linien, den Vorrichtungen zum Hinrichten.
Die Buchstabenform ist nicht über Kreuz gelegt. Sie besitzt vielmehr ein Vermögen zur Erregung, zum Pendeln und Schwingen im Räumlichen und Zeitlichen. Die Macht besteht darin, dass ihre Linien in verschiedene Richtungen fliehen und – wie von einer unsichtbaren spielenden Hand, die keine lesende ist, geleitet – immer wieder auf eine „schöne“ Mittellage zurückkommen. Die Macht der Figur ist ein Mögen, ein Pendeln, ein Schwingen um eine Ideallinie. Um diese Linie, die nirgends wirklich ist, schwärmt die Figur des Buchstabens – tanzend, springend, leichtfüßig, künstlerisch. Sie mag dies alles, sie ist vermögend. Sie erregt, bewegt denjenigen, der sie „betrachtet“. Dies Betrachten geschieht nicht sehenden Auges. Es ist kein Lesen. Die Augenhände sind nicht mit dem Ernst der Arbeit dabei, die Formen zu erfassen, aufzulesen, zusammenzulesen. Die Formen sind nicht geometrisch erregend, nicht in ihrer reinen Linienführung. Sie schwingen vielmehr in ihren Umkehrungen und Umstülpungen – in ihren poetischen Verschiebungen und Überlagerungen, in ihren plastischen Verformungen. Dies Schwingen offenbart die Qualität jener Macht, die im Buchstaben pulsierend wirkt. Es ist die Macht des schöpferischen Tuns, der zeugenden Tat, die keine willentlich gesteuerte Handlung ist, des „spielerischen“ Geschehens, das immer aktuell ist, akut, unvermittelt, scharf, spitz, ohne zu verletzen, das plötzlich um die Ecke kommt, aber niemand um die Ecke bringt – in nuce: es ist die Macht des Poetischen im Buchstaben.
Das kreisförmige O flieht nicht, wenn es seine poetischkringelnden Mächte „atmosphärisch“ ausbreitet, in algebraisch gleichen Größen von seinem Mittelpunkt weg. Als geometrisches Gebilde ist der runde Buchstabe leer. Seine Kontur, seine Einfassung ist gleichsam durchsichtig, nicht fassbar, berührbar. Das Gebilde besitzt kein Kolorit, was so viel heißt wie: es hat keine Färbung erfahren, es hat keinen Schwung und kann so auch keinen geben, kann so nicht anderswo hinüberschwingen. Als pure geometrische Erscheinung ist das O hüllenlos: Es verhehlt nichts, er birgt nichts, es bietet keinen Schutz. Es ist nicht behelmt, okkult und so kann diese Wirkung auch nicht von ihm ausgehen.
Wenn die poetisch aufgeladene Macht im O wohnt, wenn das O – unterhalb seiner reinen Geometrizität, seiner puren Figürlichkeit – phantastische Schätze birgt, wenn es gleichsam ein Haus voller Unmöglichkeiten ist, dann können die „erlebt“ werden – dann, wenn sich jemand darauf einläßt, wenn er durch das Nadelöhr hindurch in eine Welt hinüberwandert, in der alles ins Unermessliche ausschwingt, in der die „Zahlen und Figuren“ sich weiten und dehnen und schließlich aus ihren Formen hinausfliehen, sich häuten und in Klänge verwandeln – die auf den Zungen tanzen, die den Gaumen entlang streicheln, die an den Zähnen kitzeln, die gestimmt aus den Mündern wehen. Durch das Nadelöhr des Buchstabens gelangt das poetisch- lesende Kind in Welt der Klänge, die nicht aus dem Buchstaben zurückströmen, die den Weg über das Kind nehmen, die in ihm leibhaftig werden und in seinem Sprechen schwingen.
Wenn das Kind poetisch in die Buchstaben einschwingt, dann können jene Unmöglichkeiten erlebt werden:
Das O breitet um sich Wärme aus und bietet hier Schutz.
Es schwingt in den Sphären des Ganzen, Gesunden, Heilen, Großen, Bedeutenden, Glücklichen. Es stiftet Vertrautheiten, Geborgenheiten, Heimat.
Es scheint nicht nur ein Haus zu sein. Für den, der „träumend“ sich auf die Macht des O einlässt, einschwingt, der seinen Anmutungen vertraut, für den
ist
das O ein reales Haus, mit allen Annehmlichkeiten des
Runden,
Warmen, Wohligen, Sicheren.
Das O klingt aus heimlichen, verborgenen Rätseln herüber, aus den Geheimnissen, wo noch keiner sein Lager aufschlagen konnte. Die Geheimnisse sind gleichsam im Heim des O konzentriert. Sie sind in der Miniatur. Das Kind denkt nanologisch. Es betritt ein mysteriöses Land Liliput. Für es ist dies Land im Kleinen real und mit großem Ernst verbunden und eröffnet ihm ein ungeahntes Feld, ein Klingen unmöglicher Dinge. Im Kleinen ist Großes geborgen. Es wartet auf die Erkundungen des neugierigen Kindes. Das neugierige Kind ist träumerisch empfänglich und hört und beobachtet feinsinnig. Seine Genialität besteht darin, alle Sinne beisammen zu haben – nicht darin, zu spalten, zu beschränken, um dann wieder alles zu einem Stoff zusammenzukleben. Ist der eine Sinn scharf, der andere stumpf, dann bedeutet dies, daß diese Sonderung auf Kosten des ganzen Sinnes geht. Der geschärfte Sinn läßt den anderen schwinden. Träumend beugt das Kind dem Schwinden seiner Genialität vor: Es tanzt in regenbogenfarbigen Klängen, die keine Oberflächen sind. Im regenbogenfarbenen Klang schwingen die Tiefen geheimnisvoller Welten. Das Kind träumt und ist so nuanciert im Geheimnis: Es empfindet, es fühlt, es ist sensual; es ist doppelt, doppelsinnig, körperlich und geistig; es spielt; sein „abenteuerliches Herz“ (Ernst Jünger) durchpulst den Wärmestrom seines kleinen Körpers; es lauscht mit seinem dritten Ohr...
Träumend begibt sich das Kind in die Welt des O, nicht lesend mit seinen Augenhänden – wie es die Konvention versteht. Das Kind ist ein Worte- Träumer, kein Worte-Leser und Worte-Macher. Es liest träumend – verwandelnd, sonnend, mondend, stromend, zahlloszweigend... Das Kind spricht gleichsam mit dem O – indem es mit ihm spielt. Es hört, es sieht, es schmeckt, es berührt. Es genießt das O und anerkennt, wertschätzt damit dessen Fülle. Das Kind ist dann rund, genauso rund, wie das O, das mehr ist, als nur in seiner Oberfläche, im Figürlichen zu sein... Das Kind träumt die verborgenen klingenden Schätze des Buchstabens, es lauscht seinen Geheimnissen, es schmeckt sie – und es schmeckt sich so selbst. Es vernimmt die Klänge im poetisch geöffneten Buchstaben; es verschlingt die diskreten Teilungen, die atomisierten Formen, es verschlingt sich gleichsam selbst, wie die Schlange im Märchen – und schmeckt sich dabei selbst, und eben die in den Klang verwandelten Figuren. Es schmeckt sich und die Buchstaben, es schmeckt die Verwandlungen.
b) Das Runde – Den Buchstaben lesen wie den Geschmack einer Frucht genießen
Welche Ruhe liegt für einen Träumer in den Worten – in denen, die in ihrem Kern ein O besitzen!
Welche Ruhe liegt in dem Buchstaben O, den das Kind träumend liest! – Doch zunächst: Der Buchstabe O will fix, will im Trockenen bleiben, an seiner Form festhalten, sich gegen die anderen Formen behaupten, sich in Raum und Zeit erhalten. Er will gleichsam unter der Sonne austrocknen, zum Dörrobst werden. Er will als eine elementare Substanz aufgefasst werden, die konstant bleibt im Wechsel der Erscheinungen, im Widerstreit mit den anderen Buchstaben, die um die Stellen des Wirklichen konkurrieren. Was von der Substanz handelt, dem seit Aristoteles gültigen Grund des realistischen Denkens, mit seinem Wesenszug der Erhaltung in der Kausalität, das ist von bedrohlich aufgewühlter Beschaffenheit charakterisiert. Wenn die Substanz des O aber in sich aufgewühlt ist, nach Auflösungen drängt, warum ist das O dann ruhig, wie eine alterslose Substanz, die es doch nicht sein kann, weil die Substanz sich unaufhörlich in andere Substanzen zu verwandeln bemüht? – Aristoteles, der mächtige Apologet des Substanzbegriffs, muß, um ihn zu retten, eine erste, zweite dritte Substanz konstruieren, theoretisch unendliche Substanzen erfinden, die das Denken immer dann, wenn es sich in festen Sätzen äußert, zum Verschwinden dieser Sätze drängen. Die äußere Ruhe, die die Substanz ausstrahlt, ist trügerisch. In ihrem Innern drängt sich alles in einem infiniten Geschehen des Zerteilens und Auflösens.
Zum Wesen eines als elementare Substanz gesetzten Dings schreibt Gaston Bachelard:
„Sein substantieller Wert in seiner ganzen Offenheit, Klarheit, Einfachheit scheint Phasen der Trägheit, des Wegtauchens, des Verschwindens zu unterliegen. (Das Ding, M. M.) bleibt nicht erhalten. Es entzieht sich der Kategorie der Erhaltung.“ (G. Bachelard, 1978, S. 79)
Er bezieht seine Aussage auf Dinge der Mikrophysik. In der Heisenbergschen Relation der Unschärfe ist die paradoxe Beschaffenheit des substanziellen, sich in Raum und Zeit erhaltenden Dings formuliert. Das Ding ist nicht einfach da oder nicht da. Es oszilliert zwischen seinen Stellen und Bewegungen. Das Ding, als substantieller Wert präfiguriert, ist vor seiner Form, wird zu einer „Summe von Zusammenstößen“, die sich wechselseitig aufheben und negieren.
Das O in seiner graphologischen und phonologischen Form, selbst in seiner phonischen, ist – wenn der poetischepistemologische Sprung erlaubt sein darf – ebenfalls präfiguriert: Es besitzt seine Identität, es stiftet hieraus seine Differenz und schließt die, die als Dritte an seine Stelle treten können und wollen, radikal aus. Es immunisiert sich.
Das träumend- lesende Kind nun öffnet das Immunsystem der substanziellen Verortung und Verzeitung, indem es jetzt und hier dies O erspürt, sieht und hört und zu seinem Phantasie-Zeit- Raum erweitert, mit und in dem es selbst anschwillt, mit und in dem es sich vergrößert – nicht addiert, geometrisch oder algebraisch in seinem Umfang vermehrt, sondern unmittelbar in den Klang ausschwingt. Der Phantasie- Zeit-Raum des O ist – um ein Wort Baudelaires zu verwenden: vaste – also ausgedehnt, weitreichend, hochfliegend, riesenhaft, gewaltig, mächtig. Er pulsiert im Klang- Zeit- Raum, der nicht großartig und überwältigend ist – eher in seiner melodisch-harmonisch- rhythmischen Fülle anmutig- anmutend ist, lieblich- preisend, voller Grazie.
Das Kind weitet die formalen Größen, das Quantitative, dynamisch zu einem existenziellen Wert aus, zu einer Qualität, die im Klang schwingt, den das Kind wieder verlässt, aus dem es wieder heraustritt, wenn seine Phantasie neue Charakteristika des O, das im Klang schwimmt, vernimmt. Und doch soll in diesem Anschwellen, dem dynamischen Vergrößern und Verkleinern, dem An- und Abschwellen eine unendliche Ruhe liegen.
Der Erwachsene hält an dem einen Buchstaben O fest. Das O erscheint ihm, es bildet für ihn ein Phänomen, er nennt es ein Lautbild. Das Kind aber, um ein Gleichnis zu spinnen, lässt dies Phänomen, das ein Graphem/Phonem ist, ein image acoustique, das Kind also lässt es schweben und verwandelt es auf geheimnisvollen Wegen in einen Klang. Und noch mehr: Das Phänomen des Erwachsenen ist präfiguriert durch jenes substantielle Denken – mit Kant könnte formuliert werden, das Ding in der Erscheinung ist (bereits) nach einem Noumenon geformt. Nicht nur im Denken Werner Heisenbergs widersprechen aber die im Phänomen verborgenen Dinge den noumenalen Setzungen: Sie begehren, schon in den Hüllen des Phänomens, auf.
Das Kind, das das O träumend liest, vollbringt diese noumenalphänomenale Diskrepanz. Der Erwachsene erklärt ein Ding, indem er ihm noumenal – so, wie es eigentlich sein soll – widerspricht und es in ein Phänomen setzt: das Ding, das gleichsam nackt ist, in Kleider steckt. Das gedachte Ding soll das beobachtete Ding sein. Doch schlüpft es aus seinen Kleidern, in denen es beobachtet wird, heraus. Aus den Anschauungsformen und formal- logischen Setzungen bricht das Ding auf und begibt sich auf eine lange Wanderschaft, es fängt an zu tanzen und zu springen. Es durchbricht den ehernen Bannspruch des „natura non facit saltus“, es vibriert und zittert, es schwingt, es klingt.
Das formale Kontinuum des Erwachsenen, in dem der Buchstabe O immer konstant bleibt und sich diskret gegen andere Unterscheidungen stellt, stülpt sich in ein dynamisches Kontinuum um: Der Buchstabe wird unscharf, er löst sich auf, er schwingt hin und her und klingt dann im Unwägbaren, im Unermesslichen seiner Vielfalten. Seine Umhüllungen sind nicht mehr durchsichtig und brechen ins Leere; sie sind in viele Falten geworfen. Die vielen Falten im Umhang des O werden vom Kind nicht als „etwas“ und „nichts“ erlebt, sondern gleichsam außerhalb der Kategorien Identität, Differenz und Kausalität. Der mannigfaltige Umhang des Buchstabens weht in den Klängen, er fliegt und wird in das Land der Poesie getragen.
Die formale, substanzielle Logik verwandelt sich in eine poetische, die die dem Klingen ähnlichen „Dinge“ stiftet. Aber sie sind mehr als nur ähnlich: Assimilative und assoziative, also angleichende und zusammenschließende Verknüpfungen gelten nicht für die Metamorphosen der Figuren in Klänge. Der Buchstabe fängt an zu schwingen, er zittert und bebt, er löst sich auf, nicht in Fratzen und Masken, eher in schwungvolle Melodien, die im Wind wehen. Die poetisch verwandelten Buchstaben singen. Sie füllen das Kind mit ihrem unverwechselbaren Atem, es singt sie mit und in seinem einmaligen Luftstrom. Die Melodien, die das O singt, wenn das Kind es träumend, also innerlich hörend- sprechend liest, sind ineinander gewebt und vielfältig, sie fliegen in der luftigen Weite und sind im O doch wie in einer Nußschale geborgen. „O God, I could be bounded in a nutshell and count myself a king of infinite space, were it not that i have bad dreams“, so spricht William Shakespeares Hamlet, ein Erwachsener. Das Kind hat keine schlechten Träume. Es ist erfüllt von schönen Farben und vertrauter Musik, buntschillernd und klingend, je nach der phantastisch träumend- lesenden Gestimmtheit des Kindes. Im Kleinen der Nußschale ist ein ganzer Kosmos von Melodien und Rhythmen verborgen.
Die unermesslichen Melodien strömen im Atem des Kindes, sie wehen durch seinen Leib, sie streicheln seinen Gaumen, sie entführen in die Lust, die die Zunge tanzen lässt: Das Kind schmeckt diese Melodien, wenn es sie hört. Sie sind im süßen Klang des Eigensinns, des Singularen, ohne den bitteren Nachgeschmack des Allgemeinen, des Wirklichen, in dem die Notwendigkeiten und Möglichkeiten atemlos in ihren Substanzen und Kausalitäten treiben.
Mit den Worten Gaston Bachelards: „Substanz und Kausalität unterliegen zusammen einer Ekliptik.“ (ders., 1978, S. 80) Das O ist in einer scheinbaren Umlaufbahn im System der substanziell- kausalen Welt. Es ist nicht von der Zeit unabhängig. Es dreht sich in den Poesien des Kindes, die aus und in ihren eigenen Zeiten schöpfen und schmecken. Und gerade hierin, in dieser Ekliptik, liegt die Ruhe des Dings.
Mit anderen Worten: Das O ist mehr als seine geometrisch koordinierte Figürlichkeit. Es klingt und leuchtet und duftet und schmeckt und berührt – und übersteigt bzw. unterläuft die Leere, die seine Linien zu umhüllen versuchen. Die Linien des O sind, als pure Kontur, als Umriss, ohne Inhalt. Die Fülle des O, sein poetisches Surplus ist in der Ruhe seiner Wechsel, auch in der Erscheinung, dem Runden, dem Kreisförmigen, das einen ruhenden Kern zu besitzen scheint. Das O versammelt seine Welten um seinen Mittelpunkt, auf dem der Herd steht, in dem die Wärme des unaufhörlich pulsierenden polyphonen, polychromen Lebens glüht.
Das pur figürlich, geometrisch aufgefasste O ist leer. Das poetisch gelesene, gestimmte, gehörte, geträumte O ist in „der vollen Rundung“ (G. Bachelard, 1975, S. 265). Das Kind erlebt dies Runde in seinen verschiedenen Zeiten und ist so in seinen eigenen Rundungen: Das poetisch erlebte O verhilft dem Kind dazu, sich in sich und um sich selbst zu versammeln. Indem das Kind das O poetisch liest, gibt es sich, in der Resonanz mit den poetischen Stimmungen, seine Verfassung. Die Ruhe des O strahlt aus sich heraus und strahlt ein in die phantastische Welt des Kindes. Dies empfindet seine Rundung, wenn es die des O empfindet. Die Rundungen pulsieren aus einem Kern heraus in die Vielgestalten und Vielklänge der Umkreise.
Bachelard zitiert Rainer Maria Rilke, der in seinem Gedicht „Bangnis“ vom „runden Vogelruf“ erzählt. Wie ist das zu deuten? Eigentlich fliegt ja der Vogel wie ein Pfeil, auch sein Ruf ist in Gleichnissen des Spitzen und Schrillen zu sammeln – und doch ruht der Vogelruf bei Rilke:
„Und dennoch ruht der runde Vogelruf in dieser Weile, die ihn schuf, breit wie ein Himmel...“
Das ganze Himmelgewölbe ist in dem Vogelruf beheimatet, ist in ihm, im Kleinen versammelt. Der Ruf ist rund, er rundet die Welt, „das ganze Land scheint lautlos drin zu liegen, der große Wind scheint sich hineinzuschmiegen.“ Der laute Vogelruf ist rund, nicht spitz; in ihm ruht das ganze Land, er ist nicht flüchtig, zeitlich, eher ewig, in der Ruhe der Rundheit – und diese Ewigkeit schweigt. Schweigend ruht der Vogelruf und rundet zugleich den Himmel zur Kuppel und das Land zum Erdkreis. Erde und Himmel ruhen im Ruf der wiederum in ihnen ruht. Der Ruf stiftet seine eigene Geborgenheit, indem er sich seine Welt schafft, in der er ist und die in ihm ist. Ruhe und Bewegung, Schweigen und Gesang sind im Ruf des Vogels. Es sind dies keine Eigenschaften, die Rilke beschreibt. Es sind „Schwingungen“ im Rufen des Vogels, er genießt in diesem Schwingen die ganze Wölbung des Himmels und den Kreis der Erde, die er mit seinem Rufen zum Schwingen bringt, in denen er, geborgen in der Resonanz, selbst klingt. Er genießt seinen Ruf, wie den süßen Saft einer reifen Frucht. Der Vogel schmeckt sich in seinem Rufen.
Wieder soll ein phantastischer Sprung gewagt werden: Das Kind träumt sein O; es „empfindet“ die Qualitäten, die das O in seinen Anmutungen ausstrahlt. Es schmeckt sein O, das es hört, das es sieht, das es berührt. Das O ruht, weil es das Kind in seiner Vielfalt anstrahlt, in seinem Vielklang anläutet. Es ist unscharf, wenn es das eine O sein will, das diskret und substanziell immer gleich ist. So verbreitet es eine trügerische Ruhe. Es ist klar und deutlich, wie der Vollmond in einer Winternacht, wie die Melodie, die ergreifend schwingt, wenn es das runde O ist, das sich träumt, das das Kind träumt. Das O wird im träumenden Lesen des Kindes voll. Das O füllt das Kind und füllt sich so selbst. Das Kind füllt das O und füllt sich so selbst. Beide sind in ihren Ekstasen.
Noch einmal Gaston Bachelard: Das volle, runde O, vom Kind geträumt, ist wie ein alter Baum, in dessen mächtiger Krone sich der Kosmos wölbt. An seiner Peripherie tanzen tausend Blätter im launischen Spiel des Windes, der hier seine Lieder pfeift, glänzen tausend gebrochene Sonnenstrahlen – in denen der grünende, tanzende und singende Baum sich aber nicht verliert. Und doch genießt er die ferne Wölbung des Himmels in sich, er ist stolz gerundet.
Das O lebt, es denkt es streckt sich dem Kind entgegen, wie die Äste und Blätter jenes Baumes sich dem Wind „hingeben“. Es ruft das Kind mit tausend Stimmen und singt Lieder in tausend Melodien. Wie der Baum. Das O erschafft sich unaufhörlich im träumenden Lesen des Kindes. Es lebt in seinen Verwandlungen und erleidet dennoch keine Auflösung seiner „stolzen Rundung“. „Hier hat das Werden tausend Formen, tausend Blätter, aber das Dasein erleidet keine Zerstreuung.“ (ders., 1975, S. 271)
c) Das Kleine – Vom Wärmestrom klingender Figuren
Im Buchstaben O pulsieren Mächte, die die geometrische Gestalt entgrenzen. Im Innern seiner Rundung, die im Kleinen sich ausdehnt, erlebt das träumend- lesende Kind eine unermessliche Welt. Der Kern dieser neuen, poetisch aufgeladenen Welt hat für das sensible Kind einen solch hohen Wert, das es sich, obwohl es in den Begrenzungen des Figürlichen bleiben soll, unendlich weit hinaus und auch hinein wagen kann: ins Größte und Kleinste.
Da Große und Kleine stellen in den Träumerein des Kindes keine Gegensätze mehr dar. Nur für den äußeren Geometer ist dies so – und für ihn sind die kindlichen Wertungen paradox. Das Kind aber hat sich in die Miniatur des Buchstabens O hinein begeben. Es hat gleichsam die „vernünftige“ Welt verlassen, vergessen und „imaginiert“. Seine Einbildungen sind eigentümlich verschoben und verdichtet, den Träumen ähnlich, die Freud so scharfkantig analysiert zu haben meint. Hinzu kommt allerdings, das die kindlich- träumende Einbildungskraft hört – und zwar unterhalb der akustischen Hörschwelle: Das Kind horcht und lauscht den sich verzweigenden Klängen, die aus dem Unmöglichen kommen und dort hin fliehen. Es horcht und lauscht und ist so fein gestimmt, daß es das Strömen der Zeit vernimmt, gleichsam so, wie sie in einer Sanduhr rauscht. Das Rauschen der Sanduhr in der Rundung des Buchstabens O, das Große der Zeit, ihr Katastrophisches, ihre Kehren und Wenden, ihr unaufhörlicher grandioser Salto mortale, dies vernimmt das lauschende Kind in seinen Einbildungen, die jetzt Einstimmungen und Anhörungen sind.
Das Kind schlüpft durch die Verschiebungen und Verdichtungen der Bilder hindurch und schwebt in den Raum-Zeiten des Klingens. Eine Spinne, die an ihrem Netz webt, ihr kurzatmiges Steigen und Fallen, ihr Hangeln in den Fäden, das Flimmern dieses Schauspiels im Gegenlicht einer durch das Fenster hereinstürzenden Mittagssonne, all dies hört das träumende Kind in dem zum Raum geweiteten Buchstaben. Er wird zu Musik, die unzählige Momente der Simulataneität des Erlebens zu einem Klang verschmelzt, zu Kanons, die sich übereinander schichten, die sich verdichten, die zu einem einzigen Tremolo werden, in dem die Dynamik des Gesehenen jetzt pulsierend pocht und schlägt. Die Klänge wiederum verwandeln sich in Kraftfelder, in denen die Töne umherirren, wie eine Herde Tiere, die sich auf einer Weide ausbreitet, wie ein Schneegestöber, das in Staccatostürmen hereinstürzt. Überall ist plötzlich ein Schwirren und Rauschen, im wilden Ineinander des Spinnentremolos, im dröhnend- schwirrenden Flimmern des Mittagslichtes. Dem träumend- lesenden Kind sind keine Grenzen des Sinnlichen vorgegeben, mit ihren angeblichen spezifischen Reizen und typischen Schwellenwerten, die, wie man sagt, nicht zu überschreiten seien.
Die Rundungen des Buchstabens O verwandeln sich im poetisch- träumenden Lesen des Kindes in einen weiten Klangraum, der, obwohl er sich ins Große ausdehnt, doch umfänglich ist, bergend ist und so einen pulsierenden Wärmestrom ausgießt, der Wohl und Vertrauen, „Freundschaft“ stiftet. Im Tonraum ist das Ohr zuhause, im Hohlen, Großen. Träumend genießt das Kind die absurden Spiele, die in der Rundung des Buchstabens O klingen, die, obwohl sie ungereimt und widersinnig, gleichsam schräg und quer für das ordnungsliebende beobachtende Auge sich darstellen, für das Ohr in ihrem Surren und Zischen, ihrem Trommeln und Trompeten, Pfeifen und Geigen, ihrem Susurrus nie als Missklang daherkommen, die in ihrem Schwärmen und Schwingen, ihrem Schwimmen und Schwindeln, ihrem Schweifen und Schwatzen, Schwärmen und Schrillen immer die Schwelle sind für die Melodien, die über sie herein kommen.
Die Schwellen werden überschritten. Im poetisch-träumenden Lesen transzendiert das Kind seine Sinne und: Es transzendiert seinen Intellekt. Das Verdikt Immanuel Kants, das nichts im Verstand sei, was nicht vorher in den Sinnen sich entfalten konnte, gilt auch umgekehrt: Nichts ist in den Sinnen, was nicht vorher im poetisch reichlich beschenkten Verstand gemischt und entschieden wurde. Den Dualismus von Sinnlichkeit und Verstand stülpt das Kind in seinen Poesien um. Hier scheint alles wie in Alices Wunderland zu geschehen. Im Schein, in den Innenwelten dieses Scheins aber spielen die Klänge, tönen die verbundenen Differenzen, finden die Extreme zueinander und stimmen, im Einander, ihre unmöglichen Symphonien an.
Um die Überschreitung der Schwellen in der Sprache der Baumeister zu formulieren: Der Grundbalken eines Fachwerkhauses läuft als tragender Bauteil unter der
Türöffnung hindurch. Wer ihn überschreitet, der gelangt ins Schützende des Hauses mit seiner Intimität des Geborgenen. Die Schwelle grenzt nicht aus, sie blockiert nicht. Die Schwelle lädt ein, sie bittet herein, wohlwollend ruft sie, sie verlockt. Das Bild des einsam erleuchteten Hauses inmitten der Nacht, dessen warmes Licht anziehend wirkt, komplettiert den Geborgenheit und Heimat versprechenden Charakter der Schwelle. Wer sie überschreitet, kommt in die Region, die mit Klängen umhüllt und wärmt. Im labyrinthisch verschlungenen Gewirr des absurden Rauschens der großen äußeren Welten schwingen die Melodien und Harmonien, die das träumende Kind in den Weiten des O vernehmen kann, um daraus das Glück empfangend- gestaltend zu gewinnen. Die unendliche „Größe“ der Welt wird in ihrem Klang kosmisch, schön.
Das O wird zum Korn und zum Kosmos, es oszilliert in den Extremen, die für das Kind nicht absurd sind, nur eben für jenen Geometer. Es sind erlebte „Contra- Partizipationen“, die die Unterschiede aufheben, die Gegensätze fröhlich genießen. Will das Auge alles mit einem Blick messend umgreifen, was ihm nicht gelingen kann, so ist die hörende Kraft der Poesie klein im Größten und groß im Kleinsten: Im einzelnen Ton schwingt der ganze Kosmos.
Der Buchstabe O wird zur Nußschale, zum Korn. In diesem Korn ist für den erwachsenen Geometer die ganze Welt wie unter einer Lupe zu betrachten, in einem unaufhörlichen Kontinuum eines unendlichen Rückwärts, im regress ad infinitum: „und dann und dann und dann...“ Die Lupe verdichtet diese Welt derart in einem Brennpunkt, dass sie sich hierin selbst vernichtet. Sie verbrennt im unendlichen Begehren des „Zurück! Zurück!“
Das poetisch lesende Kind, das im Korn des Buchstabens O ein Klingen vernimmt, ist kein Geometer. Es lauscht und horcht, es schwingt sich ein in die noch so zarten Wellenbewegungen, es vergißt das eine Bild, die eine Figur, in der das messende Verzehren verhängnisvoll brennt. Es geht auf im Zittern der unmöglichen Klänge der verwandelten Figur, des verzauberten Buchstabens und findet sich wieder in einem Adynaton, im Unmöglichen, in einem Land, in dem die Melodien nie verklingen, wo die Sonne nie untergeht, das, obwohl es meilenweit vom Meer entfernt liegt, eben doch ans Meer grenzt: „Bohemia. A desert country near the sea“, so umschreibt William Shakespeare dies Wunderland, das im Kind nicht irgendo liegt, sondern in seinen alltäglichen Spielen, die seine Wirklichkeiten stiften. Generationen später schreibt Ingeborg Bachmann: „Böhmen liegt doch am Meer.“ Adynatos, unmöglich ist die Welt, die das träumend-lesende Kind in seinem kleinen O betritt, das sich im Rauschen und Schwirren, aber auch im zarten Klingen, in den Randbezirken des Schweigens, zu einer warmen Innerlichkeit aushöhlt, auswölbt. Das Wesentliche, das ein Spielen ist, geschieht in den Übergängen, den Überlagerungen, den Unschärfen und Unbestimmtheiten, da, wo die Stimmen und Stimmungen zittern und beben. Hier kringeln sich die Bilder, sie wimmeln und entweichen schließlich in die Ruhe eines konsonanten oder die Spannung eines dissonanten, aber immer melodisch-harmonischen Singens und Klingens, die alles berühren und erregen und in Schwingungen versetzen. Das Kind hört alles weit und groß und hohl und voll. Es weitet sich in seinem Horchen, es ist in diesem Horchen, im Widerhall seiner Einstimmungs- und Anhörungskraft, die seine Einbildungskraft unaufhörlich beschenkt. Durch die enge Pforte des nackten Buchstabens geht das Kind, wenn es träumend liest – und diese Pforte öffnet ihm eine Welt des Staunens.
Die Einbildungskraft will im Traum die Bilder vermehren, atemlos, gehetzt. Die Anhörungskraft löst das Rasen der unaufhörlichen neuen Bilder auf und läßt diese taumeln, schwanken, schließlich ineinander auflösend tanzen: Sie weiten sich ins Große, sie ziehen sich ins Kleine zusammen, sie pulsieren, bis sie, verausgabt, kraftlos im Unscheinbaren zart schwingen, im Innersten, Innigsten. Die Einstimmungskraft eröffnet einen intimen Kosmos der Stille, des Schweigens – der den Bildern gegenüber nicht feindlich gesinnt ist, der sie vielmehr ins Schöne, in den Klang verwandelt, ins Sprechen, wo die Stimme arbeitet und ins Singen, wo sie feiert, ins Klingen also, das immer ein Rufen ist. Das Bild „metamorphisiert“ ins Schöne und wird so zum Klang. Das griechische Wort kalós heißt schön und gut. Kállos, die Schönheit, wird immer aber im Sinne einer schönen Stimme, eines schönen Gesangs verstanden: Der schiffbrüchige Odysseus wird von der singenden und deshalb schönen Nymphe Kalypso geborgen und in ihrer klingenden Wärme gesund gepflegt, wieder schön gemacht: kalyptein heißt so viel wie bergen, umhüllen, verstecken. Kalypso sieht nicht schön aus, sie steht nicht eingerahmt in der Fläche des Bildes, sie singt schön und weht in ihren unsichtbaren klingenden Kleidern, die sie schützend um Odysseus hüllt. Doch Odysseus liebt Penelope, pene, lépein, das abgelöste Gewebe, die Frau, die wirkliche Stoffe webt, mit denen sie ihren geliebten Gatten wärmend umhüllt. Wirkliche Stoffe umhüllen und bergen, klingende Stoffe wehen und lassen frei. Die göttliche Zauberin Kirke verführt mit ihrer Schönheit, die aus ihrem Gesang entströmt, der den Boden zum Dröhnen bringt. Und Odysseus spannt seine Bogensehne derart, daß sie schönt, daß sie schön ist, daß sie klingt und aus ihrer klingenden Schönheit eine magische Kraft schöpft, die seine Gegner in Furcht und Schrecken bannt, verzaubert, im Glanz ihrer Schönheit, anbetend auf die Knie zwingt. Das Schöne klingt umhüllend und auch angsteinflößend, niederwerfend, immer aber klingt es auch befreiend. Das Schöne ist nicht in den Bildern und Statuen. Im Schönen ist das Bild Klang geworden. Das schöne Bild wird gut und auch wahr, wenn aus ihm das Rhythmische, das Musikalische des Schönen herausklingt.
In der Intimität des ins Schweigen verwandelten Bildes verspürt das Kind seine Lebenswärme, die jener Macht ähnelt, die im Kleinsten nistet. Steigert sich diese Wärme, wird sie glühend oder flammend, dann erwachsen daraus die „Klänge des Lebens“ (Alfred Tomatis). Gibt sich das Kind dem Buchstaben träumend hin, dann erlebt es sein tiefstes Inneres, Eigenes, die klanggewordenen Bilder, die in die Stimme tanzen und hier sprechen und singen.
Das Kind kost träumend die wärmenden Weiten des im Buchstaben verborgenen Klangs. Das Verb kosen soll in seinem Doppelsin verstanden werden: Es kann reden und anschmiegen, lieb-schmeicheln bedeuten. Im Französischen ist im Verb coser, sich unterhalten, die Bedeutung des Sprechens aufbewahrt; die englische Sprache kennt das Adjektiv cosy, was so viel wie behaglich, wohlig meint. Das Kind kost also den Buchstaben, es schmiegt sich eng an in an, es verkriecht sich träumend in seine wohligen Kammern und es spricht mit ihm, es bringt schließlich die dort, im Intimen gewonnen „Unterredungen“ zur Sprache, indem davon erzählt. Dies muss es aber nicht: Vielleicht hat das stumme, schweigsame Kind weniger von diesen inneren Unterhaltungen mit den Weiten des Buchstabens vergessen als das allzu geschwätzige, das in den Wortgeräuschen des schwer Eindeutigen, des starr Deutlichen dröhnt. Vielleicht ahnt das stille Kind gerade den schwebenden Sinn, der im Buchstaben schwingt. Es „entschwert“ (Max Picard) die Buchstaben, es macht sie leichter, es kost den unmöglichen Sinn, den es im inneren Sprechen mit dem Buchstaben zum Klingen bringt.
In den Kosmos des Kleinen, des einzelnen Buchstabens versenkt sich das Kind träumend, horchend. Hier komponieren sich die für die Erwachsenen disparaten „Dinge“: die alten werden jung, die großen klein, die harten weich. Die geringsten Quantitäten stülpen sich in große Qualitäten um. Das träumend- lesende Kind nimmt diese Qualitäten an, es saugt gleichsam diese Größe, den ganzen Klangraum in sich auf und ist dann dieser Klang. Es zieht sich ins Kleinste zurück, um, in paradoxen Umkehrungen, auch hier jenes Große zu erleben. Gulliver in Liliput.
Das Kleine besitzt eigentümliche Kausalitäten: Lichter tremolieren, Gerüche werden laut, Schatten schweigen, ein Haus im Dunkeln strahlt lautlose Finsternis aus, die Sterne jubilieren. Unscheinbare, schwächste Anzeichen geraten in den Strom der Metamorphosen, die Bilder schwimmen in den Atmosphären eines Vor- Gefühls, das immer ein Vor- Hören ist. Das ins Klingen sich verwandelnde Bild wird zum Vor- Gehör, das vor den Bildern ist, das im Prä- Sens steht. In ihm murmelt und erhebt sich der Buchstabe, im träumenden Lesen, zum schönen Klingen. Der Buchstabe O wird kalliphon. Er wirft die Häute seiner kalligraphischen Erscheinungen ab. Das Kind hört den Buchstaben pfeifen und zwitschern, der Erwachsene hört ihn rufen. Beiden schwant etwas.
d) Das Große – Vom Schwanenruf des Buchstabens
Im O klingen die Worte, die unmöglichen, die im gewölbten Klangraum aus dem Strom der Zeiten herausquellen, die in Ekstasen geraten, jedoch nicht stehen, eher schwingen, zittern, beben. Die auch, weil das O in seiner Rundheit klingt, seinen Klang in der Form besitzt, sich gleichsam sonor- auditiv in Form hält. Die auch vorklingen: im rund klingenden O werden die Worte vorgeahmt, ihre Zukunft wird gehört. Das O ist wie eine „Muschel voll dunkler Rufe“ (Gaston Bachelard). Alles das ruft im O, was in seinen figürlichen Oberflächen, den eingebildten „Wortgeräuschen“ (Max Picard) nicht gehört werden kann. Wer kennt all die Geschichten, die in der Miniatur des einzelnen Buchstabens enthalten sind? Das Kind kennt sie nicht, aber es kann sie erspüren, in seinem poetischen Erleben der Rufe, die aus der eingebildeten, bildgewordenen Zeit, der einen Buchstabenform heraus tönen. Nicht im nachahmenden, formal lesenden Erfassen des Buchstabens besteht die Kunst des eröffnenden Lesens, des poetisch- träumenden Lesens, eher im schweigenden Loslassen der Geometrie seiner Erscheinungen.
Das Lesen ist eigentlich ein Kinderspiel, wenn es ohne die Zeigefinger geschieht, die die Formen buchstäblich abfahren wollen. Der Buchstabe ist nicht zu berühren, seine Konturen schimmern im luftleeren Raum, sie strahlen, ohne Halt im „Materiellen“, sie sind ohne Fleisch und Blut.
Das Lesen gelingt dem Kind, wenn es die buchstäblichen Zeichen ignoriert, wenn es die fröhliche Kunst einer „docta ignorantia“ pflegt, die das Augenscheinliche, das Offensichtliche einbettet in die unaufhörlichen Klänge, die in den gespannten Formen zu vernehmen sind. Das O rundet die ganze Welt in ein durchbebendes Klingen, in ein Zittern und Schwingen. Davon erregt, gerät das Kind in den Sog unmöglicher Rufe, die es gleichzeitig in sich einsaugt, einatmet. Im erregten Atem schwingt sich das Kind ein in die pulsierenden Klänge, die im O wie in einer Nacht zauberhaft verborgen sind.
Diese Innenwelt des Buchstabens, die im bildverliebten Gedächtnis verloren zu gehen droht, die hier nur noch wie ein Schatten sein kann, sie erlebt das Kind in seinen „zahlloszweigenden“ Unmöglichkeiten im träumend- versunkenen Horchen und Lauschen. Hier ist es inmitten seiner Phantasie, die sich von ihrer Phänophilie enttäuscht zurückgezogen hat, die ihre Täuschungen, die immer in Trennungen leben, untergraben hat und sich in Audienzen erlebt, in denen die verwandtschaftlichen Nähen eines Auditoriums genossen werden können, im Klingen der Innenwelten, die sich im Kleinen verbergen und hier ins unermesslich Große ausschwingen. Dies gilt für denjenigen, der noch träumend horchen kann, der unaufhörlichen Traummelodien hinter den Traumbildern hört, zu denen er von Anfang an immer auch selbst gehört.
Das Kind ahnt etwas von diesem unermesslichen Innenraum, der im Buchstaben schwingt. Es sagt sich im Stillen: „Mir schwant etwas von einem unaufhörlichen Klang.“ Das Kind wähnt sich in diesem Innenraum, wenn es träumend durch die enge Pforte des Buchstabens schlüpft. „Es wanet mir“, so sprachen die Erwachsenen früher, als die Buchstaben noch nicht flächendeckend waren. Übersetzt in die heutige Zeit könnte es heißen: Es tönt und klingt mir, wenn ich sehe. Deshalb auch der Schwan, dessen wunderschönes Rufen auf seinem Zug in den Süden die Herzen der Menschen mit Sehnsucht nach dem Weiten und Großen erfüllt. Wenn mir etwas schwant, dann höre ich Dinge, die eigentlich sprachlos sind. Dann flüstern die Schatten, dann ruft die Dunkelheit. Ich wähne mich im Ungeahnten – das kann bedeuten: Ich bade im Unbekannten, das in der Ferne klingt.
Wenn es mir wanet, ich mich wähne, bin ich dann nahe am Wahn? Heute ist dies Wort eindeutig mit einem negativen Sinn besetzt. In den Zeiten, als das Wünschen auch den Erwachsenen noch geholfen hatte, bedeutete es immer auch: etwas gewinnen. Die alten Namen Erwin, Oswin oder Winfried erinnern daran. Es waren Menschen, die im Wünschen, im Vertrauen, im Hoffen und im Lieben waren. Die die Freuden und Genüsse des Lebens, seine Wonnen kannten, denen Venus wohl gesonnen war.
Die Kinder leben (noch) in jenen Zeiten, in denen das Wünschen hilft. Sie leben im „einst“, das war und das sein wird. Sie träumen die Klänge, die im figürlichen Zeichen verborgen sind. Sie erleben die poetischen Wonnen, wenn sie den Weltinnenraum des Klingens schöpferisch, träumend, horchend spüren und eröffnen. Sie erlauschen ihn. Er wird, wenn das Kind hört. Im Hören entsteht der Klang, der ist, wenn er wird, weil er war – eben im „einst“.
Dies Pfeifen und Zwitschern erfüllt den unermesslichen Klangraum, der untergründig im Buchstaben O schwingt, in den das O will, in den es aber nicht gelangen kann, weil es ihn umfassen will, umrunden will. Deshalb bleibt das O im Horizont des Großen. Es weitet sich, bis es seine Grenzen erreicht. Es weitet sich und wird immer auch zu seinem Zentrum zurückgebogen.
Der unermessliche Klangraum ist der Widerhall der sich selbst überbietenden Phantasie, die jetzt nicht mehr bildet, sondern singt, melodiert, färbend tönt, fließt. Die poltert und rasselt im An- und Abschwellen des eigenen Leibes, die zittert und bebt in den Tiefen der Zeiten. Das Kind, das die Buchstaben träumt, überwindet diesen Tumult der Dinge, dies Vibrieren der Zeiten, die im Schweigen der Formen und Figuren nur negativ anerkannt werden, die aber im Klingen einen ungeahnten Sinn eröffnen. Im Ungeahnten ist das Schweigen, aus dem die unermesslichen Melodien emportauchen.
e) Das Unermessliche – Vom Anderswo des Buchstabens
Das Kind erlebt die innere Größe des Kleinen im Buchstaben, dann, wenn es ihn träumend liest. Es ist dann in der Mitte einer besonderen Stimmung, die es selbst erst mit seinem Sozius, dem figürlichen Zeichen, in das es hineinschlüpft und das es in seine Träume hereinläßt, erschafft. Vom O schwebt das Kind zum A,