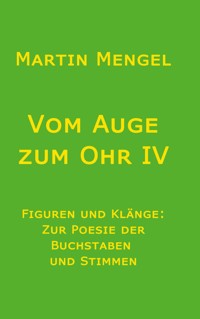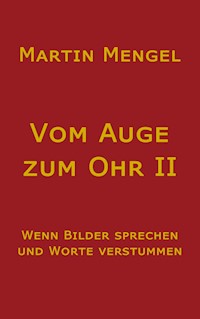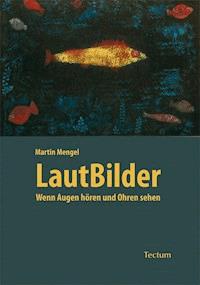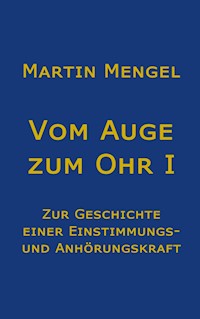
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Vom Auge zum Ohr
- Sprache: Deutsch
Die Augen setzen die Welt in ein Bild. Sie stauen den Fluß der Dinge. Sie halten sie fest und stellen sie dar, vor und aus. Sie halten sie auf Abstand. Die Augen bilden ein. In den Bildern ist der Raum geschrumpft, ist die Zeit eingefroren. Die Ohren bewegen sich im Strom der Dinge und lassen sie herein. Die Ohren bergen Resonanzen. Mensch und Ding sind im Ohr gestimmt. Stimmen tönen wieder. Durch den Mund. In den Antworten auf die Rufe der Welt. Stimmen stiften Stimmungen. Stimmungen leben. In Worten und Gedanken. In den Bewegungen des menschlichen Körpers. In den Atmosphären des Wirklichen. Es jubilieren die Zeiten und Einstimmungen. In diesem Buch sollen Versuche unternommen werden, Augen und Ohren zusammen zu bringen. Gelänge dies, dann tönte es in den Bildern. Die Musik wäre voller Farben und Figuren. Es schliefe "ein Lied in allen Dingen" und sie sängen, weckte sie "das echte Zauberwort".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Cordula, Maximilian und Charlotte
Mein Dank gilt Rüdiger Richter
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
A
Platon
Ist die Sprache durch Natur oder Zufall bestimmt?
a. Name und Physiognomie der Sache
b. Name und konventionelle Ersetzung der Sache
c. Die wahre Bedeutung des Namens
Exkurs Platons Höhlengleichnis
B
Aristoteles
Die Lehre vom Satz
a. Das Wort als Stimme und Zeichen
b. Das Wort als Kategorie
C
Augustinus
De magistro - Über den Lehrer
a. Die Wahrheitsliebe des Wortes
b. Die Eigenliebe des Wortes
Exkurs: Jakob van Eyck
D
Gottfried Herder
Vom Freiheit stiftenden Rausch der Ohrenlust
a. Die Welt als Klang und Vorstellung
b. Das Gleichnis vom blökenden Schaf
c. Das Gefühl wird zum Gesang
E
Wilhelm von Humboldt
Der individuelle Sinn der Sprachgestaltung
a. Vom unteilbaren Ganzen des Sprechens
b. Der begeisternde Hauch
c. Zwischenfrage – Wie lernt das Kind sein Sprechen?
d. Die Natur des artikulierten Lauts
e. Der Worterfinder
f. Das ahnungsvolle Sprechen
g. Der Charakter der Sprachen
F
Georg W. F. Hegel
Das Sprechen der sinnlichen Gewißheit
a. Dialektik – Durch das Wort
b. Der Ohrenzeuge als Augenzeuge
c. Der Klang als Bild
G
Karl Marx
Vom Warencharakter des Wortes
a. Realabstraktionen
b. Der Fetischcharakter der Ware und des Wortes
H
Friedrich Nietzsche
Vom Schrei der Vernunft zum Tanz der freien Geister
a. Apollon und Dionysos
b. Die Einbildungen der Lyra – Die Umarmungen der Flöte
c. Sokrates, treibe Musik.
d. Der Herzschlag der Dinge
e. Also sprach Zarathustra
f. Alles nur Worte
g. Fingo ergo sum
Anhangapparat
1 Von der Austreibung der Einbildungskraft in der Schule
2 Joseph Beuys: Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt
3 Goethes morphologisches Denken
Nachwort
Choral und Landschaft
Literaturverzeichnis
Vorwort
(Rembrandt, „David vor König Saul, die Harfe spielend“, ca. 1655.)
Im 1. Buch Samuel des Alten Testaments wird die tragische Geschichte des Königs Saul erzählt. Saul, der einst in Gottes Namen zum Führer Israels gesalbt worden war, erhielt eines Tages den Befehl Jahwes: „So ziehe nun hin und schlag Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was es hat; verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel.“ Der König der Israeliten aber widersetzte sich seinem Gott und befahl seinen Soldaten, König Agag, den König von Amalek, zu verschonen und auch „die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken.“
Da wandte sich Jahwe von Saul ab und ließ durch seinen Boten Samuel nun den Bann über den König aussprechen: „Weil du des Herren Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, daß du nicht mehr König seist“ und so wich „der Geist des Herrn“ von Saul und „ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn.“ Die Beherrschung durch diesen bösen Geist brachte den König in großes Elend. Um seiner Not die erdrückende Schwere zu nehmen, ließ Saul den jungen Hirten David zu sich kommen. Dieser konnte wunderschöne Melodien auf der Harfe spielen. „Sooft nun der böse Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Harfe, und spielte darauf mit seiner Hand. So wurde es Saul leichter, und es ward besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm.“ (alle Zitate aus: 1. Buch Samuel, 15 – 16) Saul gewann David lieb und der blieb am Hofe des Königs.
Dass David durch Gottes Befehl der neue König Israels werden sollte – was Saul nicht bekannt war – und David Freundschaft schloss mit Sauls Sohn Jonatan, Merab, die Tochter, des Königs „zur Frau nahm“, Saul sich mit David überwarf, ihm nach seinem Leben trachtete und schließlich, nach einem verlorenen Krieg gegen die Philister, um nicht von seinen Feinden getötet zu werden, sich ins eigene königliche Schwert stürzte – all das soll hier nicht von Interesse sein.
Es geht vielmehr um den Augenblick, den Saul als glückhafte kurze Erlösung von den Qualen des Gottesbanns erlebt. – Die Macht des Hörens wird im Alten Testament zweideutig behandelt. Gott ist unsichtbar. Doch seine Stimme ist zu vernehmen. Sie wird von dem gehört, der dazu auserwählt ist. Sie dröhnt als strafendes Grollen, gepaart mit blitzendem Licht und bebender Erde. Sie kommt den Auserwählten aber auch als Trost und Verheißung ins Ohr. König Saul wird erschüttert von der bannenden und fluchenden Stimme Gottes. Er erlebt aber auch die heilende Wirkung durch die Musik Davids, des Mannes, der in Gottes Gnade steht. Gehorsam und Hörigkeit einerseits, Genuß und Freiheit andererseits kommen durch das Ohr in den Menschen.
Rembrandt macht Sauls tiefsitzendes Leid und auch seine temporäre Heilung ergreifend anschaulich. Sauls Körperhaltung drückt keine majestätische Größe aus, das Aufrechte, Hohe fehlt gänzlich. Der König ist in sitzender Position zu sehen, mit kraftlos nach unten fallenden Schultern, seine rechte Hand lehnt sich gleichsam hilflos und gleichgültig an seinen Königsstab. Sauls Kopf scheint gewaltsam nach unten gepresst zu werden. Die Schwere des göttlichen Bannspruchs lastet auf dem bedrängten König, sie wird durch seine mächtige Kopfbedeckung noch vergrößert. Selbst die Königskrone beschwert sein Haupt und gibt ihm nicht den Glanz und die Würde eines auserwählten Führers. Sauls Blick ist nicht hoffnungsvoll in die Zukunft gerichtet, sein weit geöffnetes rechtes Auge schaut, vielleicht in Erwartung schrecklicher Zeiten, starr ins Leere. Das linke Auge verhüllt Saul mit einem dunklen Vorhang. Ob der König Tränen der Rührung zu verbergen sucht?
Kommen ihm die Tränen, weil David, der zu Füßen des Königs ganz in sein Harfenspiel versunken ist, mit seiner Musik die Ängste Sauls zu besänftigen versucht? Davids Kopf ist auch leicht gesenkt, doch ohne jegliche Bedrückung, frei von jeglicher Last. Seine Augen scheinen den lieblichen Klängen in heitere Welten zu folgen, die ihn beglücken.
Die in Sauls Ohren klingenden Melodien bewirken wahrscheinlich die Tränen der Rührung. Sauls Antlitz ist in zwei Hälften geteilt, die entgegengesetzte Seelenzustände ausdrücken. Ist dies die Gespaltenheit in Schrecken und Seligkeit? Vertreibt – in einem plötzlich zitternden Moment – die Musik die noch quälende Angst, von der Sauls hohles, in die Leere blickendes Auge zu zeugen scheint? Tränen der Glückseligkeit versucht der gequälte König gleichsam wie ein hilfloses Kind hinter dem schweren Vorhang zu verbergen. Der böse Geist, den Sauls rechtes Auge voller Schrecken schaut, ist in diesem Augenblick gänzlich in der Musik aufgehoben und damit zunichte gemacht: Da, wo Schrecken war, will Seligkeit sein. Tränen der Rührung und Erleichterung drängen ins andere Auge, sind im plötzlichen Augenblick der königlichen Bewegtheit. In der Bewegtheit geht der eine dunkle Seelenzustand, kommt der andere helle, um ihn mit dem Ende des Harfenklangs wieder ins Dunkle einzusperren. David und Saul sind im lichten Moment zu einer Einheit verschmolzen, sind im rhythmischen Puls ihrer Herzen, verwoben, im Weiten und wieder Verengen ihrer ein- und ausatmenden Seelen, im Zittern ihrer Haut – ganz umhüllt und geborgen in einer Resonanz des Selbstvergessens, solange die Musik erklingt. Danach dröhnen wieder die quälenden Stimmen des bösen Geistes.
Was könnte dies „Mitschwingen und Mittönen“, dies Wiederertönen beglückender Empfindungen bedeuten? Das Selbstvergessen entließe beide, David und Saul, den Spieler/ Hörer und den Hörer, in das Erleben ihrer unmittelbaren Existenz: Es gäbe hier kein fixes Bewußtsein des „Ich bin“. Das Hilfsverb „sein“ könnte transitiv verstanden werden: „Sein für etwas“, nicht gerichtet auf äußere Ziele und eingebunden in fremde Zwecke, sondern unmittelbar zielend auf das eigene, einmalige Leben selbst. Die Musik scheint im Moment des Erklingens und Vernommenwerdens allgegenwärtig zu sein, nicht nur gegenwärtig: sie wäre dann nicht nur „da“, sondern käme, durchdränge, erschütterte, beharrte, ginge vorüber, empfinge, schenkte. Träfe diese Annahme zu, erlebten die von der Musik ergriffenen, Spieler und Lauscher, sich im Transit, ihr festes Ich geriete in Bewegung, ginge „hinüber“ (lat. transire, hinüber gehen). Davids Antlitz zeugt von dieser „Ekstase“, diesem Heraustreten. Und Sauls Ego wäre nicht länger gefangen im Kerker des Gottesfluchs. Der König spürte die innere Freiheit, die die Türen auf eine „gute“ Zukunft hin öffnete. Das offenbaren seine Tränen, die von dem Berührtwerden der Musik zeugen.
Die sich aus dieser Annahme ergebende Vermutung kann jetzt, in eine These verwandelt, noch einmal mit anderen Worten formuliert werden: Im Lauschen der Musik ereignet sich eine sich selbst öffnende Präsenz, in der die Stellen des dreidimensionalen Raumes und der sukzessiv eindimensionalen Zeit sich auflösen und einkehren in eine lebendige Gegenwart, in eine Welt der Resonanzen, die keine gegeneinander geschiedenen Instanzen kennt.
Von der elementaren „Macht“ der Musik will dies Buch berichten. In ihm soll die Spurensuche nach einem Anhörungsbzw. Einstimmungsvermögen aufgenommen werden. Dies Vermögen unterscheidet sich von der traditionellen „Anschauungskraft“, die als Grundlage einer „Ästhetik“ dasjenige Denken „formt“, welches sich in der Theoriebildung zu sättigen versucht: Das griechische Verb horáein heißt übersetzt sehen, theoría bedeutet Anschauung, Betrachtung, Untersuchung. Im théatron sieht der Zuschauer einem (mehr oder weniger) bunten Treiben von Spielern zu, die sich zur Schau stellen.
Daraus könnte der Verdacht abgeleitet werden, dass in der Theorie formulierte Regeln und Gesetze, die sich auf Anschauungen gründen, die das Auge zum Zeugen haben, dass diese Begründungen maskiert sind und diverse „Rollen“ annehmen, die mit ihrem wirklichen „Wahrheitsgehalt“ nicht zu tun haben. Die Sätze der Theorie wären dann Verstellungen geschuldet, aufgeschrieben in der Immanenz eines grandiosen Scheins der Darstellungen, die sich selbst in aufgetürmten Tautologien als Wissen aufblähen: Dargestellt wird das, was ist, was es festgestellt, das Dasein. Ihm fehlt die lebendige Gegenwart, die im Hören auf die Welt geschenkt wird.
Eine Akroasis, eine Anhörungs- und Einstimmungskraft will, im Unterschied zu jener Aisthesis, dem Ohr seine Bedeutung zurückgeben – eine Bedeutung der „Mündlichkeit“, einer Oralität, die es nicht nur in den Zeiten vor der Schrift, der Literalität hatte. Das Ohr kann nicht blenden. Was durchs Ohr kommt, das versetzt den ganzen Menschen in Schwingungen, die in Resonanz sind mit den Klängen der Welt. Stimmen bringen Einstimmungen.
Einstimmungen, durch das Ohr aus der Welt in den Lauscher, Horcher oder Hörer gekommen und durch den Mund wieder in die Welt zurück getragen, können sich nicht nur im Instrumentalspiel und im Gesang ausleben. Das Unternehmen „Vom Auge zum Ohr“ hofft, gute Gründe dafür benennen zu können, dass auch in der Sprache die Welt der Töne und Klänge „verortet“ werden kann. Die Orte meinen hier nicht feste Stellen, Stelen in einer endgültigen Bestimmung, In-Stanzen des Beharrlichen (lat. stare, stehen) sondern Zeiten der Erfüllung, Horizontwechsel.
Dass Stimmen auch in der „Kunst des Tanzens“ ihren Ausdruck finden, dass Klang auch körperliche Bewegung wird, darauf kann hier nur hingewiesen werden. Ebenso darauf, dass der Maler in besonderer Einstimmung ist, wenn er sein Bild malt.
In den folgenden Kapiteln will ich einige klassische Texte aus der Geistesgeschichte zu deuten versuchen, die sich dem Ohr, das die Stimmen in der Sprache vernimmt, gewidmet haben. Platon und Aristoteles, Augustinus, Herder und Wilhelm von Humboldt sollen als „Ohrenzeugen“ dienen. Hegel und dessen „sinnliche Gewissheit“ sowie Nietzsche mit seinem „Schrei der Vernunft“ und dem „Tanz der freien Geister“ wird ebenfalls das Ohr geliehen. Marx Begriff des „Werts“ kann zeigen, dass selbst in seiner „Kritik der politischen Ökonomie“, die den „politischen Verhältnissen ihre eigenen Melodien vorspielen will“, Stimme und Ohr von zentraler Bedeutung sind.
A Platon – Ist die Sprache durch Natur oder Zufall bestimmt?
(Zeus, 5. Jhd. v. Chr.)
a) Name und Physiognomie der Sache: Die These des Kratylos
Der Sophist Kratylos behauptet: Der Sinn der Dinge (ta pragmata) ist in den gesprochenen Worten (ta en te phone, die in der Stimme sind) enthalten. Das gesprochene Wort ist der Name für das Ding.
„...jegliches Ding habe seine von Natur ihm zukommende
richtige Benennung (...) es gebe eine natürliche Richtigkeit
der Wörter.“ (Platon, 1978, Kratylos, 383b)
Die Sache selbst ist das, was ist, so, wie es sein soll, das „Mitsich- selbst – Identische“. Es schwimmt nicht im anhaltenden Strom kommender und gehender einzelner Dinge, die im Moment des Erscheinens schon wieder verschwinden (die Annahme Heraklits`: „Alles fließt“, panta rei). Die Sinnenwelt gibt den steten Wechsel der Sachen. Die Sache ist hier nicht sie selbst, sondern erscheint als ihr Ab- Bild.
Die Sache selbst wohnt auf dem Grund der Seele des Menschen als Idee, die schon fertig ist, die nicht erst erworben werden muß. Bevor die Seele in den Sinnen die Welt der Sachen erblickt, sind sie als Idee schon in ihr enthalten. Bevor der Mensch mit seinem Sehen, Hören, Tasten usw. beginnt, das chaotische Durch- und Ineinander zu ordnen, besitzt er in seiner Seele schon die Ordnung in der Idee der Identität, die die Differenz notwendig setzt und daraus das Eine und das Andere, das Vorher und das Nachher usw. als Wirk- lichkeit, als Wirkung der Idee, findet. Eigentlich findet sie in der Ordnung der Dinge das wieder, was schon in ihr ist.
Die Ideen Platons sind die Sachen selbst, die bereits vollständig in der Seele des Einzelnen enthalten sind. Es sind keine „Anschauungs- und Denkformen a priori“, wie bei Kant, sondern fertige Inhalte, Ur- Bilder, von denen die wirklichen Dinge nur Ab- Bilder sind. Die Seele erblickt (der Primat des Auges) in der Sinnenwelt die Ab- Bilder ihrer Ur- Bilder. Die Sinnlichkeit des Menschen lebt im Abbildhaften. Die Sinnlichkeit, das ist die Teilhabe (methexis) ihrer Bilder an den Urbildern der Seele. Die Bilder der Sinnlichkeit werden als Ab-Bilder gedacht. An der auf dem Grund der Seele als Idee bereits vorhandenen Welt hat die sinnliche Welt der einzelnen Dinge teil.
Am Ur- Bild (eidos) entlang gewinnt der erkennende Mensch die Einheit der sinnlichen Welt der Ab- Bilder. Doch muß es auch ein Ur- Wort (logos) geben, denn ana ton logon, analogisch, am „Wort“ entlang, dem „Wort“ gemäß ist ebenfalls die Einheit der Sinnlichkeit gegeben. Der Name, der die Sache benennt, folgt der Idee (eidos, logos), die so auch immer ein Ur- Wort ist. Die Figürlichkeit des Bildes und der Klang des gesprochenen Wortes sind bei Platon ineinander verschränkt und es stellt sich die zentrale Frage: Wie kann sich das Ur- Bild, das Visuelle, in ein Wort, das Akustische, verwandeln? Am Ur- Wort entlang, ana ton logon, wird die Welt der Dinge benannt. Der Name ist nur möglich in der Teilhabe der in der Sinnenwelt benannten Sache am Ur- Wort. Der Name ist das Nach- Wort (das Echo) des Ur- Wortes. Das Ohr ist auf das Ur- Wort (logos) gerichtet und der Mund spricht im Nach- Wort (der Name) dies Ur- Wort aus. In der Seele erklingt die Welt als „Eins und Alles“, hen kai panta, im Ur-Wort der Idee. Das Ohr horcht auf den Klang dieser Idee (eidos als logos, als Ur- Wort verstanden und nicht eidos, als Ur- Bild) und vernimmt ihn im Namen, den der Mund spricht.
Meint Kratylos das Ineinander- Verwobensein eines Ideen-Klangs und eines Wort- Klangs, wenn er in jener Behauptung davon spricht, das Wort käme der Sache von Natur aus (physei) zu, es sei ihr Name? - Wenn die Sache in der Sinnenwelt das Ab- Bild der in der Seele liegenden Sache selbst, des Ur- Bildes von der Idee der Sache ist, dann ist der lebendig gesprochene Name das Nach- Wort des dem Ur- Bild entsprechenden Ur- Wortes. Wird im Namen das Ur- Bild (als Ur- Wort) gleichsam physiognomisch verdichtet in einen Klang verwandelt und so vergegenwärtigt, repräsentiert, als gesprochenes Wort mit Leben erfüllt? Erhält das Statuarische des Bildes im Wort seine dynamische Erfüllung? Das Ur- Bild erscheint im wirklichen Ding, das sich in der
Sinnlichkeit gibt, als sein Ab- Bild. Der Name für das wirkliche Ding ist das Nach- Wort seines in der Seele liegenden Ur-Wortes.
In der Idee fallen das Ur- Wort und das Ur- Bild als Metapher in eins zusammen. Das Bild wird ins Wort, das Wort wird ins Bild getragen - meta- phérein, anderswohin tragen. Zeitlich kann es als ein Danach- tragen, räumlich als ein Hinterhertragen und im Sinne einer Verwandlung als ein Über- tragen gedeutet werden. Wie kann aber das Wort ins Bild kommen und das Bild ins Wort?
b) Name und konventionelle Ersetzung der Sache: Die These des Hermogenes
Der Sophist Hermogenes behauptet: Die Sache selbst ist nicht im gesprochenen Wort enthalten. Das gesprochene Wort ist durch die Menschen willkürlich gesetzt.
„...kein Name irgendeines Dings gehört ihm von Natur,
sondern durch Anordnung und Gewohnheit derer, welche die
Wörter zur Gewohnheit machen und gebrauchen.“
(aaO, 384d)
In der durch Übereinkunft gesetzten Welt der Namen geht es nicht mehr um ihre Wahrheit, darum, daß die Sache selbst in der Benennung enthalten ist oder nicht. Jetzt wird der Name behandelt nach dem Maßstab von „richtig“ oder „falsch“. Die Richtigkeit der Worte gründet sich auf einen Vertrag (syntheke), den mehrere Gesprächsteilnehmer übereinstimmend (Übereinstimmung, Übereinkunft, homologia) setzen (Gesetz, nomos; das Setzen, thesis). Die Mitglieder einer Sprachgemeinschaft einigen sich auf die Bedeutung eines Wortes und taufen mit diesem ein Ding auf einen bestimmten Namen. Der Sinn des Namens liegt nicht in der Sache selbst, sondern wird ihr von den in der Gemeinschaft Sprechenden zugewiesen. Zugespitzt formuliert heißt das auch: Jeder einzelne Sprecher verfügt über einen je individuellen Namen für die Sache; „das Sein und Wesen“ der Dinge ist „für jeden einzelnen in besonderer Weise“ (aaO, 386a); die Sache hat kein eigenes Wesen und wird „nur in Beziehung auf uns oder von uns nach unserer Einbildung hin und her gezogen.“ (aaO, 386e) Ein auf Verständigung ausgerichtetes gemeinsames Sprechen ist nur schwer oder gar nicht möglich.
Für eine Sache gibt es viele Namen, in denen ihre Eindeutigkeit verschwindet. Der Dualismus Name – Sache bricht auf. Viele Namen werden über eine Sache gestülpt. Die Wahrheit der Sache selbst im Sinne der Entsprechung von Idee und Wirklichkeit wird aufgegeben zugunsten einer richtigen oder falschen Zuordnung von Prädikaten zu Prädikatsträgern. Hier kann es eine „logische“ Übereinstimmung oder Nicht- Übereinstimmung geben, die nicht notwendig eine Übereinstimmung in der Sache bedeuten muß. Die Einheit der Welt in der Idee, im Bild - als Entsprechung von Ur- Bild und Ab- Bild - wird aufgebrochen.
Der Name wird gesetzt. Er ist das Ergebnis einer künstlichen (künstlerischen) Tätigkeit. Das Wort ist ein Werkzeug, mit dem die Sache benannt wird. Als Werkzeug wirkt sie aber auf die Sache ein und verändert sie dabei. Das Wort gestaltet die Sache, formt sie um. Die Namensgebung wird zu einem Akt plastischen Formens und Gestaltens, in Herstellung der morphé. Wie das Beil grobe Spuren hinterläßt und die Weberlade feine, so bewirken die Worte in der Namensgebung die grobe Sprache des Alltags oder die feine der Dichtkunst. Nach dem jeweiligen Wirkungskreis des Werkzeugs wird die Sache verändert. Sie ist, nachdem das Werkzeug des Namens auf sie gewirkt hat, nicht mehr sie selbst. Mit dem Werkzeug wirke ich auf die Sache ein. Um den Einfluß des Werkzeuges auf die Sache bestimmen zu können, muß ich die Sache vorher bestimmt und erkannt haben. Ich will sie aber durch den Namen als Werkzeug erst erkennen. Die Namensgebung durch das Wort setzt eine Bedeutung in die Sache von außen hinein, eine Bedeutung, die sie als eigenständige Sache negiert. Das Wort als Werkzeug trägt in keiner Weise zu Erkenntnis der Sache selbst bei. Will ich mit dem Wort als einem Werkzeug erkennen, so verändere ich dabei die Sache. Will ich den Einfluß des Werkzeugs wieder abziehen, so habe ich hier das Wort und dort die Sache, roh und pur, aber unerkannt. - Ich drehe mich im Kreis und finde nirgends die erkannte Sache.
Der „Wortverfertiger“, der onomaturgos (aaO, 390a) ist ein „Gesetzgeber“, nomothetes (aaO, 389d), der die Worte in Töne und Silben setzt, er ist ein Ton- oder „Wortsetzer“, ein onomaton thetes (aaO, 389d).
c) Die wahre Bedeutung des Namens: Der Klang des Ur-Wortes im Echo des gesprochenen Nach- Worts
Das Wort des Wortsetzers kommt gleichsam aus der Fremde. Wenn die Sache selbst im Namen auf natürliche Weise benannt werden kann (die These des Kratylos) dann ist der vom onomaton thetes bewerkstelligte Name für die Sache, die ihre eigene Sprache spricht, ein Fremdwort, dessen Bedeutung nicht in der Sache selbst liegt, sondern in der Phantasie des Wortsetzers.
Wenn sich demgegenüber die Sache selbst im Wortklang, in den Lauten des Wortes kundgibt, dann muß im Klang des Nach- Wortes das Ur- Wort zu vernehmen sein. Die „wahre Bedeutung“ (tò étymon) des Ur- Worts muß in den Lauten des Nach- Worts zu hören sein.
Platon läßt Sokrates im Dialog mit Kratylos und Hermogenes verschiedene Etymologien unternehmen. An Worten aus der griechischen Mythologie, den Namen einzelner Götter, demonstriert er die Entsprechung von Ur- Wort und Nach-Wort, zeigt er, dass „das Wesen des Dings mächtig ist, sich durch den Namen zu offenbaren“ (aaO, 393d). - Für den Namen des Meeresgottes Poseidon schlägt er die folgende Etymologie vor:
„Poseidon mag wohl deswegen so benannt worden sein von
dem, der ihn zuerst so nannte, weil ihn im Gehen die Gewalt
des Meeres aufhielt und ihn nicht weiter schreiten ließ,
sondern ihm gleichsam eine Fessel wurde für seine Füße.
Daher nannte er den diese Gewalt beherrschenden Gott
'Poseidon', weil er ein posi desmos war.“ (aaO, 402e)
Die ursprüngliche Erfahrung der Fußfessel (posí desmos), die entsteht, wenn das Meerwasser einen beim Durchwaten aufhält, gibt sich im Wort „Poseidon“ kund, wobei das „e“ vor dem „i“ zur Zierde, als Ornament hinzugefügt wurde. Die Kraft, die der Mensch wirklich erfährt wird zur Macht, die sich im Namen eines Gottes verdichtet. Das Ur- Wort, die Idee, die im Namen „wohnt“, die hindernde Kraft, gibt sich im Klang des Nach- Worts, des gesprochenen Namens kund. Das Wesen des Nach-Wortes besteht in der „Nachahmung“ (Mimesis) (aaO, 422c) des Ur-Wortes. Im Namen „Poseidon“ ist die ursprüngliche Idee einer Macht benannt, die einer Sache entgegenwirkt, die der Mensch als Kraft verspürt. Das dynamische Ereignis verdichtet sich zur vorgestellten Person des Gottes, die im Klang ist (per sonare; der Ton, der durch die Maske erklingt), im Namen und in dem, was er spricht. Im Klang des Wortes äußert sich die göttliche Macht, sie kommt zum Menschen als Kraft, die gegen den Menschen wirkt, die ihn erregt, erzittern lässt – mysterium tremendum.
Nicht nur die Worte benennen auf „natürliche“ Weise die Sache selbst. Auch in den einzelnen Lauten des Wortes (die wiederum im Wort- Bild ihr Vor- Bild besitzen, in den Buchstaben; ist also vielleicht das geschriebene Wort das Modell für Platons Etymologie und nicht das gesprochene?) muß gezeigt werden, „wie durch Buchstaben und Silben nachgeahmt die Dinge kenntlich werden.“ (aaO, 425d).
Als Paradebeispiel etymologisiert Platon/Sokrates den Konsonanten „r“, bei dem die Zunge rollt und gegen die oberen Schneidezähne trommelt, um so den Ur- Laut des Strömens in einem Nach- Laut erklingen zu lassen. Wenn der Buchstabe R (der ein Substantiv ist und als Figur zu sehen ist, die gar nicht klingt) zum Konsonanten wird und als „r“ zu hören ist, wie im griechischen Wort „rhein“, dann bringt er die ursprüngliche Bedeutung der Kraft des reißenden Stroms zum Klingen. Doch nicht nur im Klang, auch in der Figur, das geschriebene r (das griechische rho), muß die ursprüngliche Idee des Rollens, Reibens, Rasselns, Reißens usw. seinen Ausdruck finden können. Der Kleinbuchstabe des griechischen rho hat die Form einer sich schließenden/ öffnenden Spirale. Einmal vollführt die Linie eine Bewegung, die von einer Kraft hin zu einem Mittelpunkt gelenkt wird. Der Kleinbuchstabe rho hat dann das Gesicht eines Strudels. Die Linie kann aber auch vom Mittelpunkt fortführen und wie eine Welle aussehen, die dann eine zentrifugale Wirkung hat. Im Begriff Laut- Bild fallen Klang und Figur in eins zusammen. Die Idee des reißenden Stroms ist im Klang des rollenden „r“ zu hören und in der Figur der geschwungenen Linie des rho zu sehen.
Tò étymon; die wahre Bedeutung des Wortes (jetzt als Wort-Klang und Wort- Figur gemeint) muß in allen Sprachen die gleiche sein, was aber offensichtlich (bzw. offenklanglich) durch die Verschiedenheit der wirklich gesprochenen (und geschriebenen) Sprachen widerlegt wird. Gilt Kratylos These von der „natürlichen Richtigkeit“ des Wortes also nur für seine Muttersprache, das Griechische, das er selbst spricht? Was ist mit den bärtigen Wilden, jenseits der Berge im Norden, den wie die Bären Brummenden, den barbaroi, den „brbrbr“ Stammelnden, die andere Worte sprechen, deren Sprache sich radikal von der griechischen unterscheidet, die eigentlich keine Sprache besitzen, weil sie sich wie die Tiere äußern?
Haben Kratylos und Hermogenes beide Recht? Sind die Wörter thetisch und natürlich zugleich? Stecken physei und nomos im Wort? - Jede Kultur spricht die wahre Bedeutung ihrer eigenen Worte. So könnten Kratylos und Hermogenes Thesen zusammen gefügt werden. Doch diese Synthese interessiert Sokrates nicht.
Das Wort soll ein Nach- Wort des Ur- Wortes sein. Es wird aber durch die Gesetze der Gewohnheit verfälscht. Sein Laut-Bild wechselt von Sprachkreis zu Sprachkreis. Durch das Wort kann man nicht zur Sache selbst kommen, zur Idee, die im Inneren der Seele beheimatet ist. Das Wort ist ein Ab-Bild/Nach- Wort des Dings. Das Ding ist ein Ab- Bild des Ur-Bildes. Das Wort ist ein Nach- Wort des Ab- Bildes vom Ur- Bild, ist also doppelt entfernt von der ursprünglichen Idee.
Sokrates geht es um die Erkenntnis der Wahrheit der Sache. Die soll man nur durch die Sache selbst finden.
„Die Erkenntnis der Dinge (geschieht) nicht durch die Worte,
sondern weit lieber durch sie selbst.“ (aaO, 439,b)
Wie diese Erkenntnis durch die Dinge selbst zu bewerkstelligen ist, das läßt Sokrates offen. Jedenfalls durch das Wort kann dies nicht gelingen, wie er meint. Die Idee, das Ur- Wort, das Ur- Bild wird mithin von „einer größeren als menschlichen Kraft“ (aaO, 438b) gegeben.
„Das Wort ist also belehrendes Werkzeug und ein das Wesen
unterscheidendes und sonderndes, wie die Weberlade das
Gewebe sondert.“ (aaO, 388c)
Es ist ein „das Wesen unterscheidendes Werkzeug“, organon diakritikon. Das „Wesen “ der Dinge wird mit dem Gewebe gleichgesetzt; der Wortsetzer stellt ein künstliches Ding her, wie der Handwerker am Webtisch. Der Wortsetzer ist ein Mundwerker und Tonsetzer. Die ursprüngliche Idee der Sache ist, bezogen auf die gesprochene Sprache, ohne jegliches Wort, sie ist stumm, sprachlos. Und doch muß, soll im Wort die Idee nachklingen, etwas von ihr im gesprochenen Wort enthalten sein. Die Sache soll nur durch sich selbst erkannt werden. Gleichzeitig setzt Sokrates, daß nur in den Ab- Bildern und Nach- Klängen die Idee sich zeigt und kundtut. Zur Sache selbst gelange ich also immer (nur) durch die Mimesis in den Abkömmlingen. In der Mimesis ereignet sich die Methexis, die Teilhabe an der Idee. Im Raunen des Mythos, der durch den Mund die Idee zu offenbaren versucht, geschieht es im Echo des Nach- Worts auf das Ur- Wort. Im Denken des Sokrates, das durch die Augen zu erblicken versucht, ereignet es sich in der Figur des Ab- Bildes vom Ur- Bild. Zur Sache selbst gelange ich durch das Bild und das Wort, bezogen auf die Sprache, durch den Laut und den Buchstaben (als Figur des Lautes).
(das rho, Manuskel und Minuskel)
Exkurs – Platons Höhlengleichnis
(J. Saenvedam, „Die platonische Höhle“, Kupferstich 1604.)
Im 7. Buch seiner Schrift über den Staat hat Platon im Höhlengleichnis den Zusammenhang von Ab- Bild und Nach-Klang anschaulich in Worte zu fassen versucht. Dort schreibt/erzählt er von einer Höhle, in der Gefangene auf einer Bank sitzen, „von Kindheit an gefesselt an Hals und Schenkeln“ (Politeia, aaO, 514a). Den Rücken kehren sie zum Eingang. Sie können sich nicht umdrehen, auch ihr Kopf bleibt starr und so blicken sie immer nur in eine Richtung auf eine Wand vor ihnen, die dem Eingang gegenüber liegt. Hinter ihrem Rücken befindet sich eine menschengroße Mauer, die sich quer durch die Höhle zieht und dahinter, in Richtung Eingang, brennt lichterloh ein Feuer. Zwischen dem Feuer und der Mauer gehen Menschen an der Mauer entlang. Sie tragen „allerlei Geräte, die über die Mauer herüber ragen, und Bildsäulen und steinerne und hölzerne Bilder von allerlei Art; einige, wie natürlich, reden dabei, andere schweigen.“ (aaO, 515a) Die Statuen usw., die über die Mauer hinaus ragen, werfen ihre Schatten auf die Höhlenwand. Auf diese Schatten schauen die Gefangenen. Sie können nur diese Schatten der Gegenstände auf der Höhlenwand sehen. Von dort her dringt auch das Echo der Worte, die die Menschen jenseits der Mauer sprechen. Wohlgemerkt: Die Gefangenen kennen nur die Schatten und Echos, die von der Höhlenwand her kommen und auf ihre Augen fallen oder in ihr Ohr dringen.
„Meinst du wohl, daß dergleichen Menschen von sich selbst
und voneinander je etwas anderes gesehen haben als die
Schatten, welche das Feuer auf die ihnen gegenüberliegende
Höhlenwand? (...) Und wie, wenn ihr Kerker auch einen
Wider-hall hätte von drüben her, meinst du, wenn einer von
den Vorübergehenden spräche, sie würden denken, etwas
anderes rede als der eben vorübergehende Schatten? (...) Auf
keinen Fall können sie etwas anderes für das Wahre halten
als die Schatten jener Kunstwerke.“ (aaO, 515b,c)
Da die Gefangenen nur Schatten und Echos kennen, halten sie diese für die „wahre Wirklichkeit“. Könnten sie sich einmal umdrehen und im leuchtenden Feuer die originalen Statuen usw. anstatt deren Schatten sehen, und die originalen Stimmen hören, die bisher nur als Echo von der Höhlenwand her kamen. Könnten einige der Gefangenen sich befreien und außerhalb der Höhle die Menschen, Tiere, Pflanzen und alles Gestein erleben (Platon reduziert den Modus des Erlebens auf das Sehen der Dinge im Lichte der Sonne), von denen in der Höhle nur die Ebenbilder (Statuen usw.) und deren Schatten an der Wand zu sehen waren, dann wären sie ganz geblendet „vom flimmernden Glanze“ des Feuers in Höhle und der Sonne außerhalb. Kämen sie zurück in die Höhle und erzählten alles Erlebte den dort verbliebenen Gefangenen, dann würden sie nur ausgelacht. Zwischen der erlebten Welt der Dinge im Glanze der Sonne außerhalb der Höhle, derjenigen der Kunstwerke im Schein des Feuers jenseits der Mauer und den Schattenbildern auf der Höhlenwand diesseits der Mauer in der Höhle, brechen Abgründe auf, die nicht zu überbrücken sind.
Das Leben der Dinge ist unter der Sonne, „die alle Zeiten und Jahre schafft und alles ordnet in dem sichtbaren Raum und von dem, was dort (ist), gewissermaßen die Ursache ist.“ (aaO, 516b) Die Sonne gibt das Licht, in dem alles erscheint. Der Klang der Welt ist in den Erscheinungen, die im Glanz des Lichtes der Sonne sind. (Doch auch: Die Sonne ist eingebettet im schweigenden Klang der Sphären. Dort tönt sie nach alter Weise“, Goethe, Faust). Die Dinge in Raum und Zeit sind schon Ab- Bilder bzw. Nach- Klänge des wahren Seins, der Idee. Ist die Sonne das Ur- Bild, ist ihre Sphärenmusik der Ur- Klang? Die vom Menschen geschaffenen Kunstwerke (Gemälde, Statuen, Musik, Sprache) sind Ab- Bilder jener Dinge unter dem Himmel im Glanz des Sonnenlichts, also Ab- Bilder von Ab- Bildern. Davon sind die Schatten wiederum Ab- Bilder. Vom Ur- Bild über das erste Ab- Bild der lebendigen Welt zum zweiten Ab- Bild der Kunstwerke zum dritten Ab- Bild der Schattenfiguren, so kann die Hierarchie der Bilderwelten charakterisiert werden. Der Klang im Ur- Bild wäre der Ur-Klang des Schweigens der Sphären. Ihre Harmonien, das geordnete gleichzeitige Ineinander der Töne, ein erster Nach-Klang, das zeitliche Nacheinander der Töne im Reich der Melodien ein zweiter Nach- Klang und die Stimmen im Reich der gesprochenen Worte ein dritter Nach- Klang wären. Jedes Wort lebte in einer Melodie, jede Melodie in einer Harmonie und jede Harmonie im Schweigen der Sphären.
Platon unterscheidet im Sichtbaren nur zwei Ab- Bilder vom Ur- Bild der Idee. Der Sonne entspricht das Feuer in der Höhle. Sie sind das Ur- Bild. Die Welt der Dinge unter der Sonne entspricht den künstlerischen Darstellungen im Scheine des Feuers, beide zusammen ergeben das erste Ab- Bild. Das zweite Ab- Bild sind die Schattenfiguren der lebendigen und künstlichen Dinge. Im Hörbaren gibt es nach Platon kein Schweigen; die Harmonien sind der Ur- Klang, die Melodien ein erster und die Laute der Worte ein zweiter Nach- Klang. Das alles Gründende, hypotheton, die „Seinsgrundlage“, ist die besonnene Welt, das Leben unter der Sonne, das Sichtbare. Kann der Klang, im Unsichtbaren der Idee nur negativ gefaßt werden, als die Idee der Ideen gedacht, als das Absolute, anhypotheton? Das Absolute, die Idee der Ideen ist in kein Bild zu bringen, ist nicht sichtbar. Spricht es aber, ist es zu hören?
B. Aristoteles – Die Lehre vom Satz (Peri hermeneias )
a) Das Wort als Stimme und Zeichen
„Es sind also die Laute, zu denen die Stimme gebildet wird,
Zeichen der in der Seele hervorgerufenen Vorstellungen, und
die Schrift ist wieder ein Zeichen der Laute.“
(Aristoteles, Lehre vom Satz, 16a,2)
In diesen Satz verdichtet Aristoteles eine ganze Metaphysik des Wortes. Er kann vielleicht so ausgedeutet werden: Als eine stimmliche Äußerung ist das Wort zunächst von Interesse. Als gesprochenes, ta en te phone, ist es der Ausgangspunkt für Überlegungen zur Sprache. Erst danach wird es in seiner schriftlichen Form, ta en te graphe, debattiert.
Das gesprochene Wort ist ein Zeichen der in der Seele erlittenen Vorstellung, die selbst die Dinge, die in der Welt sind, abbildet/bezeichnet. Das gesprochene Wort ist das Zeichen eines Zeichens. Das geschriebene Wort ist wiederum ein Zeichen: Es bezeichnet das gesprochene Wort, das die Vorstellung bezeichnet, die die Dinge bezeichnet, die in der äußeren Welt sind. Aristoteles unterscheidet natürliche und künstliche Dinge; diese (Statuen, Bilder, Werkzeuge) sind Abbilder (Zeichen) der Naturdinge. In einer (vielleicht unabschließbaren?) Kette von Zeichen markiert das gesprochene Wort eine Stelle, die auf etwas verweist, die für etwas steht, das wiederum auf etwas anderes verweist.
Den Anfang macht die Wirklichkeit der äußeren natürlichen Dinge. Sie kommen und gehen im Strom der Zeit der sinnlichen Ereignisse. Dieser Strom/diese Zeit wird in der Seele des Menschen als Vorstellung gestaut/angehalten und eingeteilt. Die Vorstellung hält einen Teil des vorbeiflutenden Sinnenstroms fest, dämmt ihn. Die Zeit der kommenden und gehenden Dinge wird zum Raum des einzelnen gestauten Dings. Die Seele stellt diese im Raum (Behälter) gebannte Zeit als Einzelheit vor sich hin und zeichnet sich ein Bild von ihr. Ein Sinnending tritt aus der Flut der amorphen Masse hervor, es ex- sistiert im Zeichen der Vorstellung. Von diesem ersten Bild gibt das gesprochene Wort wiederum ein Zeichen kund, es spricht, es ruft dies Zeichen in einem neuen Zeichen aus, es evoziert das herausgestellte Zeichen der Vorstellung, eine Evokation zur Existenz. Es geschieht die wundersame Verwandlung eines Bildes in einen Klang: das zweidimensional Ausgedehnte, das gesehen werden kann, verwandelt sich in etwas, das gehört werden kann. Das gesprochene, ausgerufene Wort ist keine Skulptur, kein im dreidimensional ausgedehnten Raum vorhandener Gegenstand. In der Schrift wird dieser Ruf, dieser Klang wiederum zu einem neuen Zeichen. Der Klang des gesprochenen Wortes wird ins Bild der Buchstaben gesetzt. Wie kann ein Bild zum Klang werden und umgekehrt, ein Klang sich in ein Bild verwandeln? - Der Mensch bringt die Welt in ein Bild. Er zeichnet/bezeichnet die Dinge. Das gesprochene Wort ist das Zeichen eines Zeichens. Das geschriebene Wort ist das Zeichen von einem Zeichen von einem Zeichen...
Das Nomen und das Verb sind die Paradebeispiele für das Wort als Zeichen. Das Wort setzt ein Bezeichnetes, auf das sich die bezeichnenden, gesprochenen Worte, die Ausdrücke, die es bezeichnen (semainein), beziehen. Das Nomen ist das Subjekt in einer Aussage, das Verb bezeichnet dies Subjekt prädikativ. Bezeichnetes und Bezeichnendes zu sein, beides kommt dem gesprochenen Wort als Nomen und als Verb zu. So stehen sie als Zeichen in einer Aussage, die behauptet, das etwas ist. In den “Kategorien“, einer frühen Schrift des Aristoteles über die Logik, werden sie gleichzeitig als ontologische Substrate charakterisiert, in denen die Dinge der Welt geordnet vorliegen. Beides, das Subjekt einer behauptenden Aussage und das Substrat der geordneten Welt der Dinge, bezeichnet Aristoteles als etwas Zugrundeliegendes, hypokeimenon. Die (gedachte) geordnete Welt und die (in Worten und Sätzen) benannte und beschriebene Welt fallen im hypokeimenon in eins zusammen. Sprache und Denken werden von Aristoteles als eng miteinander verbunden behandelt, wenn nicht sogar als einander gleich. Als Kategorie entspricht das Nomen der „ersten Substanz“, das Verb (das immer auch einen nominalisierten Grund hat) der „zweiten Substanz“.
Im Nomen, der ersten Substanz, „ist“ das, über das etwas ausgesagt wird, das aber selbst nicht von anderen ausgesagt werden kann. Das Verb gilt als etwas, das über das, was selbst nicht von anderen ausgesagt werden kann, ausgesagt wird. Als Teile des Satzes haben sie die Bedeutung von Subjekt und Prädikat. - Die Sache selbst findet sich im Namen als die erste Substanz. Er bezeichnet immer etwas Einzelnes, ein Dies da, etwas Unteilbares, das der „Zahl nach Eine“, das Einzigartige, „Sokrates“, den Namen. Das ist die erste Substanz, die auf nichts bezogen werden, nicht als Prädikat eines Subjekts dienen, die keine Akzidenz einer anderen Substanz sein kann. Allerdings steht nun dieser Name Sokrates doch für etwas anderes. Dies da (ist) Sokrates. Das, auf das der Name Sokrates, der im Wort „Sokrates“ ausgesprochen wird, deutet, ist das Primäre, was als Rest übrig bleibt und nirgends weg gekürzt werden kann. Dieser Rest ist nicht Sokrates als Lebewesen: „Sokrates ist (ein) Lebewesen“. Auch der Löwe ist ein Lebewesen. Ein Lebewesen zu sein gilt als Eigenschaft von Tier und Mensch. Das, was im Namen Sokrates benannt wird (der nicht weiter zu kürzende Rest, der Sokrates als einzigartiges „Dies da“ substanziell“ bestimmt), hat eigentlich keinen Namen. Das Einzigartige des Sokrates kann nicht benannt werden, es ist „schlechthin“, „einfach“, „simpliciter“. Auf dies nicht zu Benennende zeigt das gesprochene Wort, davon ist es ein Zeichen, symbolon, semeion. Das im Namen Sokrates angezeigte, das schlechthin nicht zu Benennende, auf das der Name deutet, ist nicht das, was in der sinnlichen Wirklichkeit ist, sondern die in der Seele hervorgerufene Vorstellung, ton en te psyche pathematon, die diese sich von der Sache bildet, macht. Die Seele ist im Leiden, pathos, hierin wird das Ding abgebildet. In der Vorstellung ist das Abbild des Dings. Das Wort ist von diesem Abbild das Zeichen, symbolon. In ihm ist etwas zusammengefügt, symballein. Im gesprochenen Wort, das im Klang ist, wird die Vorstellung angezeigt, die im Bild ist. Ta en te phone, die, die in der Stimme sind, die gesprochenen Worte, sie werden mit den Vorstellungen, die im Bild sind, zusammengefügt, wie die beiden Bruchstücke eines Rings.
Die Stimme im Wort wird mit dem Bild im Wort zusammengefügt, sie sind symbolisch zusammengeheftet - was allerdings zwei imkompatible Welten in eins setzt. Laut und Bild, Klang und Figur, künden von zwei fundamental verschiedenen Arten, in der Welt zu sein. Das Auge sieht die Dinge, die sich ihm auf der Oberfläche der Netzhaut bildlich/figürlich darstellen. Das Ohr hört die Dinge, die in es eindringen und dort eine Resonanz bilden, einen Widerhall, in dem die Dinge wieder erklingen. Die Vermengung von Wort-Klang und Wort- Bild wird von Aristoteles im Begriff des Zeichens stillschweigend vorausgesetzt. Im symbolon wird das gesprochene Wort am geschriebenen Buchstaben gemessen. Der Begriff Zeichen stellt eine Metapher dar, meta pherein, etwas woanders hintragen. Zwei grundlegend verschiedene Sinnbereiche werden in einen Zusammenhang gebracht, den sie aus sich heraus nie finden können. Sie werden einander ähnlich, wobei ana logon „am Wort entlang“ gehen bedeuten kann. Logos wäre hier sicherlich das Gedachte im Wort, nicht das Gesprochene. Wie auch immer: Die eine Welt, die im Bild ist, wird auf die andere, die im Klang ist, bezogen und umgekehrt. In der neuen Einheit, der Metapher, wäre also immer die Relation, das „wie“ enthalten. Das Wort „Zeichen“ enthielte, als Metapher, immer die Aussage: „Das Eine ist wie das Andere“ und umgekehrt, wobei allerdings das vergleichende „Dritte“, das tertium comparationis, das als Maßstab für den Vergleich dient, das weder im Einen noch im Anderen sein kann, fehlt. Der Maßstab, den Aristoteles nimmt, um das gesprochene Wort als ein Zeichen zu fassen, liegt eindeutig im Bild, in der Figur, in der das Wort erscheint. Das gesprochene Wort sieht er im Lichte des Buchstabens, des geschriebenen Wortes, allerdings verdeckt dies notwendig den Klang, die Stimme im Zeichen. Das Zeichen enthält gleichsam einen blinden Fleck.
„...und die Schrift ist wieder ein Zeichen der Laute“, dies kann nur bedeuten: An die Laute als Zeichen ist bereits der Maßstab des Figürlichen angelegt worden. Die Laute im Wort verdanken sich der diskreten Punkte, die in die Linien ausströmen, die wiederum zum Schirm der Fläche sich aufspannen. Wieso bezieht Aristoteles die Schrift, die Buchstaben, Silben und Wörter usw. auf das gesprochene Wort, wo dies, als Zeichen gefasst, doch schon immer in die Metapher des Bildes gesetzt ist? Das Stimmliche des Wortes ist semeion, ist bildgewordener Klang, ist „aufgehobener“ Klang im Buchstaben. Der soll wieder auf den Klang zurück bezogen werden, ein theoretischer Zirkel, in dem die beiden Bestimmungen sich wechselseitig zur Bedingung haben. Der Zeichencharakter des Wortes verdankt sich einem inneren Circulus Vitiosus. Die Stimme im Wort ist immer als Zeichen gedacht, der Buchstabe im Wort ist immer als Stimme gedacht. Das Dritte, das beide aufeinander bezieht, jenes tertium non datur, das in der Metapher verschwunden zu sein scheint (das Eine ist wie das Andere), kann nur im (formalen) Prinzip der Identität gedacht werden, dem Mit- sich- selbstgleich- Sein, das im Wort sowohl die Stimme als auch den Buchstaben als diskreten Teil setzt. Das Wort wird so zum Laut- Bild. Das geschriebene Wort ist hier in isolierte Buchstaben segmentiert, das gesprochene in isolierte Laute. Das formale Prinzip der Identität kippt jeden „natürlichen“ Sinn über Bord. Das Wort als Zeichen kann nur als ein Artefakt verstanden werden, von jeglicher physei frei, voller syntheke. „Das Nomen (...) ist ein Laut, der konventionell etwas bedeutet“ (aaO, 16a, 28), der nach den Regeln der Übereinkunft aus Elementen zusammengesetzt wird, die ihren Sinn nicht darin besitzen, das „abzubilden“, was als Sache, unabhängig vom Wort, ist. Das von der Seele erlittene Bild der Dinge hat diese selbst immer schon als „Form“, als Figur gesetzt. Hiervon ist das Wort die Benennung. Das Wort entspricht der formal gebildeten Vorstellung, die die in der Seele erlittenen Dinge kategorial faßt. Im Wort sind einzelne Laute sukzessiv geordnet. Das aus einer Kette von einzelnen Lauten zusammen gefügte Wort ahmt nicht die natürliche Beschaffenheit der sinnlich erfahrenen Dinge nach, es hat auch keinen Anteil an einer gesetzten Idee. Es ist nicht aus der Mimesis geboren, es enthält keine Methexis. Es ist beiden, dem natürlichen Ding und der Idee, äußerlich. Das Wort ist bei Aristoteles zum Artefakt geworden, zum durch die Übereinkunft der Sprachgemeinschaft anerkannten Zeichen, das so aber nicht mehr auf das Ding oder die Idee zeigt, sondern auf die konventionell gesetzte Form, die das „Material“ darauf vorbereitet, es benennbar zu machen. Das Sprechen gelingt bei Aristoteles nur dann, wenn es in der Kategorie (und im daraus folgenden Syllogismus) zu fassen ist. Beide können aber nicht mehr eine zeitunabhängige Wahrheit beanspruchen; in der Konvention sind sie immer etwas, das an eine Chronologie gebunden ist, ihre Wahrheit ist eine qua Übereinkunft getroffene Aussage p zu einer je bestimmten Zeit t. Die Veränderung von t setzt daher notwendig eine neue Wahrheit p. Das Wort als Zeichen erhält seinen Wert in einer je konventionellen Setzung, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums Gültigkeit besitzt. Eine davon unabhängige, absolut gültige Wahrheit p erzittert immer in ihrer immanenten Relativität.
Die Kategorien bereiten das Wort darauf vor, in einem Satz sich auf eine je besondere Art mit anderen Worten zu verbinden. Innerhalb dieses Satzes wird eine Aussage über die Dinge der Welt getroffen. Die Dinge erlebt die Seele leidend, im Leiden werden sie von der Seele geformt; sie sind keine Gegebenheit, sondern ein zu Findendes, das dann am rechten Ort „geschöpft“ werden kann (Topik, Findekunst).
„Die Bestimmung 'konventionell' (auf Grund einer Übereinkunft)
will sagen, daß kein Nomen von Natur ein solches
ist, sondern erst wenn es zum Zeichen geworden ist.“
(aaO, 16a,38)
Das Nomen als gesprochenes Wort hat keine natürliche Bedeutung, keine physei; es ist kata syntheken, durch die Übereinkunft gesetzt. Sein Inhalt ist auf keine weiteren Voraussetzungen zurückführbar, da es eine erste Substanz sein soll, die es als Laut aber nicht ist. Die Nomen verweisen auf einmalige, unteilbare, einzigartige „Sachen“, auf Individuen (atoma), die so, wie sie sind, unmittelbar wahr sind. Als gesprochene Worte sind sie aber relativ, ihre Wahrheit ist durch die Formen der Übereinkunft gebrochen. Zwischen dem kategorial gedachten/gefassten Wort (die erste Substanz) und dem auditiv- akustisch bestimmten Wort (das Nomen), zwischen dem Denken und dem sprachlichen Ausdruck bricht zunächst also eine heftige Konfusion auf. Sie wird noch gesteigert, wenn die Dinge in den kategorial vermittelten Worten ihre Namen erhalten.
Im Wort werden von Aristoteles drei „Elemente“ gedacht:
die Dinge (pragmata)
die Laute (phonai)
die Idee/das Denken (eidos, logos).
Der Wert des einen schließt den des anderen aus. Eine Erörterung der kategorialen Fassung des Wortes als Substanz kann diese innere Widersprüchlichkeit nuancierter entfalten.
b) Das Wort als Kategorie
Das Nomen wird kategorial als eine Substanz bestimmt.
„Substanz im eigentlichsten, ursprünglichsten und
vorzüglichsten Sinne ist die, die weder von einem Subjekt
ausgesagt wird noch in einem Subjekt ist ...“ (Aristoteles,
Kategorien, 2a,14). Überdies heißen die ersten Substanzen
deshalb im vorzüglichsten Sinn Substanzen, weil sie Subjekt
von allen anderen sind und alles andere von ihnen ausgesagt
wird.“ (aaO, 2b,20). Jede Substanz scheint ein Dieses zu
bezeichnen. Das, worauf man hier hinweist, ist unteilbar und
der Zahl nach eins.“ (aaO, 3b,12)
Das Nomen erfaßt zunächst das Wesentliche, das Wesenswas (ousia), to ti hen enai. Im Namen- Wort ist etwas enthalten, das in sich selbst und für sich selbst ist: Sokrates, der bestimmte Mensch Sokrates, Sokrates ist ein Mensch. Sokrates ist keine Bezeichnung von etwas, ist kein Prädikat, das von einem Subjekt ausgesagt wird. Sokrates ist einzigartig, individuell das, von dem ein Mensch- Sein ausgesprochen wird, to anthropo einai. Nicht das „Ein Mensch- Sein“ ist die erste Substanz, denn sie wird ja auf Sokrates bezogen, ist seine prädikative Bestimmung. Ist er als Mensch das, was ihn als Substanz bestimmt? Nein. Sokrates ist ein Mensch. Seine Eigenschaft als Mensch (und negativ: Sokrates ist kein Tier) wird von ihm als einem Subjekt ausgesagt, ist also auch in ihm. - Ist es sein Sein, das ihn als Substanz auszeichnet? Nein. Sokrates ist