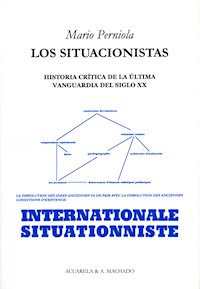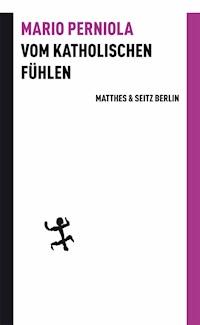
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Batterien
- Sprache: Deutsch
Der italienische Philosoph Mario Perniola konstatiert in dieser tiefgreifenden Studie, die nun endlich auf Deutsch erscheint, dass sich das Wesen des Katholizismus nicht in Lehre und Dogma ausdrückt, sondern in einer bestimmten Art zu fühlen. Bezugnehmend u. a. auf Ignatius de Loyola definiert er einen autonomen kulturellen Katholizismus, der geprägt ist von einem objektiven, rituellen, in der antiken römischen Welt wurzelnden äußerlichen Fühlen. Perniola macht dabei auch einen traditionellen Formalismus stark und geht so weit, darin die Möglichkeit zur Rettung einer Welt zu sehen, die sich durch ihren sentimentalen Subjektivismus selbst zersetzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
| Batterien NF n° 019 |
Mario Perniola
Vom katholischen Fühlen
[Del sentire cattolico]
Mario Perniola
Vom katholischen Fühlen
Die kulturelle Formeiner universellen Religion
Aus dem Italienischenvon Sabine Schneider
Inhalt
Vorbemerkung
Erster TeilWARUM ICH MICH NICHT ANDERS ALS »KATHOLIK« NENNEN KANN
I Ein Katholizismus ohne Orthodoxie
II Ein Glaube ohne Dogma
III Hoffnung ohne Aberglauben
IV Nächstenliebe ohne Demütigung
V Katholizismus, Humanismus und Differenz
VI Das rituelle Fühlen
Zweiter TeilDAS KATHOLISCHE FÜHLEN UND DIE DIFFERENZ DER WELT
VII Der Begriff der Differenz bei Francesco Guicciardini
VIII Die Wahl der Differenz bei Íñigo López de Loyola
SchlussKATHOLIZISMUS UND ÄSTHETIK
Anhang
Anmerkungen
Vorbemerkung
Als ich das Buch »Del sentire« (Über das Fühlen) veröffentlichte, machte mich mein Freund Giorgio Tagini, mit dem ich mich seit Kindheitszeiten über den Katholizismus unterhalte, darauf aufmerksam, dass ich sämtliche Formen des antiken und modernen Fühlens der westlichen Welt abhandelte, alle außer der einen, der christlichen. Zu einem Teil nun fülle ich diese Lücke und widme meinem Freund Tagini die vorliegende Arbeit. Allerdings möchte ich ihn damit natürlich keinesfalls in diese – seiner Einschätzung nach vermutlich sehr waghalsige – Unternehmung hineinziehen. Mutig in meinen Augen erschien mir dagegen immer seine Ansicht, wonach uns allein das Erbe der klassischen Antike dazu verhelfe, den Fanatismus ebenso wie den Geist von Splittergruppendasein und Sektenwesen zu überwinden, die heutzutage anscheinend auf die gesamte Gesellschaft übergreifen und dort auch selbst noch persönlichste und vertrauteste Beziehungen beeinträchtigen. Herauszufinden, wer anders denkt und fühlt, ergibt sich überdies wie nebenbei als nicht unerhebliche Konsequenz aus dem tiefgründigen Zusammenhang zwischen Philosophie und Freundschaft.
Erster Teil
Warum ich mich nicht anders als »Katholik« nennen kann
I
Ein Katholizismus ohne Orthodoxie
Kann man sich als Katholik fühlen, ohne an den sakramentalen Charakter der Ehe zu glauben? Oder sich als Katholik fühlen, ohne Glauben an die Unfehlbarkeit des Papstes? Oder sich als Katholik fühlen, ohne an die Göttlichkeit von Jesus Christus zu glauben? Diese Fragen sind nur solange unsinnig, als man von vornherein eine unauflösliche Beziehung zwischen Katholizismus und dem Einverständnis mit den Doktrinen voraussetzt. Die Doktrinen wiederum gibt die Kirche als von Gott und der Form nach als Offenbarung erhaltene und insofern als nicht reformierbar aus. Wer gegenüber einem solchen Standpunkt die Doktrinen in Zweifel zieht oder ablehnt, begibt sich sozusagen umstandslos aus der katholischen Kirche hinaus und muss als ein Häretiker angesehen werden. Und wer die auf dogmatischem oder moralischem Feld liegenden Doktrinen ablehnt, etwa weil sie formal nicht als Offenbarung erhalten, sondern vom Papst oder dem Konzil des versammelten Bischofskollegiums feierlich beschlossen sind, kann gleichfalls ebenso wenig in voller Glaubensgemeinschaft mit der katholischen Kirche gesehen werden.1
Lässt sich nun aber der Katholizismus schlechthin mit dem identifizieren, was die Kirche über sich selbst aussagt? Ist diese Konzeption nicht zu dürftig, nicht zu beschränkt für ein immenses kulturelles und geistiges Erbe, das auf das Mittelalter zurückgeht und in der Antike wurzelt? Geht bei der Identifikation von Katholizismus und Selbstauslegungen der katholischen Kirche nicht etwas Wesentliches für die Natur selbst des katholischen Fühlens verloren? Mir scheint es in der Tat einer Verarmung der Katholizität als solcher gleichzukommen, das Katholischsein davon abhängig zu machen, dass jemand einer Orthodoxie, einem als unfehlbar ausgegebenen, doktrinären System anhängt; und insofern neige ich doch eher dazu, den Wesenskern der Katholizität weniger im Glauben, als vielmehr im Fühlen, nicht im Einverständnis mit der Doktrin, sondern in der Möglichkeit einer spezifischen, durchaus universalisierbaren Erfahrung auszumachen.
Dabei ist es gewiss nichts Neues, den Wesenskern einer Religion ins Fühlen zu verlegen: Ende des 18. Jahrhunderts hat der Theologe Schleiermacher sogar den Wesenskern von Religion an sich im Fühlen und nicht im Denken noch im Handeln gesehen. Er ging bei seiner radikalen Bedeutungsabwertung des Glaubens so weit, dass er im Hinblick auf die religiöse Erfahrung sogar den Gottesbegriff für sekundär hielt. Seines Erachtens ist der Glaube an einen Gott lediglich eine Frage nach der Ausrichtung der Phantasie: Die Gottesvorstellung rangiere in der Religion längst nicht so weit oben, wie gemeinhin angenommen, »auch gab es unter wahrhaft religiösen Menschen nie Eiferer, Enthusiasten oder Schwärmer für das Dasein Gottes«2. Seine Darlegungen führen Schleiermacher trotzdem nicht bis an den Punkt, einer unbestimmten natürlichen Religiosität das Wort zu reden: Er behauptet im Gegenteil den Primat der positiven Religionen im Allgemeinen und des Christentums im Besonderen über die Idee der natürlichen Religion, die ihm zu armselig, dürftig, unbestimmt und oberflächlich erscheint. Wenn der Wesenskern der Religion allgemein aus Gefühl bestehe, ergebe sich als Besonderheit für das Christentum, eine Art »Religion der Religionen«, eine hochpotenzierte Religion zu sein, weil sich in ihm die Erfahrung der Subjektivität als über die Maßen gesteigert erweise: Das Gefühl werde von einer Art Unersättlichkeit erfasst, die es zur Abkehr von allem Äußerlichen und Fremden bewege und es schließlich Anspruch auf unausgesetzte Seeleneinkehr erheben lasse.3
Ein solch großes Gewicht auf der Subjektivität des religiösen Gefühls ist eng mit der Reformation verbunden, in die sich Schleiermachers Denken einordnet; immerhin hält er den Katholizismus nicht für eine Entstellung des Christentums, wie sehr er ihm einen eigenen, klar unterschiedenen und dem Protestantismus in mancher Hinsicht gegenläufigen Geist zuschreibt. Die Gegensätzlichkeit besteht in einer unterschiedlich eingerichteten Abhängigkeit. So sehe der Protestantismus das Verhältnis zwischen Individuum und Kirche von eben der Beziehung abhängen, die das Individuum unmittelbar zu Jesus Christus unterhält, während der Katholizismus das Verhältnis zwischen Individuum und Jesus Christus dagegen umgekehrt der Vermittlung durch die Kirche unterordne.4 Im Katholizismus weist sich, anders gesagt, die kirchliche Institution selbst eine weit größere und bestimmendere Bedeutung zu, als sie den evangelischen Kirchen vonseiten ihrer Gläubigen zuerkannt wird, womit nun aber keineswegs einhergeht, dass sich daraus eine von allen anderen Religionen qualitativ verschiedene religiöse Erfahrung entwickelte. Für Schleiermacher gibt es kein »katholisches Fühlen«, das sich vom protestantischen Fühlen etwa abhöbe: Wie sehr sich die religiöse Erfahrung auch in unendlicher Vielfalt äußere, bleibe doch ihr wesentliches Kennzeichen ein inneres, vertrautes Fühlen.
Genau dieser subjektive Aspekt, den die Spiritualität der Reformation eindringlich herausgestrichen hat, stellt für Schleiermacher das Paradigma jeder religiösen Erfahrung dar. Die Ratlosigkeit angesichts einer solchen Konzeption des religiösen Phänomens ließe sich folgendermaßen formulieren: Wenn der Angelpunkt jeder Religion im subjektiven Fühlen ausgemacht ist, wird dann nicht durch diese Festlegung unbemerkt ein besonderer Typ von Fühlen verallgemeinert, der überwiegend – wenn auch nicht ausschließlich – zur Spiritualität des Protestantismus gehört? Werden auf diese Weise nicht andere Modalitäten des religiösen Fühlens verdeckt oder verkannt, die beispielsweise der rituellen, zeremoniellen und institutionellen Dimension vorrangige Bedeutung einräumen? Oder die das Verhältnis zum Außenbereich, zu den Dingen, zur Welt anders gestalten? Oder die, viel einfacher noch, der Innerlichkeit nicht den absoluten und unangefochtenen Primat zuweisen, der ihr von der Tradition der Reformation beigemessen wurde? Warum nur muss Äußerlichkeit eigentlich Synonym für Nicht-Religiosität sein und die Erfahrung von Welt zu einer erkenntnisgerichteten und praktischen, nicht jedoch gefühlsbezogenen Haltung führen?
Nun hat es aber in Wirklichkeit neben dem »von innen Fühlen« der religiösen protestantischen Kultur in den mehrtausendjährigen Geschicken des Abendlandes durchaus auch ein »von außen Fühlen«5 gegeben. Aus seinem Verständnis erwächst die Erkenntnis eines »katholischen Fühlens«, das mit autonomen Zügen ausgerüstet sich gerade nicht auf das subjektive Gefühl eingrenzen lässt. Im Unterschied zum »von innen Fühlen«, zu dessen Erfolg die subjektivistische Ausrichtung der modernen Philosophie (von Descartes und Kant an bis zum Idealismus und Spiritualismus des 17. und 18. Jahrhunderts) ihr nicht unwesentliches Scherflein beigetragen hat, ist das »von außen Fühlen« nicht nur von der protestantischen Kultur vollkommen achtlos übergangen, sondern auch noch vonseiten der katholischen Kultur verdrängt worden; diese hatte einerseits zum subjektiven protestantischen Gefühl eine Haltung der mimetischen Rivalität eingenommen und sich zum anderen gleichzeitig mit ganzer Aufmerksamkeit auf den erkenntnisspezifischen und den praktischen Aspekt der Religion konzentriert. Vor allem diese letzten beiden Aspekte – die wir mit den Begriffen »Orthodoxie« und »Orthopraxis« bezeichnen können – haben die katholische Identität im Allgemeinen bestimmt.6 Auf der Ebene des Fühlens dagegen scheint die katholische Erfahrung im ersten Hinsehen keine eigenen Besonderheiten aufzuweisen: Wenn sie sich nicht (wie im Jansenismus) auf die Subjektivierung des Fühlens zubewegt, richtet sie sich auf den Mystizismus7 oder auf emotionale und charismatische Gemeinschaften. Ins Wesen des Katholizismus gehört jedoch keine dieser Formen von religiösem Fühlen, die sich so auch in anderen Religionen auffinden lassen.
Es ist vielmehr im Bereich von Überzeugung und Handlung, in dem sich der Katholizismus mit einer eigenen unverwechselbaren Physiognomie zeigt, die ihn zu einem ideologisch-politischen Apparat sondergleichen formt. Wenngleich dieses Modell durchaus Gefahr läuft, den Katholizismus nicht in seinem Wesen, sondern in einem Zerrbild darzustellen. Es verfügt und gemahnt den Intellekt und die Willen der einzelnen Individuen zur vollen und unwiderruflichen Anerkennung von Doktrinen und Vorschriften, was an sich schon heißt, dass eine Institution, deren eigentliche Bedeutung in ihrer formalen autonomen und selbstgenügenden Wesenheit liegt, in subjektivistische und operative Begriffe übersetzt wird.
Es war der deutsche Staatsrechtler Carl Schmitt, der gültig für die zeitgenössische Welt in der römisch-katholischen Kirche den letzten und grandiosesten Ausdruck des Prinzips der formalen Repräsentation in ihrem dreifachen, ästhetischen, juristischen und politischen Aspekt gesehen hat.8 Diese drei Dimensionen müssen als voneinander untrennbar aufgefasst werden. So würde der schiere Glanz ohne juristische Wertigkeit und politische Wirklichkeit in der Tat zu bloßer Dekoration absinken; eine juristische Form ohne ästhetische Repräsentation und politische Rationalität wäre privatistischer, nicht öffentlicher Natur; und eine politische Wirklichkeit ohne künstlerische Sichtbarkeit und juristische Sanktion könnte nicht über ein gewisses selbstzerstörerisches Taktieren hinausreichen. Die katholische Kirche, folgt daraus, stellt als höchster Ausdruck einer institutionellen und sichtbaren Rationalität für Schmitt den einzigen, wirklichen Widerstand gegen die technisch opportunistische Rationalität der Moderne mit ihrem ikonoklastischen, kontraktualistischen und vitalistisch unmittelbaren Wesen dar. Anders formuliert, liegt in der modernen Welt, Schmitt zufolge, ein fundamentaler Konflikt vor. Auf der einen Seite der technisch ökonomische Rationalismus mit seiner sich politisch äußernden Idee der Repräsentation, die sich in ihrer radikalsten Form den Delegierten als stets abrufbaren Mandatsträger vorstellt. Auf der anderen Seite ein institutioneller Rationalismus, der nicht abgeneigt ist, eine fundamentale Rolle der Idee der Repräsentation beizumessen, die Wert und Würde nicht allein Repräsentanten und Repräsentiertem, sondern ebenso dem Dritten, dem Adressaten zuerkennt, an den sich die ersten beiden wenden.
Carl Schmitt erarbeitet hier eine Theorie der abendländischen Religion, die sich wie eine Antithese zum sentimentalen Theoriegebäude Schleiermachers liest. Während Schleiermacher durch eine anti-institutionelle Voraussetzung geprägt ist, lehnt Schmitt »die dunkle und weitverbreitete Stimmung, [die] die institutionelle Kälte des Katholizismus als böse [empfindet]«9 ab und erachtet alles das als »flach«, was im Fühlen stecken bleibt; eine solche Gefühlstonalität scheint ihm zu sehr von dem »unförmigen Ungeheuer« des modernen Subjektivismus abzuhängen. Die Kirche stellt für Schmitt »im größten Stil die Trägerin des juristischen Geistes und die wahre Erbin der römischen Jurisprudenz«10 dar; genau deswegen zeige sich einer ihrer vordringlichsten Aspekte im Universalismus, der sie sowohl von der Sekte als auch von »Gottes Volk« unterscheide. Sie strebe nach Größerem, danach, sich mit der civitas humana gleichzusetzen. In dieser Hinsicht greife der Begriff des ideologisch politischen Apparates viel zu kurz, um ihr Wesen zu erfassen; und selbst Begriffe wie »Orthodoxie« und »Orthopraxis« schienen noch zu subjektivistisch, weil sie glauben machten, der rechte Weg für das Subjekt liege im Einverständnis mit den Dogmen und im Gehorsam gegenüber den Geboten. Stattdessen äußere und entwickele sich in der katholischen Kirche weiterhin der antike römische Gedanke vom officium fort, das weder Charisma noch Technik, sondern eine Art Darstellung und unpersönliche Handlung sei, in der sich die Form nicht von der Substanz, der Schein nicht von der Wirklichkeit, die Würde nicht von der Wirksamkeit und das Persönliche nicht vom Institutionellen trennen lasse.
Ein machtvolles Bild von der katholischen Kirche, in dem soweit jedoch noch jeder Hinweis auf ein spezifisches Fühlen fehlt, beinahe so, als wären die Katholiken lauter Automaten, einzig und allein fähig zu symbolischer und praktischer Tätigkeit. Gewiss wird der Formbegriff eindringlich unterstrichen, der eben auch dem ästhetischen Bereich zugehört. Doch was soll das heißen, die Form fühlen, die Repräsentation, das officium fühlen? Die Falle des Subjektivismus lockt und lauert auf Schritt und Tritt, um uns wieder an eine protestantische Konzeption des Fühlens zurückzubinden und dort in die Anordnungen von Orthodoxie und Orthopraxis mit »du musst daran glauben« und »du musst das und das tun« einzusperren. Am Ende womöglich noch in ein »du musst das und das fühlen«!
Genau solche Anordnungen scheinen mir nun eben wenig katholisch zu sein. Auf der einen Seite machen sie zu viel Wesens um die individuelle Subjektivität, weil sie den Mittelpunkt der Erfahrung ins Gewissen des einzelnen Individuums und damit an einen Ort legen, der wie kein anderer, heutzutage eine wüste Landschaft aus unendlichen, wirren Leiden, zerbrechlich und unsicher geworden ist. Und auf der anderen Seite sehen sie dabei vollkommen von den einzelnen Fällen und den speziellen Situationen ab, denen das Individuum immerhin die Stirn bieten muss und denen durch Rückgriff auf absolute Prinzipien und unhinterfragbare Gebote keineswegs angemessen begegnet werden kann. So kommen Zweifel auf, der Verdacht entsteht, dass der eindrucksvolle dogmatische Panzer, den sich die katholische Kirche im Laufe der Jahrhunderte angelegt hat, und dass das unablässige die Schrauben-fester-Anziehen, vom Konzil von Trient an bis heute, um die Zahl der Glaubensfragen und Moralkodizes kontinuierlich zu erhöhen und dem einzelnen Willen und dem einzelnen Intellekt striktes und definitives Einverständnis mit ihnen oder religiöse Ehrfurchtsbezeigung vor ihnen abzuverlangen, der Verdacht also, dass die Unnachgiebigkeit und die Radikalität, mit denen die Kirche ihre Glaubenswahrheiten verfochten hat, eigentlich nicht ins Wesen des Katholizismus gehören. Ich frage mich, ob alle diese Aspekte, die ihrer Tendenz nach den Katholizismus in einen ideologisch politischen Apparat umformen, nicht viel eher als defensive Mechanismen in den Auseinandersetzungen mit den Angriffen, Ablehnungen und Ableugnungen gedient haben, die die Kirche seit dem 16. Jahrhundert auf ihrem Weg angetroffen hat.
In der Rigidität von Orthodoxie und Orthopraxis wird im Allgemeinen, auch auf Seiten einiger Katholiken, ein Vermächtnis des Mittelalters gesehen, das der Katholizismus über die Jahrhunderte mit sich herumschleppe, ohne dass er je den Mut zu einer unverstellten und eingehenden Gegenüberstellung mit der Moderne und der von ihr implizierten Ernüchterung aufgebracht hätte. Ich tendiere dagegen eher zu der Sichtweise, die doktrinäre und moralistische Verhärtung mehr als eine Folge des hitzigen und vergifteten kulturellen und religiösen Klimas zu begreifen, dem der Katholizismus immer wieder unvermutet hat die Stirn bieten müssen. Also jenem antirömischen, antipäpstlichen und antiklerikalen »Komplex«, der – wie Schmitt sagt – die letzten Jahrhunderte der europäischen Geschichte aufgewühlt hat.11 Was Ernüchterung und Säkularisation anlangt, so müssen diese vermeintlichen Implikationen der Moderne ein Vorrecht einiger weniger ebenso aufgeklärter wie wirkunglos gebliebener Personen gewesen sein, denn das neue Zeitalter, das mit der Französischen Revolution heraufzog, wurde gleichzeitig von einer intensiven und umfangreichen Sakralisierung kollektiver Wesenheiten wie die der Nation oder der Partei begleitet.12
So sieht es aus, als ob der Katholizismus von der Mitte des 16. Jahrhunderts an allmählich Stück um Stück auf seine Identifikation mit der civitas humana verzichtet habe; unter dem Drang der Sorge darum, sich eine über alle Zweifel absolut erhabene Identität zuzulegen, hat er sich in einen Prozess der mimetischen Rivalität mit seinen Gegnern gestürzt und dabei die Voraussetzungen, die seine tatsächliche Universalität eigentlich ermöglicht hätten, nach und nach aufgegeben. Der erste Schritt auf diesem Weg hat sich, wie gesagt, in der Subjektivierung der religiösen Erfahrung gezeigt. Dieser Vorgang mindert die Kirche auf ein »Bekenntnis« herab, das heißt, er lässt die Kirche von der intellektuellen und moralischen Gefolgschaft ihrer Gläubigen abhängen. Sich die Macht einer Institution abhängig von der Nachdrücklichkeit vorzustellen, mit der sie eine Orthodoxie und eine Orthopraxis definiert, die von den Mitgliedern gebilligt, angeeignet und konsequent befolgt werden müssen, enthält an sich schon ein Zugeständnis an den Subjektivismus. Sich dagegen auf den Katholizismus der Ursprünge und auf die Daseinsbedingung jener frühen Märtyrer zu berufen, die zum Tod bereit waren (und deshalb auch confessores genannt wurden), lenkt von der Suche nach dem Wesenskern des Katholizismus ab. Sehr viel berechtigter scheinen mir die Überlegungen des französischen Historikers Lucien Febvre zu den Modalitäten des religiösen Lebens in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts hierhin zu gehören.13 Zu jener Zeit war man Christ nicht aus Überzeugung, sondern de facto. Individuelle Teilnahme an den Kulthandlungen, intellektuelle Zustimmung zu den Dogmen, persönliche Gefolgschaft bei den Handlungen waren irrelevante Aspekte; alles geht seinen Gang, ohne dass man darüber nachdenkt, »ohne dass sich überhaupt jemand die Frage stellt, ob es auch anders ablaufen kann, anders ablaufen soll«. Diese Verhältnisse, die für Febvre die absolute und uneingeschränkte Vorherrschaft der Kirche über die Welt unter Beweis stellen, weisen aber noch auf einen anderen Aspekt, und zwar auf die absolute und uneingeschränkte Vorherrschaft der Welt über die Kirche hin. Die Identifikation zwischen Welt und Kirche bleibt meines Erachtens ein entscheidender Zug der katholischen Sensibilität, er darf nur nicht in theokratischem noch auch in temporalistischem Sinn aufgefasst werden. Mir scheint es, dem katholischen Fühlen zu widerstreben, die Welt als den Ort schlechthin des Bösen, des Verfalls und der Ungerechtigkeit zu definieren, von dem man sich fernhalten und abwenden muss,14 und in der Kirche umgekehrt eine Gemeinschaft der Vollkommenen und der sich Vervollkommnenden zu erblicken. Der Universalismus, wie er dem Katholizismus innewohnt, schließt unausgesprochen ein, der neoplatonisch oder gnostisch inspirierten Tendenz zur Weltverdammnis und ebenso der im Verlauf der christlichen Geschichte stets wiederkehrenden Versuchung, die Kirche als Sekte zu denken, abzuschwören.
Es mag nun auf den ersten Blick also paradox und provokativ erscheinen, wenn wir auf unserer Suche nach den wesentlichen Charakterzügen des katholischen Fühlens dem Katholizismus aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts paradigmatisches Gewicht verleihen. Diese Epoche hat tatsächlich allgemein und über lange Zeit hinweg als ein ausgesprochen unglückseliger Geschichtsabschnitt der Kirche gegolten. So sollen das üble Betragen so manches Pontifex und die religiöse Ignoranz des Klerus, aber auch das Vorherrschen einer weit näher an der klassisch heidnischen Welt als an Jesus Christus verorteten Mentalität zu den Gründen gezählt haben, die entscheidend zum Erfolg der Reformation beigetragen hätten. Die jüngste Geschichtsschreibung streitet diese Situation denn auch nicht ab. In jener Zeit, man stelle sich das vor, soll es bis auf ganz wenige vereinzelte Ausnahmen keine Einrichtung für die Ausbildung der Priester gegeben haben! Der Historiker Jacques Le Goff bezeichnet die christliche Welt im 16. Jahrhundert förmlich als »ein Missionierungsgebiet«!15 Trotzdem steigen derzeit viele Zweifel an der Frage auf, ob es wirklich an der üblen Lebensführung des Klerus gelegen hat, dass ein Teil Europas auf der Seite der Reformation gestanden hatte. Jean Delumeau fragt sich, »ob der klerikale Korpus in seiner Gesamtheit um 1500 nicht vielleicht noch anrüchiger denn um 1074 dagestanden hat, als die Synode in Rom unter Gregor VII. die Simonie, den Ablasshandel, die Ehe und die ausschweifenden Lebensgewohnheiten der Geistlichen verurteilte.«16
Dieser Epoche nun trotz des »elenden Zustands«17, in dem sich die Kirche nach den Worten der Reformatoren sowohl doktrinär wie moralisch befand, dennoch besonderen Hinweischarakter zuzuerkennen, folgt untrennbar der theoretischen Grundentscheidung, aus der dieses Buch hervorgeht: Das heißt, die besondere Art und die Kraft des »katholischen Fühlens« gerade nicht dort zu suchen, wo Orthodoxie und Orthopraxis scheinbar energischer und standfester auftreten, sondern dort, wo sie beinahe nicht vorhanden sind, wo Wahrheit und Tugend nicht nur keiner Prüfung mehr standzuhalten brauchen, sondern überhaupt auch die Vorstellungen von ihnen nahezu erloschen sind. Im Vergleich zu Ideologie und Moralismus, zu denen sich der Katholizismus hat flüchten müssen, um dort Schutz vor Angriffen zu finden, denen er sich über mehr als ein halbes Jahrtausend ausgesetzt gesehen hatte, liegt die Differenz des Katholizismus gerade in der Tatsache, dass sein Fühlen auch und besonders in einer Situation wie eben der in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts überleben und sich dort uneingeschränkt äußern kann. Ich denke hier an die Bewegung der devotio moderna, die in jener Epoche zu ihrer Blüte herangereift war und den Akzent auf die religiöse Erfahrung legt, statt auf doktrinäre Inhalte oder moralische Pflichten zu achten. Und ich frage mich, ob die beiden Autoren Francesco Guicciardini und López de Loyola, denen der zweite Teil dieses Buches gewidmet ist, nicht als Folgen dieser Sensibilität betrachtet werden können. Diese beiden Autoren so nah zusammenzurücken, mag misstönend klingen, denn wir kennen Guicciardini gewöhnlich als den Theoretiker des krudesten politischen Realismus und López de Loyola als den Gründer eines religiösen Ordens, der Compañía de Jesús, Gesellschaft Jesu [und späteren Jesuitenordens], die im Verein mit der Controriforma, der Gegenreformation grundlegend zu der doktrinären und moralischen Wende der Kirche beigetragen hat. Ein bizarrer Ton also, den Florentiner Politiker und den baskischen Mönch als Exponenten eines orthodoxiefreien Katholizismus näher betrachten zu wollen: Und in der Tat scheint Guicciardini so gut wie gar nicht katholisch, ja nicht einmal religiös zu sein,18 während Íñigo López de Loyola durch sein Obedienzgelübde an den Papst und vor allem durch die Rolle, die sein Orden in den folgenden Jahrhunderten gespielt hat, schon beinahe zu katholisch wirkt. Diese Wahrnehmungen haben sich jedoch meiner Einschätzung nach erst als Folgen der ideologischen und moralischen Interpretationen eingestellt, denen die beiden vor allem im 19. Jahrhundert ausgesetzt sind:19 Sie haben regelrecht überschattet, was das Eigentümliche ihrer Erfahrung ausmacht, nämlich das Verstörende, das absolut Andere, die Differenz nicht (wie die Reformation) in Gott und in der menschlichen Subjektivität, sondern in der Welt und in ihrer Geschichte zu entdecken. Guicciardini ist immer tief in die Problemstellungen des Katholizismus hinein verwickelt gewesen, das darf man hier tatsächlich nicht vergessen, und zwar nicht nur im politischen und diplomatischen Rahmen seiner Eigenschaft als Verwalter der vatikanischen Provinzen und als päpstlicher Gesandter bei wichtigen Fragen, sondern vor allem in philosophischer Hinsicht als tiefgründiger Denker über den Geschicken der Kirchengeschichte, die er selbst über weite Strecken hin als Zeuge begleitet hat. Seine »Storia d’Italia« (Geschichte Italiens), die Francesco de Sanctis – seiner kritischen Einstellung gegenüber Guicciardini zum Trotz – als das »Bedeutendste« bezeichnet, was »je aus einem italienischen Geist hervorgegangen ist«20, reflektiert in außergewöhnlicher Weise den historischen Prozess, seine äußerste Komplexität und die Unvorhersehbarkeit seiner Entwicklung. Und von Íñigo López de Loyola ist altbekannt, dass er sich bei der Lösung weltlicher Fälle seiner Zeit unermüdlich eingesetzt hat21 – Zeugnis dafür geben seine Briefe, sein Epistolario, Briefwechsel; weit weniger bekannt, aber sehr viel relevanter ist die Tatsache, dass seine »Exercitia spiritualia« (Geistlichen Übungen) von allen befolgt werden können, auch von Nicht-Gläubigen, von Ungläubigen und Heiden.22 Das Gewicht liegt hier gerade nicht auf der Verpflichtung, an Gott zu glauben, und auch nicht auf den Geboten, sondern auf der Erfahrung des Übenden, der entlang eines Stückes Wegs, abgesteckt mit affektiven Erfahrungen, seinen eigenen Weg in der Welt oder die Lösung für seine besondere Fragestellung finden soll. Der Mittelpunkt des religiösen Fühlens liegt eingebettet in das Rätsel um den »Willen Gottes«: Dabei richtet sich die Aufmerksamkeit, nicht anders als bei Guicciardini, auf die Geschichte, auf die Welt, darauf, wie die Dinge hier unten voranschreiten werden, ob »tröstlich« und »zu Gottes Ehren« oder trostlos, niedrig, schmachvoll. In einer Zeit, in der, wie Guicciardini sich zuweilen äußert, die Güte des Pontifex gelobt wird, wenn sie die Boshaftigkeit anderer Menschen nicht noch übertrifft,23 erscheint eine religiöse Sensibilität, die so fest in der Immanenz verankert ist, dass sie von jedweder Orthodoxie und Orthopraxis absehen kann, wie der letzte Verteidigungswall gegen den gänzlichen Untergang der Religion. Dieser Katholizismus ohne Glauben an die Transzendenz und ohne Gewissensimperative wäre, anders gesagt, ein Christentum auf einfachstem Nenner, das sich der Welt so weit angepasst hätte, dass der religiösen Handlung jeder spezifische Charakter genommen wäre. Genau dies ist eine der Bedeutungen im Begriff Säkularisation.24 Folglich wäre in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine weitgehende politisch soziale Transparenz dadurch erreicht, dass die weltliche Macht des Papsttums und die Vorurteilslosigkeit der italienischen Renaissance aufeinandertreffen. Praktische Tätigkeit und theoretische Reflexion Guicciardinis wären zusammen mit dem großartigen Unterfangen, das Íñigo López de Loyola entwickelt und eingeleitet hat, als ein machtvoller Ausdruck der besonderen Charaktergestalt des Katholizismus zu werten. Diese müsste in einem »äußeren Fühlen« aufgespürt werden, verstanden als Übereinstimmung und Mitarbeit an einem historischen Prozess (auch »Wille Gottes« genannt), der sich immer rätselhaft und vieldeutig ausnimmt.
Den Begriff »Säkularisation« so aufzufassen, dass der Katholizismus des 16. Jahrhunderts als säkularisierte Religion des Abendlandes in Betracht gezogen werden könnte, widerspricht anderen Anwendungsmodi dieses Wortes. Ganz sicherlich meint er das genaue Gegenteil von Privatisierung der Religion, weil er nicht – wie die protestantische Mentalität – die Subjektivität des Individuums in den Vordergrund rückt, sondern die Welt und ihre Dynamik. Und ebenso tiefgreifend hebt er sich von der Modernisierung, gesehen als technisch wissenschaftliche Projekthaftigkeit, und deren Anspruch ab, die Welt vollkommen unter ihrer Kontrolle zu haben. Unser Begriff von »Säkularisation« impliziert hier vielmehr, sich in eine Feinsinnigkeit des Fühlens und Denkens einzuüben, die sich unentwegt auf das Unberechenbare und Unvorhersehbare gefasst macht. Schließlich ist zweifelhaft, dass »Säkularisation« mit Ernüchterung, Entweihung und Niedergang der religiösen Dimension zusammenfällt. Denn bei Guicciardini und López de Loyola sind es ausgerechnet die Vorgänge in der Welt, die das Erstaunen und die Verwunderung hervorrufen. Diese Sensibilität ließe sich in einem einzigen Satz umgreifen: »Nichts vermag mich zu ernüchtern, denn die Welt hat mich verzaubert!« Was dies Verhältnis zwischen Heiligem und Profanem angeht, so bezeichnet der Horizont, in dem sie liegen, dass beide Kategorien radikal neu überdacht und in den Begriffen einer Ineinssetzung von mehr-alsheilig und mehr-als-profan25 interpretierbar werden.
Nun ist die Versuchung groß, Übereinstimmungen zwischen der religiösen Situation des italienischen 16. Jahrhunderts und den heutigen Gegebenheiten zu erkennen. So scheint sich unsere Zeit auch tatsächlich mit der Zeit der Spätrenaissance einen wirklich umfassenden, allen Dingen der Transzendenz gegenüber wuchernden Unglauben zu teilen; sie ist deshalb auch schon die Epoche im Zeichen von »Gottes Tod«, die Epoche des Nihilismus, des Untergangs aller Werte genannt worden. In einer so beschaffenen Situation, für die es charakteristisch ist, dass sie alles Wissen auf das empirisch Beobachtbare und alles Verhalten auf das ökonomisch Nützliche beschränkt, läge für die Religion eine letzte Chance gerade im Appell an die Dimension der Erfahrung, darin, Erfahrung so in Richtung auf ein weltliches Fühlen hinzuentwickeln, dass sie nicht an die uns umfließende Struktur der technisch ökonomischen Plausibilität anstößt. Der Katholizismus der verweltlichten Form, wie er sich bei Guicciardini und López de Loyola zeigt, wäre für die heutige Welt also die geeignetste Form von Christentum, weil sie Elemente des Wissens um die Differenz einführt und zu einem ernsthaften und vernünftigen Verhalten anleitet, ohne jede erkenntnisbezogene oder moralische Verpflichtung und das heißt ohne jede Orthodoxie und Orthopraxis. Diese Form von Katholizismus erwiese sich darüber hinaus als die einzige wirklich ökumenische Form. Denn sie wäre zum Einklang mit dem Hinduismus und dem Buddhismus – auch und vor allem dann – in der Lage, wenn die großen asiatischen Religionen ihr atheistisches und amoralisches Äußeres zutage treten lassen, das bei den Anhängern von Monotheismus und Integralismus für Beunruhigung sorgt.26 So hätte das katholische Fühlen von Guicciardini und López de Loyola mithin den Vorteil einer doppelten Universalität. Es wäre zum einen mit der westlichen Technowissenschaft und zum anderen mit der orientalischen Spiritualität kompatibel und verliehe Rom auf diese Weise eine Art symbolischer Äquidistanz zwischen New York und Benares.
Gleichwohl ist die gesamte Theorie der Säkularisation erst kürzlich einer Neuüberprüfung unterzogen worden. Weite Bereiche der Religionssoziologie haben im Verlauf der letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts ihre Zweifel geäußert, ob der Verfall der religiösen Öffentlichkeit und ihre Eingrenzung auf eine rein individuelle Angelegenheit tatsächlich die überwiegende Tendenz in der Welt sei; so fügten sich die islamische Revolution, das Erstarken des protestantischen Fundamentalismus und die religiöse Politik von Johannes Paul II. doch wohl eher im Sinne einer Desäkularisation und einer Deprivatisierung der Religion ein.27 Welchen Glauben soll man dieser im Interesse aller monotheistischen Religionen operierenden Sichtweise schenken? Für den amerikanischen Soziologen Peter L. Berger, einen der wenigen Erforscher der zeitgenössischen Religion, der Fühlen und Erfahrung als den wesentlichen Aspekt im Phänomen ›Religion‹ ansieht, machen Verlogenheit und Nichtigkeit den inneren Kern in den meisten modernen Versionen des Neotraditionalismus aus.28 Dieser wäre dennoch keineswegs in der Lage, eine Tendenzwende im Prozess der Modernisierung herbeizuführen. Letzterer würde ohnehin, so Bergers Ansicht, keine Dekadenz der Religion nach sich ziehen, sondern eher zu einem Pluralismus im religiösen Angebot führen. Das Individuum wäre dann aufgefordert in ihm nach Vorliebe auszuwählen, mit derselben Geisteshaltung, mit der es auch in den Auslagen eines Supermarkts seine Auswahl träfe. Es liegt auf der Hand, dass in einem solchen Zusammenhang der Charakter der Notwendigkeit, des Unabwendbaren, der Fatalität wirklicher religiöser Zugehörigkeit abhanden gekommen ist. Wer einer Religion »bis auf weiteres« angehört, für den greift die traditionalistische Option nicht tiefer als die liberalistische. Andererseits ist das ernüchterte, empirische und nützlichkeitsorientierte Denken auch nicht weniger inkonsistent als sein Gegenteil. Zwischen Unglauben und Fanatismus würde sich daher ein gefährliches Kommen und Gehen einrichten, das Orthodoxie wie Häresie, Sünde wie Reue um ihren Sinn brächte.
Berger meint daher, dass sich in unserem Zeitalter ebenso viel Gläubigkeit wie in den vorhergehenden Zeiten rege; wahrscheinlich sogar noch weit mehr, denn sich über wirklich Wichtiges Gewissheit zu verschaffen, sei heutzutage schwieriger geworden, wie mindestens ebenso, sich umgekehrt gewissen Meinungen zu entziehen, die, wie sehr an sich auch vollkommener Blödsinn, von der Mehrheit provisorisch gleichwohl doch geteilt werden. Der großartige Skeptizismus und die Vorurteilslosigkeit der katholischen Spätrenaissance können – um Berger zu paraphrasieren – unserem »gläubigen Zeitalter« als ein »längst verloschener Glorienschein« leuchten.
Trotzdem gilt es zu verstehen, durch welche Prozesse der Katholizismus jener rationalistischen Dimension verlustig ging, die das Fühlen von Guicciardini und López de Loyola auszeichnete und die Carl Schmitt noch als einen der wesentlichen Züge des Katholizismus betrachtet.29 Paradoxerweise scheint dieser Verlust eng mit den Anschüben zu Modernisierung und »Aggiornamento«, also Öffnung oder Anpassung an heutige Verhältnisse, dem »aufden-heutigen-Stand-Bringen«30