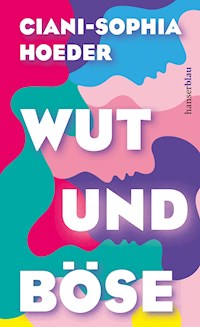15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als Ciani-Sophia Hoeder 14 Jahre alt war, ging sie mit ihrer Mutter das erste Mal zur Berliner Tafel. Sie erzählte niemandem davon, schämte sich, dass ihre Familie arm war – denn Armut ist ein Schimpfwort, ein Symbol des persönlichen Versagens. Dass es sich in Wahrheit um ein strukturelles Problem handelt und sozialer Aufstieg in Deutschland längst nicht so leicht möglich ist, wie gern suggeriert wird, wurde ihr erst später klar. Ciani-Sophia Hoeder beleuchtet die Schnittstellen von Geld, Scham und Macht und zeigt, wie Klasse sich mit anderen Diskriminierungsformen vermischt. Sie spricht mit Expert:innen, Aktivist:innen, armen und reichen Menschen und macht deutlich, wie fehlende Chancengleichheit dieses Land prägt – und wie wir das ändern können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Als Ciani-Sophia Hoeder 14 Jahre alt war, ging sie mit ihrer Mutter das erste Mal zur Berliner Tafel. Sie erzählte niemandem davon, schämte sich, dass ihre Familie arm war — denn Armut ist ein Schimpfwort, ein Symbol des persönlichen Versagens. Dass es sich in Wahrheit um ein strukturelles Problem handelt und sozialer Aufstieg in Deutschland längst nicht so leicht möglich ist, wie gern suggeriert wird, wurde ihr erst später klar.Ciani-Sophia Hoeder beleuchtet die Schnittstellen von Geld, Scham und Macht und zeigt, wie Klasse sich mit anderen Diskriminierungsformen vermischt. Sie spricht mit Expert:innen, Aktivist:innen, armen und reichen Menschen und macht deutlich, wie fehlende Chancengleichheit dieses Land prägt — und wie wir das ändern können.
Ciani-Sophia Hoeder
Vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher
Die Lüge von der Chancengleichheit
hanserblau
Für Opa.
Ohne dich wäre ich nicht.
Ganz Grünau!
Intro: Du bist ein Original deiner Klasse
Als ich 14 Jahre alt war, ging ich mit meiner Mama das erste Mal zur Berliner Tafel. Wir nahmen unseren Einkaufstrolley, packten ein paar Tüten ein und machten uns auf den Weg. Das taten wir ein paarmal. Ich erzählte niemandem davon. Weder meinen Freund:innen noch in meinen Partner:innenschaften. Keiner Seele. Ich schämte mich. Meine Mama und ich waren arm. So wie jede Person, die dorthin ging. Manchen sah man es an. Anderen nicht. Damals hätten wir uns selbst niemals als arm bezeichnet. Armut war ein Schimpfwort. Ein Symbol des persönlichen Versagens. Etwas, wofür die jeweilige Person oder Familie selbst verantwortlich war. Wir, die Armen, sollten uns dafür schämen. Heute weiß ich, dass es sich um ein strukturelles Problem handelt, das gern als individuelles Versagen abgetan wird. Es geht um Klassen.
Was ist, wenn ich dir sage, dass dein Leben vorbestimmt ist? Dein Berufszweig, dein Vermögen, wo du lebst, was dich bewegt, was du ästhetisch findest, wen du liebst und heiratest — sogar wie alt du wirst. Dabei spreche ich nicht von einer spirituellen oder göttlichen Macht, sondern von sozialen Klassen. Wir werden in unser Schicksal hineingeboren. Das klingt absurd, fast schon wie eine Verschwörungstheorie, die sich eine Person mit einem Aluhut auf dem Kopf, im Keller sitzend, ausgedacht hat. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Weil wir im Mainstream nicht über Klassenungerechtigkeiten sprechen, sind viele Menschen anfälliger für Verschwörungstheorien und unrealistische oder rassistische Lösungen. Dabei ist die eigentliche Quelle des Unbehagens unsere ungerechte Gesellschaftsstruktur. Wir leben in einer Klassengesellschaft. Das bedeutet, die soziale Herkunft definiert den Verlauf eines Lebens. Nicht die Intelligenz, auch nicht der Fleiß oder die Sorgfalt, und es ist auch keine Frage der Motivation. Vielmehr sind es das Bankkonto der Großeltern, die richtigen akademischen Abschlüsse, Auslandsaufenthalte, die Klassenzugehörigkeit von Mama und Papa, der familiäre soziokulturelle Status, habituelle Sozialisierung, eine große Portion Vitamin B und Glück.
Mozart wäre kein Wunderkind geworden, wenn er nicht schon im Alter von vier Jahren Musikunterricht erhalten hätte. Ähnlich sieht es bei Marie Curie aus, deren Vater Mathematik und Physik unterrichtete. Pablo Picassos Papa war Kunstsammler, und Beyoncé Knowles bekam bereits im Alter von neun Jahren Gesangsunterricht. All diese Wunderkinder einen nicht nur ihre außergewöhnlichen Talente, sondern auch eine soziale Herkunft, die ihnen den Weg ebnete.
Das ist nicht neu. Ganz im Gegenteil. Klassengespräche haben eine lange Tradition. Immerhin ist Deutschland das Zuhause von Karl Marx und Friedrich Engels. Hier sind Gewerkschaften entstanden sowie Arbeiter:innenbewegungen und die DDR. Dieses Land wurde mithilfe von sogenannten Arbeitsmigrant:innen nach dem Krieg wieder aufgebaut. Es ist auch ein Ort, an dem Menschen sehr stolz auf Fleiß und harte Arbeit sind. Doch warum denken wir, dass Klassen gar keine Rolle mehr spielen? Warum sind wir so klassenunbewusst geworden?
Zwar stimmen viele Menschen darin überein, dass es ein Kind aus einem wohlhabenden Haushalt leichter im Leben hat, als eines, das in Armut aufwächst, aber im selben Atemzug halten sie an der Leistungsgesellschaft fest: An der Idee einer Gemeinschaft, in der Status, Einkommen und Einfluss von den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leistungen eines Individuums abhängen. Nicht von der Familie. Dabei zeigen Untersuchungen, dass es in Deutschland sechs Generationen dauert, bis die Nachkommen einer wenig vermögenden Familie das landesweite Durchschnittseinkommen erreichen. Einmal in einer Klasse, wird es schwer, wieder aus dieser herauszukommen.
Wenn ich mit Menschen über Klasse spreche, merke ich, dass sie das Konzept grundsätzlich kennen, aber häufig nicht wissen, was es konkret bedeutet. Sie unterschätzen, welche Rolle die soziale Herkunft in unserer Gesellschaft spielt.
Wir denken, wir wären ein Original. Sind wir auch. Aber wir sind auch eine Manifestation unserer Klassensozialisierung. Unsere gesellschaftliche Position hat weniger mit unserer eigenen Genialität zu tun, sondern vielmehr mit unserer Klassenzugehörigkeit. Dieser Gedanke ist so deprimierend, dass wir uns lieber an die Vom Tellerwäscher zum Millionär-Devise klammern, statt tatsächlich in eine Restaurantküche hineinzuschauen. Dann würden wir feststellen, dass der Tellerwäscher meist einer bleibt. Es gibt Chancen, ja. Aber die Bedingungen sind ungleich verteilt und so bleibt der soziale Aufstieg die Ausnahme, nicht die Regel.
Wir wissen um das eine, ignorieren aber, was das bedeutet. Das ist unser Klassenunbewusstsein. Die Koexistenz von zwei gegensätzlichen Überzeugungen. Wir finden es zwar unfair, dass manche Menschen arm sind. Wirklich etwas daran ändern, tun wir aber auch nicht. Denn jeder Mensch ist seines Glückes eigener Schmied, heißt es. Wenn die Armen wirklich etwas an ihrem Schicksal ändern möchten, dann müssten sie sich einfach mehr anstrengen. So der Gedanke. Der natürlich nicht stimmt.
Mit einem vielschichtigen Blick schreibe ich dieses Buch. Als Schwarze Frau, die aus der prekären Schicht stammt.
Klasse war für mich lange Marx-Porträts, Blümchentapete, die DDR, linksgerichtete, meist weiße, akademisierte Männer, die Klassismus, Rassismus und Sexismus hierarchisieren. Die sogenannten Brocialists. Gespräche über Klasse wirkten exklusiv. Klassenprivilegierte Menschen, die sich mit Arbeiter:innen identifizieren, ohne selbst welche zu sein. Wodurch es sich anfühlte, als würden sie Arbeiter:innen sagen, was sie tun sollen. Wie und warum sie sich empören müssen. Diese mangelnde Diversität sorgte dafür, dass mir gar nicht bewusst war, dass Klassismus auch meine Lebenswelt formte. Der Kampf gegen Rassismus und Sexismus war greifbarer. Erst später realisierte ich, dass der eine Kampf gegen den anderen ausgespielt wird.
Natürlich könnten wir nun sagen: Na und? Dann gibt es eben Ungerechtigkeiten. Wenn es nicht soziale Klassen wären, dann würde es etwas anderes geben. Ist es nicht natürlich, dass eine Gruppe sich alles krallt und sicherstellt, dass es ihren eigenen Sprösslingen über viele Generationen gut geht? Würden wir nicht alle dasselbe tun, wenn wir am Drücker wären?
Es ist so: Ungerechtigkeit killt den Zusammenhalt. Sie demotiviert. Hoffnung hält uns als Gemeinschaft zusammen. Sie bewahrt uns vor Chaos. Auch wenn die Marketingmaschinerie uns täglich den absoluten Individualismus auftischt, funktioniert unsere Gesellschaft durch das Kollektiv. Wir brauchen einander. Doch aktuell leben wir in einer Klassenparallelgesellschaft.
Gleichzeitig schwindet die Wahlbeteiligung, die Wut gegenüber dem Establishment steigt sowie die Machtkonzentrierung der Überwohlständigen. All das wirkt sich auf unsere Demokratie aus.
Meine Angst ist, dass wir in die falsche Richtung gehen. Denn Black Lives Matter nährt sich aus einer Klassenwut. Pegida aber auch. Ihre Ziele sind unterschiedlich, so auch ihre Wut und Methoden. Die eine Gruppe sieht die Lösung in der Gerechtigkeit für alle, weiße und Schwarze. Die andere in der Gerechtigkeit nur für die Weißen.
Es gibt viele Exempel für mögliche Zukunftsszenarien. Das letzte Mal, als eine Familie sehr viel Wohlstand hortete und das Volk hungerte, entstand die Französische Revolution. Die Adeligen wurden geköpft. Als in Deutschland die Armut stieg und die Hoffnung erlosch, bot eine Gruppe eine einfache, faschistische Lösung an. Die Nazis. Soziale Ungerechtigkeiten werden schon seit Jahrhunderten als Mobilisierungsinstrument genutzt. Dabei könnten sie genau das Gegenteil sein. Eine Möglichkeit, aus der Vergangenheit zu lernen. Eine Motivation zur Veränderung. Eine Brücke hin zu einer besseren Zukunft.
Genau das ist das Ziel dieses Buchs. Es ist eine Einladung, sich mit dem eigenen, reflexartigen Klassenunbewusstsein auseinanderzusetzen. Es richtet sich nicht an Menschen, die von Armut betroffen sind. Sie wissen um Klassen. Immerhin müssen sie täglich die Nebenwirkungen unserer Gesellschaftsstruktur ausbaden. Es richtet sich an die Mitte (und vor allem an diejenigen, die glauben, in der Mitte zu sein, obwohl sie zu den Wohlständigen gehören). An die vermeintlich Unbetroffenen. An diejenigen, die keine Klassen sehen.
Es ist eine Analyse dessen, was definiert, in welchem Haus wir sitzen, wer uns darin begrüßt und worüber wir uns Sorgen machen. Ich beleuchte die soziale Herkunft vom Kindergarten bis zum Beruf. Dieses Buch decodiert unhinterfragte Narrative im Zusammenhang mit Moral, Scham und Kapital. Analysiert ökonomische Klassiker sowie zeitgenössische progressive Denker:innen.
Der erste Teil ist eine kurze Einführung und beantwortet die Frage, was Klasse ist. Der zweite Part setzt sich mit dem kollektiven und individuellen Klassenunbewusstsein auseinander. Warum reden wir so ungern über die soziale Herkunft? Woher stammt dieses Unwohlsein? Ich analysiere, wie stark Klasse eine Rolle im Alltag spielt. Von Dating über die Popkultur bis hin zu Essen und Feminismus. Der letzte Teil beschäftigt sich mit Lösungen. Wie können wir eine klassenbewusstere, chancengerechtere Gesellschaft werden? Und vor allem, warum ist das so wichtig?
Ich verhandle persönliche Anekdoten von unterschiedlichen Menschen im Zusammenhang mit Klasse, betrachte strukturelle Ungleichheiten und die deutsche Geschichte. Mithilfe von Statistiken, aktuellen wissenschaftlichen Ergebnissen, Expert:innen, Betroffenen und Unbetroffenen, brechen wir ein kulturelles Tabu: Wir reden über Klasse. Aber so richtig. Wir gehen in die Tiefe. Ins Unterbewusste.
Diese Seiten sind ein Ausdruck der Hoffnung. Die Aspiration hin zu einer gerechten Gesellschaft. Einer mit Zukunft. Nicht nur für ein paar. Sondern für alle.
Klassen sind überall
Was sind soziale Klassen überhaupt? Klasse ist ein Gefühl, aber auch ein soziologisches Konzept. Eine Lebensrealität und Kategorisierung zugleich.
Es ist der Blick auf das Bahnticket, das entscheidet, in welchem Wagenabteil eine Person einsteigt — zwischen mehr Platz und weniger Menschen, mit freundlichem Personal und Kaffee in Porzellangeschirr direkt am Sitzplatz oder einem Abteil mit unbequemen Sitzen, mehr Menschen und einem wackelnden, aufquellenden Pappbecher Kaffee. Doch es geht nicht nur um den Unterschied zwischen erster und zweiter Klasse — es ist die grundsätzliche Frage, ob eine Person sich überhaupt ein Bahnticket leisten kann. All diese unterschiedlichen Erlebnisse finden gleichzeitig statt. Wir bewegen uns in derselben Welt. Doch wir sind Lichtjahre voneinander entfernt. Klasse ist eine objektive Analyse und ein subjektives Erleben.
Sie definiert, wo eine Person einkauft, was sie isst und trägt, wie sie ihre Wohnung dekoriert, welche Filme sie schaut, welche Songs sie liebt, mit wem sie Sex hat und was ihre Lebensträume sind. Die eigene soziale Position, Lebenschancen und Selbstverwirklichung. Selbst der Zugang zu Psychotherapie ist eine Klassenfrage. Sie wurde ursprünglich nicht für die prekäre Klasse entwickelt.
Gern wird sich bei der Betrachtung von Klassen auf das Geld fokussiert, das eine wichtige Rolle spielt, allerdings geht es nicht nur um die sozioökonomische Stellung einer Person in unserer Gesellschaft. Es wirkt sich auch auf die gemeinsamen Interessen aus und auf das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe, zum Beispiel über den Dialekt, die heißgeliebte Fußballmannschaft, den Lieblingsrapper, Wurst und Veggie, Bücher und Filme, Fast Food und Organic. All das spielt eine Rolle. Verstehe ich einen Witz, eine Geste, einen Code, eine Handlung?
Klasse beschreibt somit eine Einteilung von Menschen, die sich innerhalb einer Gesellschaft in Bezug auf Vermögen, Einkommen, Bildung und Beruf ähneln. Diese Aspekte beeinflussen ihre Lebenswelten, ihre Macht und das Prestige, das sie innerhalb einer Gesellschaft genießen. Klasse ist strukturell und individuell. Theorie und Praxis. Klasse ist allgegenwärtig. Sie betrifft uns alle. Aber sie trifft uns unterschiedlich hart.
I
Wie alles begann
Die einen putzen, die anderen denken
An einem warmen Frühlingstag während der Corona-Pandemie machte ich mich auf den Weg zu einem Routinecheck bei meiner Hausärztin. Nach einem liebevollen Smalltalk gelangten wir zu einem Thema, das in diesen Zeiten das gute alte »Wettergeplänkel« ersetzte. Meine Hausärztin begann, sich über die Corona-Politik aufzuregen: »Was die da machen, ergibt vorne bis hinten keinen Sinn.«
Sie analysierte einzelne Maßnahmen, die ihrer Meinung nach Nonsens seien, und sprach über die Auswirkungen. Dabei wählte sie als Beispiel die Tochter ihrer medizinischen Fachangestellten. Das Homeschooling sei so schlecht, dass sie ihr Abitur nicht machen könne. »Wir reden hier von der zukünftigen Elite.« Woraufhin ich sagte: »Das ist schrecklich, aber nicht nur für Abiturient:innen, sondern für alle Jugendlichen gleichermaßen.« Sie fühlte sich ertappt beim Gedanken, nur einer Gruppe Mitgefühl auszusprechen, zuckte dann aber mit den Schultern, zeigte aus dem Fenster auf einen orangefarbenen Müllwagen der Berliner Stadtreinigung und sagte: »Verstehen Sie mich nicht falsch. Wir brauchen alle. Manche Menschen entscheiden Dinge für unsere Gesellschaft, und andere fegen die Böden. Das ist natürlich und wichtig für die Ordnung.« Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück, hielt kurz inne und beendete ihre Ausführung mit dem Satz: »Alle sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft.« Im Hintergrund stiegen drei Männer aus dem orangefarbenen Wagen, gekleidet in Anzüge derselben Farbe. Sie begannen, die Mülltonnen an den Straßenrändern zu leeren. Auf dem Wagen stand in großer Schrift »We kehr for you«.
Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Die einen putzen, die anderen denken halt. Diese Botschaft habe ich bereits unzählige Male gehört, verpackt in unterschiedliche Formulierungen. Sei es in Bezug auf Sexismus, Frauen kümmern sich halt gern, oder in Bezug auf Rassismus, Schwarze Menschen sind physiologisch zum Arbeiten gemacht. Diese Aussagen stimmen natürlich nicht. Sie sind erfunden und gehören zu den vielen Geschichten, die ein Teil der Menschheit dem anderen verkauft. Die vermeintlich natürliche Ordnung. Andreas Kemper und Heike Weinbach weisen darauf hin, dass bereits der griechische Philosoph Aristoteles mit der Natürlichkeit von Klassen argumentierte. So schrieb Aristoteles:
Die Natur hat die Tendenz, auch die Körper der Freien und der Sklaven verschieden zu gestalten, die einen kräftig für die Beschaffung des Notwendigen, die anderen aufgerichtet und ungeeignet für derartige Verrichtungen, doch brauchbar für das politische Leben (…) Es ist so klar, dass es von Natur Freie und Sklaven gibt und dass das Dienen für diese zuträglich und gerecht ist.
Er ist nicht der einzige weiße Mann, der ein Narrativ in die Welt setzt, um sich von jeglicher Verantwortlichkeit frei zu schreiben. Das tun noch immer viele. Diese Liebelei mit der Natürlichkeit verschleiert, dass Klassen ein menschengemachtes System sind. Dadurch wird etwas Ungerechtes als gerecht dargestellt. Weil was kann ein Mensch schon gegen etwas Naturgegebenes machen, das vermeintlich unveränderlich ist? Es ist essenziell für das Fortbestehen unserer Menschheit, uns der natürlichen Ordnung nicht zu widersetzen. Theoretisch. Denn wenn es mal um echte biologische Abläufe geht, wie die globale Erderwärmung, und nicht um Erzählungen, wie es bei sozialen Klassen der Fall ist, greift der Mensch eigentlich am laufenden Band in natürliche Prozesse ein.
Diese Doppelmoral demonstriert die Widersprüchlichkeit und die Willkürlichkeit, eine Ungerechtigkeit auf der Basis der Vernunft zu erklären.
Klassendebatten sind uralt und gleichzeitig brandaktuell. Aristoteles schrieb seinen Gedanken zur Natur von Klassen vor knapp 2400 Jahren nieder und ich sitze im Jahr 2022 im Behandlungszimmer meiner Ärztin, die diese Überlegung weiterhin als logisch empfindet und damit sogar rechtfertigt, dass die Bildung der einen Gruppe relevanter ist als die vieler anderer.
Willkommen im Zeitalter des Klassenunbewusstseins. Es ist generations- und ironischerweise auch schichtübergreifend. Klassenfragen werden aufgrund ihrer Tradition weiterhin als eine fast schon schicksalshafte Bestimmung betrachtet. Doch nur, weil eine Ungerechtigkeit über Jahrhunderte kultiviert wurde, macht es das nicht in Ordnung.
Mit dem Wirtschaftswunder, den technischen und sozialstaatlichen Veränderungen nach dem Zweiten Weltkrieg sollten Klassen eigentlich so was von gestern sein. Doch die soziale Herkunft spielt weiterhin eine Rolle. Zwar haben wir uns von dem Gedanken gelöst, dass es »natürlich« sei, manche Menschen zu versklaven, doch heute gibt es eine andere Argumentationsweise, die es uns erlaubt, die Tätigkeit der einen Person als weniger wert zu betrachten als die der anderen, und zwar: die Produktivität.
Adam Smith ist der Begründer der freien Marktwirtschaft. Er war, wie viele andere Philosophen, auf der Suche nach Gesetzen, mit denen er die Entwicklung der Menschen erklären konnte. Die Wissenschaft war auf dem Vormarsch und verdrängte die Religion als Glaubenssystem. Die damalige Zeit als Sinnkrise zu beschreiben, wäre eine Untertreibung. Smith wollte ein umfassendes Werk verfassen, das die Wirtschaft zu einer eigenständigen Wissenschaft macht. Ein Religionsersatz. Das ist ihm gelungen. Bis heute halten viele Menschen an Adam Smiths Lehre fest, wie auch meine Hausärztin.
Der Schotte war überzeugt, dass ein Metzger und ein Bäcker nicht backen und schlachten, weil sie ein großes Herz haben und etwas für die Gemeinschaft tun wollen, sondern aus Eigennutz. Weil der Mensch ein Homo Oeconomicus ist, auch Economic Man genannt. Der Supermarkt ist voll, weil wir egoistisch sind.
Smith teilte Tätigkeiten in zwei grobe Kategorien ein: in produktive und unproduktive. Produktiv ist, was wertsteigernd, greifbar und langfristig ist. Unproduktiv sind alle Tätigkeiten, auf die das nicht zutrifft.
So steigert die Arbeit eines Fabrikanten im Allgemeinen den Wert des Materials, das er bearbeitet, den seines eigenen Unterhalts und den des Gewinns seines Herrn. Die Arbeit eines Knechtes hingegen erhöht den Wert von nichts. Obwohl der Fabrikant seinen Lohn von seinem Herrn vorgestreckt bekommt, kostet er ihn in Wirklichkeit nichts, denn der Wert dieses Lohns wird im Allgemeinen zusammen mit einem Gewinn durch den verbesserten Wert des Gegenstands, auf den seine Arbeit verwendet wird, wiederhergestellt. Aber der Unterhalt eines einfachen Dieners wird niemals wiederhergestellt. Ein Mann wird reich, indem er eine Vielzahl von Fabrikanten beschäftigt; er wird arm, indem er eine Vielzahl von Dienstboten unterhält. Die Arbeit des letzteren hat jedoch ihren Wert und verdient ebenso ihren Lohn.
Einer der Schlüsselgedanken von Adam Smith war beispielsweise die unsichtbare Hand — der Markt reguliert sich von selbst. In seinem Zuhause war die unsichtbare Hand die seiner Mutter. Smith lebte noch bis weit in sein Erwachsenenleben bei Margarete Douglas. Sie kaufte seine Lebensmittel, kochte, schnippelte, richtete ihm das Essen an, Douglas putzte das Haus, wusch seine Kleidung, faltete und legte sie für ihn bereit. Adam Smiths gesamtes Leben wurde für ihn organisiert, fast wie von Zauberhand.
Wenn Egoismus die Basis unserer Wirtschaftstheorie ist, dann lautet die Frage: Wie passt seine Mutter in diese Welt? Was motivierte Margaret Douglas dazu, Smith den Rücken frei zu halten, damit er The Wealth of Nations (Der Wohlstand der Nationen) verfassen konnte? Ein Schlüsselwerk unseres heutigen Wirtschaftssystems.
Unabhängig davon war all die Arbeit, die Smiths Mutter für ihn tat, für den Philosophen und Wirtschaftstheoretiker nicht wertlos, nur unproduktiv.
Ein Großteil der Care-Arbeit von Frauen wird bis heute in der Wirtschaft nicht berücksichtigt. Das, obwohl Kinder kriegen, sie versorgen und Familienmitglieder:innen zu pflegen, gewährleistet, dass mehr Economic Men auf die Welt kommen und Wirtschaftsbosse werden können. Frauen sind die unsichtbaren Gebärmütter und diejenigen, die für sie sorgen. Das Fundament der Wirtschaft. Ohne sie würde eigentlich gar nichts funktionieren. Damit der Mann egoistisch sein kann, muss die Frau selbstlos sein. Er ist unabhängig, weil sie abhängig ist. Er ist frei, weil sie unfrei ist. Er kann sich auf dem Markt bewegen und handeln, weil sie sicherstellt, dass zu Hause alles geregelt ist.
Das häusliche Kochen, Putzen und Pflegen ist kein Teil des Bruttoinlandsprodukts. Eine Zahl, die den Wert aller Waren und Dienstleistungen eines ganzen Jahres misst. Für das BIP ist ein Autounfall beispielsweise gut für die Wirtschaft, weil ein neuer Auftrag entsteht wegen Reparaturen an den Fahrzeugen, aber die familiäre Care-Arbeit bleibt irrelevant. Das bedeutet, die Arbeit von Margaret Douglas, unseren Müttern, aber auch von Menschen wie dem damaligen Knecht, der für die Haus- und Hofarbeit zuständig war, Wartungen und Reparaturen übernahm, aber auch Feldarbeit, Viehhaltung und allgemein unterstützende Tätigkeiten im Zuhause tat, sind in unserer Gesellschaft selbstverständlich. Dinge, die eigentlich essenziell für Menschen sind, fast schon existentielle Bedürfnisse erfüllen. Selbstverständlichkeiten führen nicht zu viel Anerkennung. Sie sind halt nicht besonders. Vor allem gibt es sie seit vielen Jahrhunderten for free.
Das Argument ist, und hier schließt sich der Kreis zwischen Aristoteles und Smith, Frauen gehen ihren natürlichen Verpflichtungen nach. Sie sorgen sich, weil es ihrer Natur entspricht. Dadurch ist es in Ordnung, dass sie schlecht oder überhaupt nicht bezahlt werden. Sie können nicht anders. Wir dürfen sie nicht von ihrer natürlichen Bestimmung abhalten. Dadurch fallen sie automatisch aus der wirtschaftlichen Vernunft. Frauen sind keine Economic Men. Sie sind halt kein Man.
Katrine Marçal schreibt, dass es bei der Wirtschaft nicht unbedingt ums Geld geht, sondern vielmehr darum, wie wir Menschen betrachten. Zu Aristoteles’ Zeiten wurde eine Person schlechter behandelt, weil sie wie ein Versklavter aussah. Dabei wurde sie zu einem gemacht. Menschen sind nicht einfach Versklavte, wir entwickeln als Gemeinschaft soziale und kulturelle Normen, die dann die gesellschaftliche Stellung, die Ausbeutung oder die bessere Behandlung legitimieren. Heute ist das anders. Die Ungerechtigkeit ist subtiler. Sie wird durch die wirtschaftliche Vernunft rationalisiert.
Die meisten Menschen würden damit übereinstimmen, dass die gesellschaftliche Struktur in der griechischen Antike ungerecht war. Zumindest für alle, die keine freien Männer waren. Wurde ein Mensch als Frau geboren oder als Versklavter, konnte die Person wenig tun, um als Bürger:in angesehen zu werden. Sie hatten weder ein Wahl- noch ein Mitbestimmungsrecht. Beide Gruppen konnten nichts an ihrem eigenen Schicksal ändern. Sie waren der Ungerechtigkeit ausgeliefert. Heute ist jeder Mensch ein:e Bürger:in. Dank feministischer Bemühungen, Antirassismus, Arbeiter:innenbewegungen und Dekolonialisierungsprozessen hat sich die rechtliche Gleichstellung in der modernen Zeit verbessert. Wir alle dürfen wählen und können grundsätzlich alles machen, was wir möchten. Prinzipiell ist unsere Gesellschaft gerecht. Wir haben die Wahl. So die Theorie.
In der Praxis sieht es aber wie folgt aus: Es sind Frauen, People of Color, Menschen mit Behinderung oder ältere Personen in prekären Lebensverhältnissen, die weiterhin am stärksten von Diskriminierung, Vorurteilen und sozialer Ungerechtigkeit betroffen sind. Es ist kein Zufall, dass ihre Handlungen als unprodukitv kategorisiert werden, weil sie schon von jeher ausgebeutet wurden. Adam Smiths Gedanke baut auf Aristoteles auf. Diejenigen, die im alten Europa bereits wirtschaftliche Macht hatten, bauten ihre Position mit der wirtschaftlichen Vernunft weiter aus. Die Ressourcen und Chancen blieben weiterhin ungleich verteilt.
Was heute allerdings neu dazukommt, ist, dass Menschen, die beispielsweise arm sind, für ihr Schicksal verantwortlich gemacht werden. Denn wenn in einem System jeder Mensch grundsätzlich alles werden kann und eine Person trotzdem nicht erfolgreich ist, dann macht sie etwas falsch.
Heute geht es nicht um die Person, sondern wie viel Kohle ihre Arbeit bringt. Vor allem werden ihre Handlungen bewertet. Produktiv, unproduktiv. Profitabel oder nicht. Diese Dehumanisierung reduziert Menschen auf ihre wirtschaftliche Nützlichkeit, aber vor allem legitimiert sie den fortwährenden Machterhalt einer Elite.
Inzwischen wurden Smiths Theorien ergänzt. Trotzdem sind Wertsteigerung, Profite, Kosten-Nutzen-Rechnungen und vor allem das Eigeninteresse Aspekte, die in unserer heutigen Wirtschaft weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Zu Smiths Zeiten war die Wirtschaft den Geistes- und Sozialwissenschaften zugeordnet. Anders als in den klaren Naturwissenschaften wie Biologie oder Physik, wo Experimente zu vorhersehbaren Ergebnissen führen, basiert die Ökonomie auf Theorien und Interpretationen. Der Physiker Murray Gell-Mann stellt die Frage: Was wäre, wenn Elektronen denken könnten? Während in der Physik ein Apfel bei jedem Experiment zuverlässig auf den Boden fällt, ist die Wirtschaft eine komplexe Erzählung, in der viele Menschen dennoch an sie glauben, als wäre sie ein unumstößliches Naturgesetz.
Aristoteles und Adam Smith zeigen nicht nur die Macht des Naturalisierungsgedanken, sondern auch von Kategorisierung. Frau: unproduktiv. Genau wie der Knecht. Wenn wir Kategorien immer wieder hören, glauben wir, sie seien naturgegeben. Wir halten sie für selbstverständlich und stellen sie nicht mehr infrage.
Dieser Denkfehler, diese Schattenwirtschaft, diese Parallelgesellschaft, macht sich in Klassen bemerkbar. Der Hauswart befindet sich in einer ganz anderen Klasse als der Manager. Seine Arbeit ist unproduktiver als die des CEOs. Die Hausfrau verdient kein Geld, genauso wenig tut es die Frau des Bundespräsidenten. Es ist nicht so, als würden sie nicht den ganzen Tag arbeiten. Sie werden nur nicht dafür bezahlt. Der Bauer und die Handwerkerin sind in einer ähnlichen Klasse, so wie die Social Media Managerin, der Politiker oder die Anwältin einer anderen Schicht angehören. Smiths unproduktive Tätigkeiten werden heute von Menschen einer bestimmten Klasse durchgeführt. Menschen, für die es vermeintlich natürlich sei, zu pflegen, sich zu kümmern, zu putzen und zu sorgen. Dadurch ist es irgendwie in Ordnung, dass sie schlechter bezahlt werden und weniger Anerkennung erhalten. Denn sie machen es aus einer intrinsischen und fast schon göttlich-spirituellen Motivation. Der Beruf der Krankenschwester beziehungsweise der Pflegekraft, wurde früher von Nonnen übernommen. Sie taten es, um zu dienen. Ohne Geld. Ohne Anerkennung. Als Bestimmung. Dadurch ist ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse irgendwie gerecht. Weil sie sich dafür entschieden hatten oder es natürlich vorbestimmt war.
Eine Frau wird wie eine Frau behandelt, weil es Geschichten und Narrative darüber gibt, wie eine Frau ist. Eine Schwarze Person wird wie eine Schwarze Person behandelt aus genau demselben Grund. Klassen sind wieder nur das: Eine weitere Geschichte. Sie wird seit Jahrhunderten weitererzählt, wie beim Spiel Stille Post. Dabei sind die Details verloren gegangen und keiner kann sich so recht an den Ursprung erinnern. Klassen sind nicht einfach da. Sie sind konstruiert, nicht naturgegeben. Sie sind das Ergebnis eines menschengemachten Systems. Es gibt keine biologischen Unterschiede zwischen Menschen, die gern putzen, und denen, die gern denken. Es gibt Berufe, Vorlieben, Talente, Bedürfnisse und Träume. Aber vor allem einen Grund, warum manche Jobs von einer bestimmten Gruppe übernommen werden. Uns alle eint der Wunsch nach einem würdevollen Leben. Nach Gemeinschaft, Sicherheit, Freiheit und Selbstverwirklichung. Was wir werden, hängt zu oft eben nicht nur von diesen Bestrebungen ab, sondern von der sozialen Klasse und welche Startbedingungen wir haben. Jeder Mensch, der das ignoriert, verstärkt dadurch die Macht von Klassen.
Klasse ist eine Idee, die so fest im Bewusstsein der Gesellschaft verwurzelt ist, dass sie zur Tradition wurde. Zu einem festen Bestandteil unserer Kultur und zu einem natürlichen Gesetz. Wir stellen sie nicht mehr infrage. Und das macht sie gefährlich. Obwohl Klassen konstruiert sind, bestimmen sie unsere Realität. Klassen definieren unser aller Leben. Dieser Prozess zeigt, dass unser Denken Lebenswelten erschafft. Das ist gut und schlecht. Schlecht, weil wir eine Idee in eine Realität verwandelt haben. Gut, weil wir das wieder verändern können. Um diese Mauern einreißen zu können, müssen wir das Konzept Klasse entmystifizieren. Jeder Zauber verliert an Wirkung, sobald der Trick dahinter offenbart wird. Genau das werden wir nun tun.
Wenn alle die Mitte sind
»Für mich gibt es keine Klassen, nur Menschen«, lautete die Antwort einer Frau, als ich sie fragte, welcher sozialen Klasse sie angehört. Es gibt sie: die »Ich sehe keine Farben«-Antwort in Klassenversion. Natürlich sollte die soziale Herkunft keine Rolle spielen, aber die Realität ist, dass sie es tut. Diesen Umstand zu ignorieren, lässt ihn nicht verschwinden. Unwissenheit verstärkt Ungerechtigkeiten.
Die Definition von Klasse ist eine Sache. Sich selbst in dieses Navigationssystem einzuordnen, eine ganz andere. Dabei kollidieren Selbstwahrnehmung und reale Gesellschaftsstruktur. Einerseits leben wir in unserer Klassenbubble. Wir sehen unser Lebensmodell in unterschiedlichen Nuancen, weil wir meist mit Menschen mit einer ähnlichen sozialen Herkunft befreundet sind. Gleichzeitig sind die anderen immer reicher. Wir schauen nach oben. Manchmal auch nach unten, aber selten uns selbst an.
Wie oft stellen wir uns gegenseitig die Frage, wie es um unsere eigene Klassenzugehörigkeit steht?
Von den Personen, die ich im Rahmen dieses Buches befragt habe, antwortete eine mit der Gegenfrage: »Was für Klassen gibt es denn?« Womit sie das erste Problem von Klassengesprächen enttarnt: Die Unübersichtlichkeit. Es existieren viele Definitionen, Begrifflichkeiten sowie Unterformen, die sich mit Schichten (Geiger), Milieus (SINUS-Institut), Zwiebeln (Bolte), Dörfern (Dahrendorf) und der nivellierten Mittelschicht (Schelsky), dem Gedanken, dass keine Unterschiede mehr existieren, befassen. Manche Modelle ähneln einander, andere widersprechen sich. Eine Theorie teilt Menschen nach Einkommen und Vermögen ein. Eine andere nach den akademischen Abschlüssen. Die meisten vermischen beides. Dabei kann der eine Indikator dem anderen widersprechen, wie das beliebte Beispiel des arbeitslosen Millionärs zeigt: Wie ordnen wir ihn ein? Nach seinem Einkommen? Dann würde er weiter unten landen. Oder nach seinem Vermögen? Dann gehört er vermutlich mit an die Spitze. Oder eine Mischung aus beidem? Zählt er dann zur Mitte?
Jedes Modell, das soziale Ungleichheit visualisiert, geht anders vor. Allerdings haben sie im Kern eine ähnliche Botschaft: Sie demonstrieren eine gesellschaftliche Hierarchisierung von Menschen auf der Basis ihres Einkommens, Vermögens und manchmal ihrer sozialen Herkunft und sie illustrieren diese, indem sie sich dem Bild eines unten und oben bedienen.
Das stellte ich auch durch ein Experiment fest. An einem warmen Herbstmorgen machte ich mich mit einem Mikro und einer Kamera auf den Weg. Meine Mission war es, mit unterschiedlichen Menschen auf den Straßen Berlin-Neuköllns über ihre Klassenzugehörigkeit zu sprechen. Ich hatte zwei Fragen vorbereitet: Welcher Klasse fühlst du dich zugehörig und warum? Nach zwei Stunden musste ich das Feld räumen. Ziemlich frustriert ging ich nach Hause. Was ich bei diesem Experiment feststellte, war: Von den vierunddreißig Befragten wusste die Mehrheit nicht, was es mit Klassen auf sich hat.
Ohne Klassenbewusstsein übernimmt die eine Seite keine Verantwortung und die Unübersichtlichkeit führt zu Überforderung auf der anderen. Das macht Klassengespräche exklusiv. Es ist schwer mitzureden. Dadurch sagen viele Menschen lieber gar nichts und andere sehr viel.
Diese Schwammigkeit macht die Frage nach der sozialen Ungleichheit weniger greifbar. Sie macht sie zu einer Auslegungssache. Es fühlt sich so an, als könnte jeder Mensch arm oder reich sein oder eine Fee oder ein Pony, alles nur eine Frage der Definition.
Eine US-Studie zeigt, dass befragte Millionär:innen denken, dass sie zur Mittelklasse oder zur oberen Mittelschicht gehören. »Von den reichsten 10 Prozent glaubt keiner, dass er zu den reichsten 10 Prozent gehört«, stellt Dr. Martin Schürz in seiner Untersuchung fest. »Sie glauben alle, dass sie die Mitte sind.« Schürz forscht seit mehr als zwei Jahrzehnten zur Vermögensverteilung in Europa.
Im Prinzip ist es egal, ob ein:e Millionär:in sich in der Mitte einordnet. Denn diese Gruppe profitiert von der strukturellen sozialen Ungleichheit. Schwieriger wird es für diejenigen, die Nachteile dadurch erleben und unter diesen Mechanismen leiden. Sie werden ausgebeutet, ohne sich dessen bewusst zu sein oder schlimmer noch: Sie haben das Gefühl, dass sie für ihre eigene Ausbeutung selbst verantwortlich sind. Beide Gruppen sind klassenunbewusst.
Auch wenn viele wenig mit dem Begriff »Klasse« anfangen konnten, so hatte jeder der Befragten ein Gefühl für soziale Hierarchien, die sich im Unten-Oben-Konzept manifestieren. Eigentlich ist es eine klerikale Einteilung: Unten, Oben. Sommer, Winter. Tag, Nacht. Die Dualität der Dinge. Zwei Pole — Gegensätze — die für ein Gleichgewicht des Universums sorgen. Mond und Sonne. Klein und Groß. Leben und Tod. Es ist der katholische Gedanke, dass wer weiter oben sitzt, Gott näher ist. Dadurch muss diese Person weniger leisten, um in den Himmel zu kommen, während diejenigen, die unten sind und sich näher am Boden befinden, fast schon kriechend wie Tiere, ihre irdische Existenz nutzen sollten und ordentlich ranklotzen, damit sie eventuell noch ein Ticket in das unendliche Paradies erhalten. Diese Bilder haben sich über Generationen in unser Bewusstsein eingebrannt, auch wenn nicht alle von uns heute religiös sind.
Das Unten-Oben-Konzept ist nicht wertfrei. Oben ist besser. Unten ist schlecht. Irgendwann wurde dann noch eine Mitte reingequetscht, die nun die beliebteste Antwort ist. Die meisten Personen, die ich fragte, welcher Klasse sie sich zugehörig fühlen, nennen das Dazwischen. Die Mitte. Sie klingt logisch. Zu sagen, dass ich der oberen Klasse angehöre, käme einer Prahlerei nahe, und alles andere wäre ein Eingeständnis, dass ich mein Leben auf dieser Erde nicht genutzt habe.
Deshalb ist es nachvollziehbar, dass viele Menschen die goldene Mitte nennen. Zudem entspricht dies der ökonomischen Klassifizierung, zumindest laut dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Wer über ein monatliches Nettoeinkommen von 1385 bis 2596 Euro in einem Singlehaushalt verfügt, gehört zur Mitte. Menschen zwischen 2597 und 4327 Euro gehören der einkommensstarken Mitte an. Zusammen machen sie fast 50 Prozent der Bevölkerung aus, so die Forschenden. Alle darunter sind von Armut bedroht und ab 4328 Euro gehören Personen zur oberen Klasse. Das sind die aktuellsten Daten, die vorliegen. Allerdings zeigt das World Inequality Lab in Paris, dass während der Coronapandemie das Vermögen der Milliardäre um mehr als 3,6 Billionen Euro gewachsen sei, während weitere hundert Millionen Menschen weltweit in die extreme Armut abgerutscht sind.
Die Mitte liegt zwischen Macht und Unmacht. Viel Geld zu haben, ist erstrebenswert, aber ausschließlich nach Geld zu streben, ist oberflächlich und gierig. Wenn ich nicht viel Geld habe, kann ich es nicht teilen oder etwas verändern. Vermögen birgt Verantwortung. Darum muss sich die Mitte nicht kümmern. Die Reichen sind schuld. Die Armen sind betroffen, und die Mitte, die ist eben neutral. Doch dieses Achselzucken sorgt dafür, dass die Reichen genüsslich immer reicher werden und die Armen ärmer.
Eine große Anzahl an soziologischen Konzepten, die sich mit der sozialen Klasse beschäftigen, entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war die goldene Ära des Kapitalismus. Der Beweis, dass der soziale Aufstieg nur eine Lochung auf der Arbeitskarte entfernt ist. Ziele wie ein Eigenheim, ein abbezahltes Auto trennten hart arbeitende Menschen zu dieser Zeit nur um ein paar Jahre. Sozioökonomisch lagen die Leute näher beieinander. Aspirationen waren realistisch. Die heutige Generation hingegen wird mit einem Sparbuch nicht mehr reich. Millennials sind die Ersten, denen es ökonomisch schlechter statt besser gehen wird. Ihre Einkommen können mit den steigenden Kosten nicht mithalten. Zudem steigt die Rentenlücke. Die Differenz zwischen der gesetzlichen Rente, dem, was eine Person einzahlt und in der Folge als Rente ausbezahlt bekommt, und der Summe, die sie letztlich im Alter tatsächlich braucht.
Der CDU-Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard und der Ökonom Wolfram Langer veröffentlichten im Jahr 1957 das Buch Wohlstand für Alle. Sie wollten jeder Klasse mehr Wohlstand ermöglichen. Das geht ihrer Meinung nach nur mit einer freien Wirtschaft.
Dieser Gedanke reiht sich ein in die Arbeit des Soziologen Helmut Schelsky, der von der nivellierten Mittelstandsgesellschaft sprach. Schelsky war überzeugt, dass es kaum eine Bevölkerungsgruppe im Nachkriegsdeutschland gibt, die nicht von Aufstiegs- und Abstiegsvorgängen geprägt ist. Laut ihm existiert keine Ober- und Unterschicht. Wir gehören alle zur Mittelschicht. Mal sind wir oben, mal unten. Auch der Soziologe Ulrich Beck beschäftigte sich im Jahr 1986 mit der sogenannten Wohlstandsexplosion und dem Fahrstuhleffekt. Dabei analysierte Beck den Wandel des Arbeitsmarktes. Beck war nicht der Überzeugung, dass sich die Einkommensunterschiede zwischen Gut- und Schlechtverdienenden wesentlich verändert hätten, allerdings seien die Erhöhung des materiellen Wohlstands, der Zugewinn an Freizeit und die verbesserten Bildungschancen allen Bevölkerungsgruppen zuteilgeworden, sodass sich nun das gesamte gesellschaftliche Gefüge einige Etagen höher befindet. Ungleichheit gebe es, aber im Allgemeinen gehe es uns allen besser.
Diese Arbeiten, Slogans wie Wohlstand für Alle und der Umstand, dass die Nachkriegsgenerationen mit Schweiß und Fleiß eine kleine Immobilie besitzen konnten. All das potenzierte die Illusion, dass wir bereits in einer post-klassistischen Gesellschaft angekommen seien. Gespräche über soziale Klassen und Ungleichheit sind bei dieser Annahme so was von gestern. Bildung ist kostenlos, Aufstiegsgeschichten gibt es. Ende gut, alles gut. Allerdings konzentrierten sich die soziologischen Untersuchungen primär auf Westdeutschland. Viele Arbeiten klammerten den Osten aus. Dabei besteht weiterhin ein Unterschied. Auch drei Jahrzehnte nach der Einheit verdienen Arbeitnehmer:innen in Ostdeutschland durchschnittlich 100 Euro weniger pro Monat als ihre Kolleg:innen im Westen. Doch unabhängig von Ost und West gibt es keinen Wohlstand mehr für alle, sondern hauptsächlich für Erben.
Thomas Piketty wird als Karl Marx des 21. Jahrhunderts gehandelt. Der Vergleich liegt nahe, denn der französische Ökonom nannte sein viel zitiertes Werk bewusst Das Kapital im 21. Jahrhundert. Seine These darin lautet: Auf eine kleine Elite konzentriert sich das Vermögen, das verstärkt soziale Ungleichheit, macht den gesellschaftlichen Aufstieg zu einem Märchen und gefährdet die Demokratie.