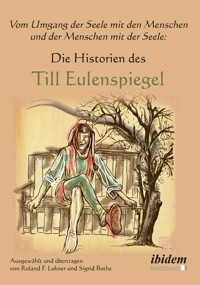
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Till Eulenspiegel – ein Schelm, Schlingel, Trickser, Schlawiner, Spaßvogel, Freund der Kinder? Aber nein – ein Schalk ist er! Ein purer, unverfälschter Schalk, der in der Gestalt des Till Eulenspiegel durch das Dickicht des menschlichen Lebens führen kann, auf alle Anfechtungen Antworten hat und dabei völlig ohne Egozentrik auskommt, stets unbestechlich und niemals käuflich. Aus einem anderen, bisher ungewohnten Blickwinkel heraus erschließen uns Roland Lukner und Sigrid Bothe das Wesen des Till Eulenspiegel auf neue Art.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Till Eulenspiegel
der erste abendländisch-christliche Europäer der Neuzeit
© Jürgen Bode 2004 | CC BY-SA 3.0 | GDFL
Narr und Künstler, zwei Seiten eines Wesens, sind vielleicht die einzigen deutschen Beiträge zum Repertoire der Charaktere in der erzählenden Weltliteratur.
Heinz Schlaffer, Die kurze Geschichte der deutschen Literatur, München Wien. (Carl Hanser Verlag) 2002, S. 51f.
DER HERR.
Von allen Geistern, die verneinen,
ist mir der Schalk am wenigsten zur Last.
Goethe, Faust, 339–340.
„Und obwohl ich mich mit Eulenspiegel nie habe beschäftigen wollen, ist er dennoch zu uns gekommen.“
– Landgraf von Hessen.
Einleitung
Das Buch, von dem bis heute namentlich unbekannten Verfasser, mit Till Eulenspiegel als Titelheld und Schalk, gilt heute als Weltliteratur des niedersächsischen Raumes, da es weit über diese Grenzen, ja sogar in aller Welt bekannt ist. Wohl bereits um 1500 konzipiert, erschien es 1510/11, einer Zeit also, die bestimmt war von einer Krisen- und Umbruchssituation, von der Wende vom ausgehenden Mittelalter zur anbrechenden Neuzeit.
F. Martini1 weist eigens auf die Gefahr des Mißverständnisses hin, die der Begriff des Spätmittelalters birgt, insofern dieser auf einen „Herbst des Mittelalters“deutet. Tatsächlich aber beinhaltet er sowohl den Abstieg des erhabenen Hochmittelalters, als auch den Aufstieg eines ganz neuen Zeitalters mit seinem ihm eigenen charakteristischen Zeitgeist.
F. Martini umreißt diese Zeit in ihrer Gesamtheit:
Vom 16. Jahrhundert bis zu seinem [Goethes] vollendeten „Faust“ [1831] wölbt sich ein großes geschichtliches Zeitalter: es ist die Epoche des … individuellen Selbstbewußtseins. […] Das Ich als ein erkennendes und fühlendes Wesen löst sich allmählich, in langem Ringen, aus den objektiven Autoritäten … [und] lernt … ein moralisches Dasein aus eigener Vernunft und sittlicher Freiheit aufzubauen. Aber es erkennt zugleich die Problematik einer autonomen Existenz … Faust wird zum des durch sich selbst vernichteten Menschen. […] Die Literaturgeschichte der [dem Beginn dieser Kulturepoche] folgenden Jahrhunderte läßt stufenweise diese Verweltlichung des Lebensbewußtseins beobachten.2
F. Martini3 führt dann weiter aus, daß mit dem in Goethes Dichtung erreichten Höhepunkt, insbesondere in seinem Spätwerk, so z. B. in Faust II, sich die Wandlung, der Wendepunkt in der europäischen Geistesgeschichte in Richtung einer neuen Epoche ankündige.4 Die Literatur des 19. Jahrhunderts treibe einerseits das Individualbewußtsein bis ans Pathologische, öffne andererseits den Blick für die Gebundenheit des Menschen an Überindividuelles.
Die in unserem Zusammenhang relevante Thematik der abendländischen Zeitläufte hat W. Giegerich5 analysiert. Laut ihm führte der Entwicklungsweg des Christentums zu der großen, völlig neuen psychologischen Bewußtheit unserer Zeit über fünf verschiedene, für sich allein stehende Stufen, wobei jede einer Weise, wie die Welt für ein Zeitalter verfaßt ist, entspricht. Das Spätmittelalter bildet nach W. Giegerichs Analyse die zweite Bewußtseinsstufe dieses einzigen, aus fünf Akten bestehenden, geschichtlichen Dramas des christlichen Abendlandes. Und jede dieser fünf Stufen trägt seine eigene Bedeutung, Tiefe und Vollständigkeit in sich selbst. Jede hat ihre eigene Identität (allerdings im gleichen, positivistischen Bewußtseinsstatus), die vom Standpunkt der autonomen, objektiven Psyche gleichermaßen wertvoll ist. Für den Menschen aber erbringen die fünf Bewußtseinsstufen in ihrer Abfolge fortschreitende Wertsteigerungen, die mit der vollständigen Entfaltung des Psychologischen die anthropologisch-positivis-tische Selbstdefinition des Menschen durchbrechen und sie für seine transpersonale, göttliche Dimension öffnen.6
In den von Tills Leben handelnden Historien erfüllt Eulenspiegel als Trickster, ganz unbewußt, unabsichtlich, eine bewußtseinssteigernde Aufgabe, denn die Tricksterhaftigkeit weist dem Schalk eine positiv-wichtige, das herrschende Bewußtsein aufrührende, hinterfragende, ja aufhebende Rolle zu. Nach W. Giegerich ist dies heute in einem besonderen Sinn höchst aktuell, denn „der westliche Mensch hat sich unwissentlich in die Irrealität, in die Abstraktion treiben lassen. Die Irrealität ist absolut, insofern sie unter dem Deckmantel ihres Gegensatzes erscheint: als ‚positivistische Realität‘. … wir leben grundsätzlich in einer superterrestrischen Welt der Ideen, verpuppt in der Irrealität …“7
Was in dieser Situation wirklich vonnöten ist, ist ein reales Durchbrechen dieser Blase, in die die menschliche Existenz hermetisch eingekapselt ist, um die Wirklichkeit zu erreichen und diese umgestaltend auf uns realiter einwirken zu lassen. Die Voraussetzung dafür ist erst dann geschaffen, wenn im Begreifen ihrer wir auch uns von ihr erkennen und begreifen lassen. Ansonsten bleiben wir weiterhin faustisch.
Auch wenn eine Reihe von Eulenspiegel-Historien heute tabu ist, so muß dem entgegengehalten werden, daß in der Literatur auch Tabu-Motive Metaphern sind und als solche die geistige Wirklichkeit des literarischen Kunstwerks beinhalten und folglich nicht mit der physischen Realität gleichzusetzen sind. Das gilt für das Buch als Ganzes, also auch für die Eulenspiegel-Gestalt. „[Das Werk] ist nicht eine natürliche Wirkung oder Folgeerscheinung von [Till Eulenspiegels Leben], sondern eine dichterische Schöpfung, die [ihn und sein Leben] innerhalb ihrer frei erfunden hat, wenn auch unter Rückgriff auf bestimmte, allerdings sicher nicht genauso geschehene, historische Ereignisse. […] Ganz gleich, ob es in der äußeren Faktizität [das Leben eines Till Eulenspiegels] gegeben hat oder nicht, in beiden Fällen ist [es] als Motiv der Dichtung [des Verfassers] eine dichterische Erfindung.“8 Und überhaupt, was wäre der Trickster, wenn er nicht gerade auch Tabu-Themen aufgriffe und angriffe? – Jede der Historien steht auf ihren eigenen Beinen und kann somit zu einem Theaterspiel, ein- oder mehraktig, gestaltet und auf der Bühne in ihrer ganzen Tiefe erfaßt werden. Von dieser Möglichkeit ist bisher noch kein Gebrauch gemacht worden.
Der Endeffekt der Streiche Eulenspiegels ist primär nicht die Entlarvung von menschlichen Schwächen und Bosheiten, sondern die implizite Sprengung und Aufhebung eines gegebenen Bewußtseinsstandes. Erst mit Hegels Begriff der absoluten Negativität wird man seinem Wesen im tiefsten Sinne gerecht. Das Gemeinsame der Eulenspiegelhistorien besteht im großen Ganzen darin, daß der in ihnen herrschende Bewußtseinshorizont aus den Angeln gehoben, genauer, i. S. v. Hegels Begriff der Aufhebung auf dieser Stufe zwar noch nicht explizit, so doch implizit negiert wird. Demnach ist der vorige Bewußtseinsstatus als obsoleter im neu herrschenden enthalten.
Die hier ausgewählten Historien, ausgestattet mit neuen, auf ihren Gehalt sorgfältig abgestimmten jeweils zwei Überschriften tragen dieser Erkenntnis hinsichtlich der tricksterhaften Negativität Till Eulenspiegels Rechnung. Die gehaltmäßige Übereinstimmung zwischen den Überschriften und dem Historientext verleiht dem dreiteiligen Gebilde einen interaktiven Charakter. Übrigens ruft bereits der Verfasser des Buches zur Interaktivität mit seinem Werk auf, wenn er in der Vorrede dazu ausdrücklich schreibt: „Und ich bitte einen jeden, meine Schrift zu verbessern, wenn sie zu lang oder zu kurz sein sollte, damit sie mir keine Gleichgültigkeit einbringe.“
Der Grundsatz dieser Übertragung nach dem Straßburger Druck von 1515, von W. Lindow9 durchgesehen und bibliographisch ergänzt, ist, die Historien in das Sprachgewand unserer Zeit zu kleiden und sie dadurch an heutiges Vorstellungsvermögen wirkungsvoll anzunähern, ohne ihren Gehalt verändern zu wollen. Es ist gleichsam ein Versuch, ein auf mehrfache Weise abgesunkenes, jedoch geniales Schriftwerk europäischen Gedankengutes wieder ins Bewußtsein unserer Zeit zu heben und ihm dadurch seine notwendige Wirkung zurückzugeben: Till Eulenspiegel mit Biß! Denn die Eulenspiegel-Gestalt ist eine archetypische Erscheinung eines übermächtigen, geistvollen, von echter Liebe, seelischer Wahrheit und wirklicher Freiheit, letztendlich vom absoluten Geist bestimmten Trickster-Genius, der hiermit die Schwelle am Ausgang aus der Faust-Problematik der Moderne darstellt.
Till Eulenspiegels Geburt fällt in das anarchisch-rechtlose Interregnum, in der das Rittertum grausame Raubzüge gegen Städte führte. In unserer Zeit führt der willkürliche Imperialismus Raubzüge sogar gegen ganze Länder und Regionen. Wie entkommt nun endlich die Welt dieser Falle? Zum einen durch den Trickster, der die Fortentwicklung des Bewußtseins auszulösen vermag, zum anderen freilich auch durch die psychologische Methode nach dem Verständnis der Psychologie als Disziplin der Innerlichkeit als Er-innerung.
Selbst Till war von dem Unwesen der Neuzeit betroffen und mußte als jugendlicher Lanzenträger daran teilnehmen, jedoch ohne daß ihn das Böse durch die Berührung korrumpierte. Die Kindheit Tills ist gekennzeichnet durch eine Anhäufung von Traumata: Das Geburtstrauma, die Taufen (Nahtoderfahrung des Täuflingbabys); die heimatliche Dorfgemeinschaft verstößt ihn als kleines Kind wegen seiner Gabe für Schalkheit; der Vater bezichtigt ihn, in einer unglückseligen Stunde geboren zu sein; Umzug und Verlust seiner Heimat; der Tod des Vaters; Armut und Hunger; die Unterdrückung seiner Vorliebe für den Seiltanz durch kirchliches Gebot und mütterliches Verbot; Absturz vom Seil durch Mutters Tun; Verspottung durch die neue Gemeinde; Mutters Drängen, ihn von seinem Wesen abzubringen; die Versuche eines Gutsherrn, seine Identität zu brechen. – Traumata über Traumata, doch die Geistliebe, deren dichterische Verkörperung Till ist, triumphiert über die Traumata der Kindheit, die der Jugend- und Manneszeit, die des Alters und letztlich gar über den des Todes hinaus.
Roland Lukner
1 1 F. Martini, Deutsche Literaturgeschichte, 19., neu bearbeitete Auflage. In Zusammenarbeit mit A. Martini-Wonde. Stuttgart (Kröner) 1991, S. 84.
2 Ebd., S. 110.
3 Ebd., S. 110f.
4 Nach W. Giegerich trete sie mit Hegel wirklich und ausdrücklich als Ebene des Begriffs (jeweils in Hegels Sinn von Begriff: 3. Teil der Wissenschaft der Logik) ins Bewußtsein. Allerdings sei das geschichtliche Geschehen nicht auf dem durch die Stichworte Aufklärung, Kant, Hegel bezeichneten Weg weitergegangen. Unsere wirkliche abendländische Geistesgeschichte sei seit dem Jahr 1831, dem Jahr von Hegels Tod, nicht fortgeführt worden. Daher sei das, was danach gekommen ist, letztendlich geschichtslos. Siehe hierzu W. Giegerich, Animus-Psychologie, Frankfurt a. M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien (Peter Lang) 1994, S. 67. Siehe auch „Zuerst Schatten, dann Anima. Oder: Die Ankunft des Gastes“, in: Gorgo 15, 1988, S. 5–28, hier S. 26.
5W. Giegerich, „Zuerst Schatten, dann Anima. Oder: Die Ankunft des Gastes“, in: Gorgo 15, 1988, S. 5–28.
6 Jesus war als Mensch in diesem geistig-göttlichen Bewußtseinsstatus. Vgl.: “[Mein menschliches] Ich und der Vater [absoluter Geist, die absolute Liebe] sind eins. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus hielt ihnen entgegen: Viele gute Werke vom Vater habe ich euch sehen lassen. Für welches dieser Werke wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm: Nicht eines guten Werkes wegen steinigen wir dich, sondern wegen Gotteslästerung, weil du, ein Mensch, dich zu Gott machst. Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben: Ich habe gesagt:Ihr seid Götter? Wenn er jene Götter nannte, an die das Wort Gottes erging, und wenn die Schrift nicht aufgehoben werden darf, wie könnt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, sagen: Du lästerst Gott!, nur weil ich gesagt habe: Ich bin Gottes Sohn? Tue ich nicht die Werke meines Vaters [des absoluten Geistes, der Liebe], so braucht ihr mir nicht zu glauben. Tue ich sie aber und ihr glaubt mir nicht, so glaubt wenigstens den Werken, damit ihr erkennt und wißt, daß in mir der Vater [der absolute Geist, die Liebe] und ich im Vater [dem absoluten Geist, der Liebe] bin.“ (Joh. 10, 30–38).
7 W. Giegerich, “Killings: Psychology’s Platonism and the Missing Link to Reality”, Tonkassette FAP-8, Festival of Archetypal Psychology in Honor of James Hillman, Boulder, Colorado (Sounds True Recordings) 7. 7.–12.7.1992. – Meine Übersetzung.
8 W. Giegerich, Der Jungsche Begriff der Neurose, Frankfurt a. M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien (Peter Lang) 1999, S. 52.
9Ein kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel. Nach dem Druck von 1515 mit 87 Holzschnitten. Hrsg. von W. Lindow. Stuttgart (Reclam) 1966 (1978).
Inhalt
Einleitung
[Vorrede]
Kinderjahre
1. Tills Geburt und seine Taufen
2. Till widerlegt seinem Vater die Klage der Dorfgemeinschaft, er sei ein Schalk
3. Tills Umsiedlung mit Familie, Vaters Tod und Mutters Störmanöver bei Tills Seiltanz
4. Till quittiert den Dorfleuten ihren Spott bei seinem Sturz in die Saale
Jugend- und Wanderjahre
5. Till erweist sich seiner Mutter gegenüber geistig unabhängig
6. Till beschafft ohne Geld einen Sack voll Brot
7. Till wird von einem gewaltsamen Gutsherrn grausam malträtiert
8. Till vernichtet die Hühner des Gewalttäters durch den Einsatz eines originellen Einfalls
9. Till entkommt einer Notlage und wird dabei vom Elternhaus gelöst
10. Till wirkt unwissentlich als Werkzeug der höheren Gerechtigkeit
Till entdeckt Zusammenhänge
11. Till wird von seiner Arbeitsstelle am Pfarramt auf Druck der Haushälterin entlassen
12. Till wettet als Küster mit dem Pfarrer um ein Faß Bier
13. Till wirkt als Dramaturg eines Osterspiels im Dienst der Wahrheit
14. Till vereitelt den Versuch der Oberen der Stadt Magdeburg, ihn auszuschalten
15. Till verhilft einem narrenfeindlichen Rechtsgelehrten zur Weisheit
16. Till hilft der Mutter eines kranken Kindes, diesem bei der Heilung beizustehen
17. Till praktiziert als außerordentlich fähiger Arzt
18. Till stellt eine Lebensweisheit auf die Probe
Tills durchbrechendes und sich wandelndes Bewußtsein und dessen Mehrung
19. Till entzieht sich in Braunschweig einer Klemme mit Gewinn
20. Till bringt einen Bäckermeister auf die Palme
21. Dinge, die Till zeitlebens mied
22. Till setzt eine vorzeitige Militärentlassung durch
23. Ein König zahlt Till Lehrgeld und lacht
24. Till wird Erster-Preis-Sieger in königlichem Narrenwettstreit
25. Till läßt sich von der Todesstrafe nicht verängstigen
26. Till handelt gezielt gegen das Landesverbot, ohne dafür belangt zu werden
27. Till packt den Machtmenschen an der Achillesferse, dem Minderwertigkeitskomplex
Till stellt sich seinen Lebensaufgaben und anerkennt die Autonomie seines inneren Tricksters
28. Till erweist sich als glänzender Scholastiker
29. Till entlarvt Gelehrte der vormaligen Universität Erfurt als eselhaft
30. Till wäscht Frauen ihre Pelze
31. Till wird als Geistlicher steinreich
32. Till lockt die ihren Dienst am Bürger vernachlässigende Nürnberger Stadtpolizei in eine Falle
33. Till ißt in Barnberg um Geld
34. Tills Wallfahrt nach Rom und Rückkehr als reicher Mann
35. Till legt strenggläubige Juden herein
36. Till nutzt den Perfektionismus einer Bäuerin aus
Till wendet sich den Widersprüchen des Lebens zu, und sein Geist erwirkt Erlösung
37. Till beliefert einen gefräßigen Pfarrer mit Würsten, die ihm schlecht bekommen
38. Till gelangt in den Besitz des Mantels und Pferdes eines Herzogs
39. Till belehrt einen Schmiedemeister eines Besseren
40. Till schmiedet einem Schmied das Werkzeug, die Stifte und die von ihm verhunzten Hufnägel zusammen
41. Till bekommt den Hufbeschlag eines Pferdes umsonst erneuert
43. Till ist ein beständiger Stein geistigen Anstoßes für einen Schustermeister, dessen Bewußtsein derart festgefahrenes ist, daß es sich davon nicht in Bewegung bringen läßt
44. Till begießt notgedrungen einem Bauern die Suppe mit altem Lebertran statt Bratenschmalz, doch sein Dienstherr meint, es sei dem Bauern gut genug
49. Till bringt drei ihn verspottende Schneider vom Fensterladen zu Fall
50. Till demonstriert Schneidern die Priorität des Geistigen
51. Tills Arbeitsverhältnis mit einem Webermeister geht für diesen schlimm zu Ende
52. Till nutzt die Diskrepanz zwischen Sein und Schein, um sich die Möglichkeit für die Dauer der harten Winterzeit Unterkunft zu verschaffen
53. Till gelingt es, der Gewaltandrohung seines Dienstherrn, der damit ihre gemeinsame Abmachung bricht, zu entkommen
57. Till bringt einen hochmütigen Weinzapfer zu Fall
58. Till rettet sich vor dem Tod durch ungerechten Strang
59. Till bringt einen Täschner dicht an den Rand des Ruins
63. Till verschafft sich eine Einstellung beim Bischof von Trier
64. Till setzt sich im Dienst voller Gefahren bei einem guttuerischen Kaufmann voll und ganz ein, bekommt aber trotzdem keinen Dank
65. Till wirkt in WIsmar als aufklärerischer Humanist
Till konsolidiert seine Geisteshaltung auf die Welt und erwirkt nun meisterlich Lösungen für seine Probleme
66. Till trickst einen arglistigen Flötenmacher aus, der auf ihn neidisch ist
67. Tills Teilnahme an einer unlauteren Hochzeitsfeier wirkt sich schadensbegrenzend aus
68. Till versorgt sich gratis mit Stoff für einen Wintermantel
69. Till erteilt eine praktische Lektion zum Reinheitsbegriff
70. Till entfesselt unter Bäuerinnen einen hemmungslosen Massenstreit
71. Till rettet ohne Geld obdachlose Blinde im Winter vor dem Tod durch Erfrieren
72. Till beträufelt in Bremen seinen geladenen Gästen einen Braten, von dem sie nicht essen wollen, den sie ihm aber bezahlen müssen
73. Till demonstriert eine dem Menschsein abträgliche Geisteshaltung und weist zugleich auf das Rettende hin
77. Till verstänkert unbemerkt das Gastmahl eines Nürnberger Patriziers, der ihn davon ausgeschlossen hat
79. Till wird in einem Gasthaus von dem schalkhaften Wirt ein Streich gespielt, den er ihm zurückzahlt. Sie erkennen und akzeptieren sich nun als Schälke, wodurch der Konflikt gelöst ist
80. Till zahlt mit Münzenklang
82. Till richtet sich bei der Bezahlung seiner Zeche nach den geltenden Geschäftsregeln, die die Wirtin jedoch nicht auf sich bezogen haben will und mit Wut, Verfluchung und Rauswurf auf ihn reagiert
83. Till zeigt bei der abermaligen Begegnung mit der Wirtin ihre verstockte Uneinsichtigkeit und ihr böses Herz auf
Till trifft auf wahre und selbsternannte Autoritäten und stellt sich in dieser Hinsicht immer stand- und sattelfester auf
84. Till verpasst einer spießigen Wirtin einen Denkzettel
86. Till wahrt seine Integrität
88. Till versaut einem nachgegebenden, kleinmütigen Bauern unversehens den Ertrag seiner Pflaumen und kommt zu dessen Leidwesen ungeschoren davon
Till macht sich auf seine Heimreise
89. Till wird am Lebensabend Ordensbruder im Kloster, um sein Leben dort gottgefällig zu beschließen
90. Till wird todkrank. Sein Gut vererbt er seiner Mutter
91. Till soll einer Begine seine Sünden bereuen und beichten
92. Till legt einem Pfarrer die Beichte ab
93. Tills Testament, Tod und Bestattung. Der Versuch, ihn nachträglich aus der geweihten Erde auszugraben, schlägt fehl
94. Tills exzentrische Trauerfeier
95. Tills aus dem Rahmen fallende Beerdigung
96. Tills Grabsteininschrift
Nachwort: „Zum Gespräch sind wir geboren“
[Vorrede]
Im Jahre 1500 nach Christi Geburt bin ich, N.1, von etlichen Personen gebeten worden, ihnen zuliebe diese Historien und Geschichten zu sammeln und aufzuschreiben, was in vergangener Zeit ein in List und Durchtriebenheit geistig reger Bauernsohn, genannt Till Eulenspiegel und geboren im braunschweigerischen Herzogtum, getrieben und getan hat in fremden und deutschen Landen. Für meine Mühe und Arbeit wollten sie mir ihre Gunst hoch erweisen. Solches und mehr zu tun, wäre ich bereit, antwortete ich. Aber ich wäre nicht im Besitz solchen Verstandes und Wissens, dieses Vorhaben zu vollbringen. Mit freundlicher Bitte legte ich ihnen viele Gründe dar, mir zu erlassen, von Eulenspiegel etwas zu schreiben, was er in etlichen Ortschaften getrieben hat, weil sie das verdrießen könnte. Aber diese meine Antwort wollten sie als Entschuldigung nicht gelten lassen.
So habe ich mich denn nach meinem geringen Wissen verpflichtet und das Anliegen angenommen, mit Gottes Hilfe (ohne den nichts geschehen kann) und mit Fleiß angefangen. Und ich will mich im Voraus gegenüber jedem insofern entschuldigen, als meine Aufzeichnungen niemandem zum Verdruß geschehen oder jemanden geringschätzen sollen: Das sei weit von mir!
Es geht allein darum, ein fröhliches Gemüt zu machen in schweren Zeiten, indem die Leser und Zuhörer sich daraus mit Freuden und Schwänken gute Unterhaltung schaffen mögen. Es ist auch in diesem meinem schlichten Schreiben keine Kunst oder Feinsinnigkeit, da ich leider im lateinischen Schrifttum ungelehrt und ein schlichter Laie bin.
(Damit der Gottesdienst nicht vernachlässigt werde), ist dieses mein Buch am allerbesten zu lesen, wenn sich die Mäuse unter den Bänken beißen, die Tage kurz werden und die gebratenen Birnen gut schmecken bei dem neuen Wein. Und ich bitte einen jeden, meine Schrift von Eulenspiegel zu verbessern, wenn sie zu lang oder zu kurz sein sollte, damit sie mir keine Gleichgültigkeit einbringe. Und hiermit beende ich meine Vorrede und beginne mit Till Eulenspiegels Geburt. Einige Geschichten der Dichtungen Der Pfaffe Amis und Der Pfaffe vom Kalenberg habe ich mit einbezogen.
1 Der Verfasser des Eulenspiegelbuches konnte bis heute nicht eindeutig bestimmt werden. Er lebte und wirkte in einer ambivalenten Zeit, deren Grundstimmung der Umbruch vom Mittelalter zu einem neuen Zeitalter war. Diese Zeit, geprägt von innerem Widerstreit, hat ihren grundlegenden philosophisch-theologischen Niederschlag in des Humanisten Nikolaus von Kues’ (1401–1464) dialektischem Prinzip der Coincidentia oppositorum gefunden, dem Zusammenfall der Gegensätze in der absoluten, aktual unendlichen Einheit.
1. Wie Till Eulenspiegel unschuldig in Todesnähe gebracht und schon früh wach und aufmerksam auf die Geschehnisse in seiner Umwelt wurde. Wir werden in den folgenden Historien sehen, daß Maßnahmen seiner Eltern und anderer Menschen an seinem Geist nichts mehr ändern konnten.Tills Eulenspiegels Geburt, christliche Taufe und zwei Scheintaufen.
Bei dem hügeligen Waldgebiet Elm genannt, im Dorf Kneitlingen im Sachsenland, wurde Eulenspiegel geboren. Sein Vater hieß Claus Eulenspiegel, seine Mutter Ann Wibcken. Nachdem sich diese von der Geburt des Kindes erholt hatte, brachte man ihren Sohn nach Ampleben zur Taufe und gab ihm den Namen Till Eulenspiegel. Till von Uetzen, der Burgherr von Ampleben, war sein Taufpate. Ampleben war das Schloß, das die Magdeburger etwa 50 Jahre zuvor mit Hilfe anderer Städte als ein böses Raubritterschloß zerstörten. Die Kirche und das Dorf waren Besitz des würdigen Abts von Sankt Ägidien, Arnold Pfaffenmeier.
Als man Eulenspiegel getauft hatte und ihn wieder nach Kneitlingen trug, mußte die Taufpatin, die das Kind hielt, über einen Steg gehen, der zwischen Kneitlingen und Ampleben über einen Bach führt. Man hatte aber nach der Kindstaufe reichlich Bier getrunken, denn es ist dort Sitte, daß man mit den Kindern nach der Taufe ins Wirtshaus geht, um auf deren Wohl zu trinken, zu feiern und dabei fröhlich zu sein; die Zeche wird vom Vater des Täuflings bezahlt. Beim hastigen Überqueren des Baches fiel aber die betrunkene Taufpatin vom Steg hinunter in das Wasser, daß das Kind im Bach fast ertrunken wäre, und sie beschmutzte sich und das Kind dabei jämmerlich. Da halfen die anderen Frauen der Badetante mit dem Kind wieder heraus, gingen heim in ihr Dorf und wuschen das Kind in einem Kessel und machten es wieder sauber und schön.
So wurde Eulenspiegel an einem Tag dreimal getauft: einmal im Taufbecken, einmal im Bach beim lebensgefährlichen Fall vom Steg und einmal von den Bauersfrauen im Waschkessel mit warmem Wasser.
2. Till Eulenspiegel zeigt sich als ehrliches und unbeschwertes Kind und damit seiner Umwelt – sie doch immer nur eine Seite betrachtend, niemals erkennen kann, was die rechte Hand von der Linken im Tun unterscheidet.Till spielte bereits von Kindesbeinen an viele Streiche, so daß er in seinem Heimatdorf sehr unbeliebt war. Die Gemeinde klagte deshalb seinem Vater, sein Sohn sei ein Schalk. Doch Till behauptete sich seinem Vater und den Dorfleuten gegenüber, indem er deren Klage, ihm entkräftete.1
Sobald Eulenspiegel so alt war, daß er stehen und gehen konnte, trieb er viele Scherze mit den jungen Kindern, denn er war voller Tricks. Wie ein Affe tummelte er sich auf allen Kissen und im Gras umher. Mit drei Jahren schon befleißigte er sich dermaßen aller Art Späße, daß alle Nachbarn gemeinsam dem Vater klagten, sein Sohn sei ein Schalk.
Da ging der Vater zum Sohn, und fragte ihn: „Wie geht es doch die ganze Zeit zu, daß unsere Nachbarn sagen, du seist ein Schalk?“ Eulenspiegel antwortete: „Lieber Vater, ich tue doch niemandem was. Das will ich dir ein für alle Mal beweisen. Geh hin, setz dich auf dein Pferd, und ich will mich hinter dich setzen und stillschweigend mit dir durch die Gassen reiten. Dennoch werden sie über mich lügen und sagen, was immer ihnen einfällt. Achte mal darauf!“
Das tat der Vater und nahm den Sohn hinter sich auf das Pferd. Eulenspiegel hob dabei seinen Hintern an, ließ die Leute den bloßen Arsch sehen und setzte sich dann nieder. Die Nachbarn und Nachbarinnen zeigten auf ihn und sprachen: „Schäm dich! Ein Schalk ist das!“ Da sagte Eulenspiegel: „Hör das, Vater! Du siehst, ich bin ganz still und tue niemandem etwas, und doch sagen die Leute, ich sei ein Schalk.“
Der Vater machte es nun anders, indem er seinen lieben Sohn vor sich auf das Pferd setzte. Eulenspiegel saß wieder ganz still, sperrte aber das Maul auf, grinste die Bauern an und streckte die Zunge heraus. Die Leute liefen herzu und riefen: „Seht mal hin! Ein junger Schalk ist das!“ Da sprach der Vater: „Du bist sicherlich in einer unglückseligen Stunde geboren. Du sitzt still, schweigst und tust niemandem etwas, und trotzdem sagen die Leute, du seist ein Schalk.“2
1 Er kehrt der Gesellschaft den Hintern zu, sowohl gleich im ersten Streich wie auch in dem nach seinem Ableben.
2 „Die Allerlistigsten geben sich immer für Feinde der List aus, um sich ihrer bei einer großen Gelegenheit und für einen wichtigen Plan zu bedienen.“ (La Rochefoucauld, 1613–1680).
3. Till ist lustvoll damit beschäftigt, was sich im Spiel und Tun erlernen läßt und entwächst seinem Vater. Hierbei erweist sich die Willkür der Gemeinschaft als hilfreich, sich auch das Scheitern zu Nutze zu machen.Till betätigte sich mit dem Seiltanzen, was die Mutter aber nicht wollte. Sie versuchte, ihn davon abzubringen, doch er trieb es dann heimlich. Als sie ihm einmal beim Tanzen das Seil durchschnitt, fiel er zur Schadenfreude der Dorfleute in die Saale.1
Danach zog der Vater mit seiner Familie in das magdeburgische Dorf an der Saale, woher Tills Mutter stammte. Bald darauf starb der alte Claus Eulenspiegel. Die Mutter blieb zu Hause bei dem Sohn und geriet mit der Zeit in Armut. Eulenspiegel aber wollte kein Handwerk lernen, obgleich er schon an die sechzehn Jahre alt war. Stattdessen trieb er sich herum und lernte so manche Narretei.
Eulenspiegels Mutter wohnte in einem Haus, dessen Hof an die Saale grenzte. Hier begann Eulenspiegel, auf dem Seil zu gehen. Das trieb er zuerst heimlich auf dem Dachboden des Hauses, weil die Mutter seine Torheit, auf dem Seil zu tanzen nicht dulden wollte und ihm drohte, ihn deswegen zu verprügeln. Einmal erwischte sie ihn auf dem Seil, nahm einen großen Knüppel und wollte ihn damit herunterschlagen. Da entzog er sich ihr durch ein Fenster und setzte sich oben auf das Dach, so daß sie ihn nicht erreichen konnte.
Weitere Versuche unterblieben, bis er ein wenig älter wurde. Dann fing er wieder mit dem Seiltanzen an. Er zog das Seil oben vom Hinterhaus seiner Mutter über die Saale in ein Haus gegenüber. Viele junge und alte Leute bemerkten das Seil, auf dem Eulenspiegel laufen wollte und kamen aus Neugierde herbei, um zu sehen, was für ein seltsames oder bestaunenswertes Spiel er treiben wollte.
Als nun Eulenspiegel auf dem Seil im besten Tanzen war, bemerkte es seine Mutter, konnte ihm aber direkt nicht viel antun. Deshalb schlich sie sich heimlich hinten in das Haus auf den Dachboden, wo das Seil angebunden war, und schnitt es entzwei. Da fiel ihr Sohn unter schadenfrohem Spott der Leute ins Wasser und badete tüchtig in der Saale. Die Bauern lachten sehr, und die Jungen riefen ihm laut zu: „Hehe, bade nur gut aus! Du hast lange nach dem Bad gestrebt!“
Das verärgerte Eulenspiegel sehr. Das Bad machte ihm nichts aus, wohl aber das schadenfrohe Spotten und Rufen der Jungen. Er überlegte, wie er es ihnen wieder vergelten und heimzahlen wollte. Und er badete sich aus, so gut es ging.
1 Der Seiltanz, im Mittelalter von der Kirche streng verboten, wurde erst wieder nach der Französischen Revolution praktiziert.
4. Till fühlt sich weiter als Teil der Gemeinschaft und macht sich wiederum klar, dass auch die Mehrzahl der Menschen nicht weiß, was „die rechte Hand tut, während die Linke“ arbeitet.Er lernt Wahres vom Unwahren zu unterscheiden, ohne Schuld auf sich zu laden.Eulenspiegel rechnete mit den Dorfleuten ab, die ihn beim Sturz vom Seil ins Wasser schadenfroh ausgelacht hatten.
Kurze Zeit danach wollte Eulenspiegel den Dorfleuten die Beleidigung beim Bad begleichen. Er zog das Seil aus einem anderen Haus über die Saale und machte die Leute glauben, dass er abermals auf dem Seil gehen wolle. Das Volk rannte bald herzu, Jung und Alt. Und Eulenspiegel sagte zu den Jungen, jeder solle ihm seinen linken Schuh geben, denn er wolle ihnen mit den Schuhen ein hübsches Kunststück auf dem Seil zeigen. Die Jungen glaubten das, und alle meinten, es sei wahr, die Alten auch. Die Jungen begannen, die Schuhe auszuziehen und sie Eulenspiegel zu geben. Es waren beinahe hundertzwanzig Jungen. Eulenspiegel hatte die Hälfte ihrer Schuhe. Da zog er sie auf eine Schnur und stieg damit auf das Seil. Als er auf dem Seil war und auch die Schuhe oben hatte, sahen die Alten und Jungen zu ihm hinauf und glaubten, er wolle ihnen ein lustiges Stück mit den Schuhen darbieten. Ein Teil der Jungen war aber betrübt, denn sie hätten gern ihre Schuhe wiedergehabt.
Als nun Eulenspiegel auf dem Seil seine Künste aufführte, rief er plötzlich: „Passt mal auf! Jeder suche seinen Schuh wieder!“ Er schnitt die Schnur entzwei und warf alle Schuhe von dem Seil auf die Erde, so daß ein Schuh über den anderen purzelte. Da stürzten die Jungen und Alten herzu, einer erwischte hier einen Schuh, der andere dort. Der eine rief: „Dieser Schuh ist mein!“ Der andere schrie: „Du lügst, er ist mein!“ Und so fielen sie sich in die Haare und begannen einander zu prügeln. Der eine lag unten, der andere oben, der eine schrie, der andere weinte, der dritte lachte. Das währte so lange, bis auch die alten Ohrfeigen austeilten und sich bei den Haaren zogen.
Eulenspiegel saß während des Getobes auf dem Seil, lachte und rief: „Hehe, sucht nun die Schuhe, gestern musste ich ausbaden!“ Dann lief er von dem Seil und ließ die Jungen und Alten sich um die Schuhe zanken.
Vier Wochen lang durfte sich Eulenspiegel den Jungen und Alten nicht zeigen. Deshalb saß er zu Hause bei seiner Mutter und beschäftigte sich mit allerlei Dingen. Da freute sich die Mutter sehr und meinte, es würde noch gut werden mit ihm. Aber sie wusste nichts von dem Streich, den er gespielt hatte und weswegen er sich draußen nicht sehen lassen durfte.
5. Till erkennt Selbstverantwortung, sowohl für Gemeinsames in der Familie als auch für das eigene Leben und hebt sich von der Kindheit ab.Trotz großer Not und des beständigen Drängens seiner Mutter, ein Handwerk zu erlernen, bleibt Till sich treu.
Eulenspiegels Mutter war froh, daß ihr Sohn so häuslich war, schalt ihn jedoch, daß er kein Handwerk lernen wollte. Er schwieg dazu, doch die Mutter ließ nicht nach, ihn dafür zu tadeln. Schließlich sagte Eulenspiegel: „Liebe Mutter, wozu sich einer entscheidet, das wird ihn sein Leben lang erhalten.“1
Darauf erwiderte die Mutter: „Wenn ich so nachdenke, ich habe seit vier Wochen kein Brot in meinem Haus gehabt.“ Eulenspiegel antwortete ihr: „Meine Rede war von was anderem. Aber ein armer Mann, der nichts zu essen hat, fastet am Sankt Nikolaustag [einem Fasttag], und wenn er was hat, so ißt er mit Sankt Martin zu Abend. So essen wir auch.“
1 „Im Menschen sind bei seiner Geburt von Gottvater vielerlei Samen und Keime für jede Lebensform angelegt; welche ein jeder hegt und pflegt, die werden heranwachsen und ihre Früchte in ihm tragen.“ Pico della Mirandola, Giovanni, De hominis dignitate (Über die Würde des Menschen). Übersetzt von Norbert Baumgarten, hgg. und eingeleitet von August Buck, Hamburg 1990. Zit. nach Peter Walter, „List in ungewohntem Gewande: ‚vafrities‘“, in: Die List, hgg. von Harro von Senger, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1999, S. 191.
„... im Grunde lässt sich seit Pico della Mirandolas Rede über die Würde des Menschen Menschsein nur als offenes Projekt beschreiben. Menschsein bedeutet demnach, ein Wesen mit der Möglichkeit der Selbstgestaltung und Selbstauslegung zu sein.“ Konrad Paul Liessmann, „Das, was nicht sein soll“, in: Was ist der Mensch?, hgg. von Detlev Ganten et al, Berlin, New York (Walter de Gruyter) 2008, S. 166.





























