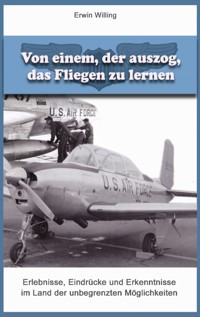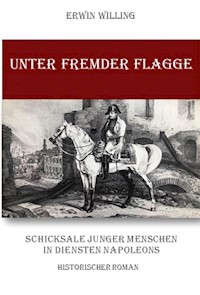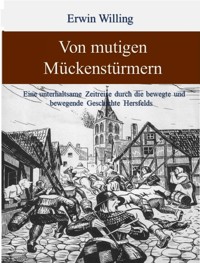
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hersfeld gehört nicht nur zu den ältesten Städten des Hessenlands, sondern auch zu dessen geschichtlich bemerkenswertesten Orten. Die Stadt verdankt ihre Entstehung der Gründung des Klosters am Fuß der "Buchonischen Waldwüste" nahe der Mündung der Geis in die Fulda durch Lullus im Jahr 769. Er war der Lieblingsschüler des Missionars der Deutschen, Bonfatius. Jahrhunderte lang stritten Kloster und Rathaus um die Vorherrschaft in der Stadt. Die Auseinandersetzungen erreichten ihren Höhepunkt in der Vitalisnacht 1378 und endeten 1606 mit der Reformation und der Auflösung des Klosters zugunsten der weltlichen Stadtregierung. Der Landgraf von Hessen-Kassel wurde in Personalunion Fürst von Hersfeld. Die in dem Buch nacherzählte Geschichte sowie die Geschichten über Land und Leute in Hersfeld und Umgebung entstammen großenteils dem "Hersfelder Intelligenzblatt" und deren Nachfolgerin, der "Hersfelder Zeitung" der Jahrgänge 1828 bis 1928. Sie stimmen oft nachdenklich, mitunter heiter und muten uns Nachfahren manchmal recht sonderbar an. Das Buch ist ein Lesegenuss nicht nur für heimatgeschichtlich interessierte Leser.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erwin Willing
Von mutigen Mückenstürmern
Eine unterhaltsame Zeitreise durch die bewegte und bewegende Geschichte Hersfelds
Zum Buch
Den Spottnamen „Mückenstürmer“ verdanken die Hersfelder einem Ereignis, das beinahe 350 Jahre zurückliegt. Eine schwarze Wolke hatte die Turmspitze ihrer Stadtkirche umhüllt. Es wurde Feueralarm geblasen. Jeder Mann, der laufen konnte, schleppte Wasser in Kübeln herbei, bis man schließlich erkannte: „’s eß wärrlich nur’n Meckeschwarm!“. Sturm liefen im Übrigen Stadtväter und Bevölkerung Hersfelds entschlossen und furchtlos gegen Unterdrückung und Unrecht vonseiten der Obrigkeiten. Von Strafmaßnahmen ließen sie sich nicht abschrecken.
Es war ein langer verbissener Kampf, bis sich die Stadt aus der Umklammerung der Äbte des Klosters Hersfeld befreien konnte. Während der Bauernkriege hatte sich Bürgermeister und Rat der Stadt auf die Seite der unterdrückten Bauern geschlagen. Dafür wurden sie vom Landgrafen von Hessen abgestraft. Während der napoleonischen Kriege verprügelten verbitterte Hersfelder eine Kompanie italienischer Soldaten, die in Napoleons Diensten standen. Dank des badischen Oberstleutnants Lingg fiel die Rache milde aus. Als die Hersfelder mutig für die neue liberale hessische Verfassung einstanden, bekamen sie den Zorn des Kurfürsten von Hessen zu spüren.
Einem Mann namens Erwin Walk, genannt „Batsche Välde“, ist es zu verdanken, dass ich Zugang zu den vielen Geschichten aus der bewegten und bewegenden Geschichte Hersfelds bekam. Er hatte sich Anfang 2.000 der Herkulesaufgabe unterzogen, Meldungen aus dem „Hersfelder Intelligenzblatt“ und dessen Nachfolgerin, der „Hersfelder Zeitung“, der Jahrgänge 1828 bis 1928 zusammenzutragen und zu transkribieren. Sich selbst nannte er „Zeitungsabschreiber“.
Dieses Buch ist eine umfangreich überarbeitete Neuauflage mit vielen Abbildungen aus früheren Tagen der Stadt Hersfeld. Es ersetzt den Titel „Es war nicht immer gut in der guten alten Zeit“, dessen Veröffentlichung ich inzwischen storniert habe.
Augsburg im November 2023 Erwin Willing
Erwin Willing
Von mutigen Mückenstürmern
Eine unterhaltsame Zeitreise durch die bewegte und bewegende Geschichte Hersfelds
Impressum
Copyright: © 2023 Erwin Willing [email protected]
Abb. Deckblatt und letzte Seite: Archiv Post
Sonstige Abbildungen: Archiv Erwin Walk, soweit nicht besonders vermerkt
Neuauflage
Verlag: epubli GmbH, Berlin
Druck: epubli - ein Service der neopubli GmbH
Inhaltsverzeichnis
Altehrwürdige Bildungsanstalt
Eine außergewöhnliche Persönlichkeit
Nachkriegszeit, Nachkriegsleid
Aus Feinden werden Freunde
Wie alles anfing
Bilder einer mittelalterlichen Stadt
Machtkämpfe
Zeitenwende
Die Franzosen kommen
Die Hessen werden Westfalen
Treulose Kurfürsten
Öffentliche Ordnung
Höchste Eisenbahn
Morgenröte einer besseren Zeit
Velozipede und Automobile
Bruder Lolls
Stadtregierung
Politische Verwerfungen
Das Wesen der Frau
Impressionen aus früheren Hersfelder Tagen
Quellenverzeichnis
Anmerkungen
Also lautet der Beschluss, dass der Jung‘ was lernen muss1
Wie an jedem Wochentag, Montag bis Sonnabend, reißt mich auch heute Punkt sechs Uhr mein Monsterwecker gnadenlos aus dem Tiefschlaf und erinnert mich daran, dass ich heute wieder zum Gymnasium nach Hersfeld fahren muss. Das hatten mir meine Eltern eingebrockt. Sie wollten, dass ich im Herbst 1946 von der Volksschule auf die Oberschule wechseln sollte. Das entsprach überhaupt nicht meiner Lebensplanung. Ich wollte eigentlich Schreiner oder Lokomotivführer werden. Dafür brauche man doch kein Abitur, widersprach ich den Eltern. Niemand aus meinem Heimatort gehe aufs Gymnasium. Außerdem kenne ich in der Stadt doch niemanden. Im Dorf erzähle man sich, dass die Städter recht hochnäsig seien und unsereins vom Dorf als „ungehobelte Bauernlümmel“ beleidigen.
Ich gab auch zu bedenken, dass meine Schulkameraden bis zu meinem Abitur in neun Jahren ihre Lehre abgeschlossen hätten und in ihren Berufen bereits gutes Geld verdienen würden. Ich wäre dann immer noch ein „armer Lümper“. Selbst mein Einwand, dass monatlich 50 Reichsmark Schulgeld zu zahlen seien, konnte meine ansonsten sparsame Mutter nicht umstimmen.
Es half alles nichts. Ab Herbst 1946 musste ich mit Ausnahme der Ferien an jedem Werktag in die Stadt der „Mückenstürmer“ fahren. Es war mir eine Genugtuung, dass diese von mir verschmähte Stadt so genannt wurde. Die „Herschfeller“ hatten nämlich in früherer Zeit einen Mückenschwarm, der um den Kirchturm tanzte, für Rauch gehalten und Feueralarm ausgelöst.
Unter dem Hahn über der Spüle in der Küche schmeiße ich mir eine paar Hände voll eiskalten Wassers ins Gesicht. Das vertreibt die letzten Schlafgeister. Salz ersetzt auch an diesem Morgen die Zahnpasta. Versorgungsengpässe, wo man hinschaut. Wenn man die Kaufleute nach irgendwelchen Waren fragt, kommt man fast immer die stereotype Auskunft: „Nee, das hammer net, das kriegn mir au so schnell net rinn:“
In Sorge, dass ich meinen Zug nach Hersfeld versäume, hat meine Mutter den Frühstückstisch gedeckt und mein dürftiges Pausenbrot in Zeitungspapier eingewickelt. Die dünnen, von ihr mit dem Brotmesser geschnittenen Scheiben sind fast durchsichtig. Wir Kinder nennen sie „Mondblätter“, weil man angeblich durch sie hindurch den Mond sehen könne.
Brot ist in diesen Zeiten ein wertvolles Gut, das man nur im Tausch mit den wenigen Brotmarken auf der Lebensmittelkarte erwerben kann. Um dessen Verbrauch einzuschränken, sind die Bäcker von Amts wegen verpflichtet, kein frisch gebackenes Brot zu verkaufen. Angeblich soll älteres Backwerk mehr sättigen als das fast noch ofenwarme, das nur Lust auf mehr wecke. Butter gibt es fast nur noch auf dem Schwarzmarkt. Dafür muss man viel Geld in die Hand nehmen. Pflanzenmargarine soll gesünder sein, wird uns erzählt. Aber selbst die ist rar und oft ausverkauft. Die Verpflegung der Menschen in den Dörfern ist dennoch im Vergleich zu der katastrophalen Ernährungslage in den Städten geradezu üppig.
Auch an diesem Morgen drängt die Zeit. Kurz nach sieben fährt mein Zug vom drei Kilometer entfernten Bahnhof Mecklar ab. Es ist noch stockdunkel, als ich das Haus über den Ausgang zum Hof verlasse. Die feuchtkalte Nachtluft schlägt mir entgegen. Wieder einmal hält die gefühlte Temperatur nicht das, was der Wettermann im Radio versprochen hat. Der Oktoberwind rauscht durch die fast kahlen Äste der Linde auf dem Schulhof und wirbelt die letzten, noch hängen gebliebenen Herbstblätter durch die Luft, um sie irgendwo wieder fallen zu lassen.
Vorbei an Schweine- und Hühnerstall, aus dem schon kräftiges Gackern und Krähen dringt, renne ich zur Scheune, um mein Fahrrad zu holen. Es ist eine recht betagte „alte Geis“. So nennt man hier abfällig ein aus der Vorkriegszeit stammendes, schon ziemlich altersschwaches Zweirad-Vehikel. Alle Nase lang ist ein Reifen platt. Die x-mal reparierten Schläuche gleichen einem Flickenteppich. Immerhin habe ich ein Herrenrad, denn es ist unmännlich und wäre mir peinlich, mit einem Damenrad gesehen zu werden.
Heute ist der Weg besonders beschwerlich. Der starke Gegenwind fordert meine ganze Kraft. Der betagte Dynamo erzeugt nur flackerndes Licht, so dass mir kaum eine Pfütze auf der holperigen Schotterstraße erspart bleibt. Am Bahnhof warten bereits viele Erwachsene und ein paar Schüler auf den so genannten „Arbeiterzug“. Der Wartesaal ist gesteckt voll, so dass man kaum zum Fahrkartenschalter vordingen kann. Andere Menschen warten geduldig draußen vor dem Holzzaun, der den Zugang zu der Unterführung und den Gleisen versperrt.
Ein schrilles Klingelzeichen meldet, dass unser Zug soeben in Bebra abgefahren ist. Für mich ist die Einfahrt eines Zugs immer der spannendste Moment einer Bahnfahrt. Was für eine Lok haben die in Bebra diesmal vor den Zug gespannt, frage ich mich regelmäßig? Meist ist es die kleinere Personenzug-Lokomotive der Serie 38. Ein Schauer läuft mir jedes Mal über den Rücken, wenn ausnahmsweise die gewaltige 01er Schnellzuglok dem Personenzug vorausfährt.
Vom Bahnhof Hersfeld (erst 1949 Bad Hersfeld) zu meiner Schule am Neumarkt erwartet mich ein langer Fußweg. Er führt mich durch die langgestreckte Dudenstraße, die früher Kaiserstraße hieß. An deren Ende biege ich in die Breitenstraße ab, die ihrem Namen alle Ehre macht. Auch sie zeigt sich mir um diese Tageszeit noch wie ausgestorben. Bei Sauers, dem Herrenbekleidungshaus, ist noch alles verriegelt. Wie oft musste ich mit meiner Mutter gegen meinen Willen in dieses Geschäft, wenn sie etwas zum Anziehen für mich suchte. Auch die schweren Stahlgitter vor den Schaufenstern und der Eingangstür des Uhren- und Fotogeschäfts André auf der gegenüberliegenden Seite sind noch heruntergelassen. Bei dem auf mich immer sehr vornehm wirkenden Herrn André lässt mein Vater immer seine Negativfilme entwickeln und auf Papierabzüge kopieren.
Ich tauche in die Enge und Finsternis des Kettengässchens ein. Tatsächlich hängen Ketten an den Zugängen. Die hohen Häuserwände rechts und links des schmalen aufsteigenden Fußwegs schlucken das bescheidene Licht der aufgehenden Sonne. Ich gehe jede Wette ein, dass sich noch nie ein Sonnenstrahl in diesen dunklen Gang verirrt hat. Man erzählt sich, dass die Stadtväter früher einmal eine Verbindungsstraße zwischen der Breitenstraße und dem Neumarkt bauen wollten. Trotz mehrerer Anläufe im Bürgerausschuss und in der Stadtverordnetenversammlung kam keine Mehrheit dafür zustande. Man begnügte sich mit dem Verbindungsgässchen.
Oben in der Straße mit dem Namen Hanfsack angekommen, atme ich das wohltuende Licht und die frische Morgenluft tief ein, Auf der rechten Seite erstreckt sich das lange Gebäude der „Schauburg“. Ich kann mich an den Plakaten in den Schaukästen des Kinos nicht satt sehen. Ich gehe gern ins Kino. Mein schmalen Taschengeldzuwendungen erlauben mir aber nur selten, mich diesem Vergnügen hinzugeben. Nach Ende der wenigen Vorstellungen, die ich mir leisten kann, bin ich jedes Mal berauscht vom Zauber der Welt der Schönen und Reichen, von der ich aber nur träumen kann. Viel zu schnell hat mich mein bescheidener Alltag wieder eingeholt. Das wird mir besonders dann bewusst, wenn ich bei der Schaumburg um die Ecke biege und die „Penne“ vor mir auftaucht.
Wir Sextaner gehören dem ersten Jahrgang nach Kriegsende an. Die alliierten Siegermächte hatten allen Schulen eine halbjährige Zwangspause verordnet, um das Bildungssystem und die Köpfe des Lehrpersonals vom Muff des Nationalsozialismus zu befreien. Im November 1945 durfte der Unterrichtsbetrieb an der in „Staatliches Gymnasium und Realgymnasium Hersfeld“ umbenannten höhere Schule zaghaft wieder aufgenommen werden. Die ersten Schüler sind vorwiegend junge Männer, die noch in Eile ihr Notabitur gemacht hatten, bevor sie zum Kriegsdienst eingezogen wurden. Nunmehr bekommen die Wenigen, die den mörderischen Krieg überlebt haben, Gelegenheit, die Abiturprüfung nachzuholen. Viele ihrer damaligen Schulkameraden sind gefallen, andere mit schweren Kriegsverletzungen, oft verkrüppelt, auf die Schulbank zurückgekehrt.
Sie finden die Klassenzimmer und sonstigen Räume der Schule in einem beklagenswerten Zustand vor. Zwar machte das Haus von außen den Eindruck, den Krieg unbeschadet überstanden zu haben. In den Klassenräumen aber sieht es aus, als wären auch hier Schlachten geschlagen worden. Zuletzt waren aus deutscher Kriegsgefangenschaft befreite ehemalige Soldaten und Zivilpersonen verschiedener Nationen, die in der Warteschleife die Zeit bis zu ihrer Rückkehr in ihre Heimatländer verbracht hatten, einquartiert. Da es ihnen offensichtlich kalt war, hatten sie aus den Schulbänken Kleinholz gemacht und sich an Lagerfeuern in den Räumen gewärmt. An Lehr- und Lernmitteln ist kaum noch etwas vorhanden, oder sie sind unbrauchbar beschädigt. In der Turnhalle scheinen die unfreiwilligen Bewohner ihrem Rachegefühl gegenüber ihren ehemaligen Peinigern ebenfalls freien Lauf gelassen zu haben. Mindestens zwei Jahre lang findet der Sportunterricht in der zum Schulhof hin offenen Bergehalle statt. Der geölte, schwarze Stirnholzfußboden fühlt sich wie ein Steinpflaster an.
Das Staatliche Gymnasium und Realgymnasium war noch immer eine (fast) reine Jungenschule. Mädchen gingen auf die benachbarte Höhere Töchterschule, Lyceum oder Luisenschule genannt. Wenn Eltern ihrer Tochter eine humanistische Bildung angedeihen lassen wollten, wurde sie aufs Jungen-Gymnasium geschickt, was aber selten vorkam. Für uns Jungen war es immer ein Hingucker, wenn ein Kleid auf dem Schulhof zu sehen ist.
Altehrwürdige Bildungsanstalt
Dass diese Höhere Schule eine der ältesten dieser Art in Hessen sei, hatte uns Sextanern deren Leiter, Oberstudiendirektor Artur Kraft, bei der Begrüßung mitgeteilt. Wir stünden auf historischem Boden, auf dem der Abt des Klosters Hersfeld, Michael, im Jahre 1570 ein so genanntes „Pädagogium“ gegründet hatte. Michael war nach seinem Vorgänger, Abt Crato I., der zweite Klostervorsteher bürgerlicher Abstammung in Hersfeld. Er war recht begütert. Es bereitete ihm Sorgen, dass es für die Knaben in hiesiger Gegend so gut wie keine Möglichkeit gab, einen höheren Bildungsstand zu erwerben. Er wollte daher
„in einer bedrängten Zeit, in welcher wegen Mangel an Vermögen und an unterrichteten Lehrern Jünglinge von den besten Geistesgaben zu Grunde gingen, keinen besseren Gebrauch von seinem Vermögen machen …, als durch Stiftung einer Schule, in welcher die wahre Religion gelehrt und Religiosität befördert werden soll…einfach, ohne Zusätze menschlicher Traditionen, ohne Sophisterei, wie Vermeidung aller Schwärmerei!“2
Als Schulhaus bot sich das leerstehende ehemalige Franziskanerkloster am Neumarkt an. 40 bis 50 Internatsschüler konnten hier unterrichtet und untergebracht werden.
Als Lehrer kamen nur Theologen in Betracht, die protestantischen Glaubens waren. Da drängt sich doch gleich die Frage auf: Wieso gründet ein katholischer Abt eine Schule, in der protestantische Lehrer unterrichten? Unser Schulleiter blieb die Antwort nicht schuldig. Schon Michaels Vorgänger, Abt Crato I., hatte sich den Lehren Luthers und seiner Reformation zugewandt. Auch sein Nachfolger stand dem Protestantismus näher als den verstaubten Lehren der verweltlichten römisch-katholischen Kirche und dem korrupten Vatikan. Der Dekan hatte sich vom katholischen Glauben abgewandt. Im Kapitel war die Stimmung gemischt. Abt Michaels Hofprediger war ein Protestant namens Mollitor. Ein großer Teil der Bevölkerung Hersfelds hatte sich bereits evangelisch taufen lassen.
Abt Michael stiftete 40.000 Gulden und verfügte, dass von den Zinsen „zwanzig durch Sittlichkeit und Geistesgaben empfehlenswerte Jünglinge“ freien Tisch und freie Wohnung bekommen sollen.3 Dieses Stipendium erhielten aber nur Schüler, die nach dem reformatorisch-protestantischen Bekenntnis getauft waren. Einem Schüler aus Oeynhausen, der lutherischen Glaubens war, wurden Freitisch und freies Wohnen verweigert. Um in das Pädagogium aufgenommen zu werden, mussten die Knaben über angemessene Kenntnisse der lateinischen Sprache verfügen. Sie waren beim Eintritt etwa 11 ½ bis 12 ½ Jahre alt und machten mit 18 bis 20 Jahren Abitur.
Die Umgangssprache in der Schule war lateinisch. Auch außerhalb der Anstalt waren die Schüler verpflichtet, mit Menschen, die der lateinischen Sprache mächtig waren, lateinisch zu sprechen. Deutsch war verpönt. In jeder Klasse wurde ein Schüler zum „Aufmerker“ (Whistleblower) bestimmt. Er musste dem Rektor oder einem der Lehrer Verstöße gegen die Verhaltensregeln des Klosters melden.
Kernfächer des Pädagogiums waren Grammatik, Dialektik und Rhetorik. Alumnaten, so nannte man die Schüler, wurden zusätzlich in Griechisch und Hebräisch unterrichtet, soweit sie geistig dazu in der Lage waren. Auch Musik und Mathematik wurden als „notwendige Mittel zu menschlicher Bildung“ angesehen.4. Die Mehrzahl der Schüler waren Söhne von Pfarrern, Adligen, Gutspächtern, Beamten, Lehrern, Ärzten, Apothekern usw. Einen geringen Anteil stellten Knaben, deren Väter Bauern, Händler oder Handwerker waren. Auch der Sohn eines Scharfrichters soll einmal die Schule besucht haben. Der arme Kerl durfte nicht mit seinen Mitschülern zusammensitzen. Ihm wurde ein gesonderter Platz irgendwo am „Katzentisch“ zugewiesen.
Das Reglement für die Alumnaten war äußerst streng. Sie hatten sich so zu verhalten, wie es die zehn Gebote vorschreiben. Gebete beherrschten den Tagesablauf. Zu den Gottesdiensten marschierten alle Schüler wie bei einer Prozession geschlossen zur Stiftskirche. Nach Rückkehr wurden sie über den Inhalt der Predigt abgefragt. Als Zeichen ihrer besonderen Ehrerweisung hatten sie vor dem Stadtschultheiß, den Ratsherren,
„allen vornehmen Herren, wie auch ihren Hausfrauen, erwachsenen Söhnen und Töchtern, samt anderen ehrlichen Matronen und Jungfrauen den Hut zu ziehen.“5
Abt Michael starb zehn Monate nach Gründung der Klosterschule. An ihn und seine Verdienste erinnert die Abt-Michael-Straße in Hersfeld. Michaels Nachfolger führten diese Anstalt über die Landesgrenze hinaus zu hohem. Der deutsche Kaiser teilt allerdings diese Wertschätzung nicht. Wegen des Ungehorsams gegen die katholische Kirche schickte er im Dreißigjährigen Krieg seinen Bannstrahl nach Hersfeld. Das Pädagogium wurde dem Abt des Klosters Fulda unterstellt. Pfarrer und Lehrer wurden abgesetzt und das Gymnasium den Jesuiten übergeben. Zwei Jahre später stellt Landgraf Wilhelm IV von Hessen-Kassel, auch der Weise genannt, die alte Ordnung des Gymnasiums wieder her. Die entlassenen Lehrer wurden zurückgerufen.
Die Freude über den Neubeginn währte aber nicht lange. Die Lehrer mussten zweimal vor den marodierenden Kroaten und anderen Söldnern des kaiserlichen Heeres fliehen. Als sie endgültig zurückkehrten, fanden sie ein zum größten Teil verwüstetes Schulgebäude vor. Als sich Landgraf Wilhelm IV. gerade in Friedewald aufhielt, packte der Rektor Johann Daniel Krug die Gelegenheit beim Schopfe, seinen Landesherrn persönlich aufzusuchen und um Abhilfe zu bitten. Der Landgraf entschied, dass das Kloster abzureißen und neu zu bauen sei. 1691 waren die Neubauten bezugsfertig. Die Schule erhielt den Namen „Carlinum Hersfeldense“. Die Schülerzahl war auf 104 angewachsen.
1704 wurde Dr. Conrad Mel, die wohl schillerndste Persönlichkeit unter den Rektoren, mit der Leitung des Pädagogiums beauftragt. Er polarisierte und provozierte sowohl in seinem Amt, als auch in der Öffentlichkeit. Piderit schreibt, dass er
„durch seine ausgebreiteten Kenntnisse und rastlose Thätigkeit dem Gymnasium sehr nützlich hätte werden können, wenn er nicht zuviel hätte wirken wollen.“6
Er stellte beinahe alles in Frage, was bisher galt. Dr. Mel führte Vorlesungen ein über Inhalte, die über die Grenzen einer Gymnasialbildung weit hinausgingen. Aus dem „Carlinum Hersfeldense“ wurde eine „Zwitteranstalt zwischen Gymnasium und Universität“7.
Dr. Mel fühlte sich auch zum Sittenwächter über die nach seiner Überzeugung sittlich verkommene Jugend berufen. Um sie zu einem gottgefälligen Leben zurückzuführen, intensivierte er den Religionsunterricht. Er drangsalierte seine Schüler. Sie mussten morgens, mittags und abends aus der Bibel vorlesen. Montags ließ er die Sonntagspredigt wiederholen. Statt sich zu bessern. wurden die Schüler aufsässig und verspotteten ihren Rektor. Mehrmals mussten Soldaten in der Schule für Ordnung sorgen. Mit dem Schultheißen war er in herzlicher Abneigung verbunden. Der gute Ruf des Gymnasiums hatte gelitten. Die Schülerzahlen sanken von anfangs 85 auf 27.
Königliches Gymnasium von Hersfeld um 1880 (Foto „Der Kreis Hersfeld. Vergangenheit und Gegenwart“. Hsg. Landrat des Kreises Hersfeld S. 102)
Eine außergewöhnliche Persönlichkeit
Auf dem Weg zum Gymnasium erinnert mich das blaue Emaille-Straßenschild „Dudenstraße“ an das dicke gelbe Buch auf dem Schreibtisch meines Vaters. Darauf steht: „Duden Die deutsche Rechtschreibung“. Er hatte mir erklärt, dass es nach einem Mann namens Dr. Konrad Duden benannt sei. Dieser gelehrte Wissenschaftler und Lehrer habe das Nachschlagewerk vor mehr als 150 Jahren aus Sorge über die uneinheitliche Schreibweise von Wörtern in Deutschland verfasst. Seiner ersten Ausgabe habe er den Titel „Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache“ gegeben. Hundertausende von Exemplaren seien seinerzeit über die Ladentische der Buchhändler gegangen. Dass man in Hersfeld eine Straße nach ihm benannt habe, so stellte mein Vater fest, sei darauf zurückzuführen, dass Dr. Konrad Duden fast dreißig Jahre lang, genauer von 1876 bis 1905, Direktor des Königlichen Gymnasiums zu Hersfeld gewesen sei.
„Du kannst stolz darauf sein, Schüler dieser altehrwürdigen Bildungsanstalt zu sein“, betonte er.
Dr. Konrad Duden war die herausragende Persönlichkeit unter den Direktoren des Hersfelder Gymnasiums. Er wurde 1829 auf einem Gut in der Nähe von Wesel am Niederrhein geboren. 1876 übernahm er die Leitung des Königlichen Gymnasiums in Hersfeld. Duden kam aus Schleiz (Thüringen), wo er am dortigen Fürstlichen Gymnasium ebenfalls als Direktor tätig war. Hier hatte er begonnen, an seinem später veröffentlichten Wörterbuch der deutschen Sprache zu arbeiten. Viele seiner Schüler kamen aus Elementarschulen der umliegenden Orte. Ihr Deutsch war in Schrift und Wort durch fränkische, thüringische, hessische und sächsische Dialekte stark eingefärbt. Mit einem Standardwerk wollte er insbesondere Schülern aus bildungsfernenFamilien das Lesen und Schreiben der hochdeutschen Sprache erleichtern.
Als Dr. Konrad Duden sein Amt als Direktor des Hersfelder Gymnasiums antrat, hatte er zunächst andere Sorgen, als sich um die einheitliche deutsche Rechtschreibung zu kümmern. Er ist erschüttert über die Disziplinlosigkeiten der Gymnasiasten. Sorge bereitet ihm vor allem eine Schülergruppe, die sich in der Tradition der Studentenvereine der Revolutionsjahre 1848/49 übt. Allerdings treffen sich die Gymnasiasten nicht so sehr mit der Absicht, über politische und gesellschaftliche Themen zu debattieren. Ihre Zusammenkünfte dienen eher organisierten Besäufnissen. Besonders beliebt ist das „Stiefelsaufen“. Wer den Inhalt des einen oder eineinhalb Liter fassenden Glasstiefels in der kürzesten Zeit auf ex trinkt, wird als Stiefelkönig gefeiert. Einen besonderen Spaß haben die Saufbrüder, wenn einer es versäumte, die Stiefelspitze rechtzeitig zu drehen, und ihm der Rest des Bieres ins Gesicht schwappt.
W. Mitze (Hsg.), Bad Hersfeld in alten Ansichten
Ihr Stammlokal ist die Kneipe in der Brauerei Engelhardt, das so genannte „Saufhaus“. Nicht selten kommen Schüler morgens betrunken oder verkatert zum Unterricht. Mitunter bringen Gymnasiasten gar Schusswaffen mit in die Schule, zum Turnen oder in die Badeanstalt. Dr. Konrad Duden war die herausragende Persönlichkeit unter den Direktoren des Hersfelder Gymnasiums. Er wurde 1829 auf einem Gut in der Nähe von Wesel am Niederrhein geboren. 1876 übernahm er die Leitung des Königlichen Gymnasiums in Hersfeld. Duden kam aus Schleiz (Thüringen), wo er am dortigen Fürstlichen Gymnasium ebenfalls als Direktor tätig war. Hier hatte er begonnen, an seinem später veröffentlichten Wörterbuch der deutschen Sprache zu arbeiten. Viele seiner Schüler kamen aus Elementarschulen der umliegenden Orte. Ihr Deutsch war in Schrift und Wort durch fränkische, thüringische, hessische und sächsische Dialekte stark eingefärbt. Mit einem Standardwerk wollte er insbesondere Schülern aus bildungsfernenFamilien das Lesen und Schreiben der hochdeutschen Sprache erleichtern.
Direktor Duden ist ein leidenschaftlicher Pädagoge, dem „Humanität und Milde“8 im Umgang mit seinen Schülern nachgesagt wird. Angesichts der hemmungslosen Ausschweifungen seiner Schüler ist seine Geduld aufgebraucht, und er sieht sich veranlasst, mit aller Härte durchzugreifen. Es hagelt Stubenarrest und Schulverweisungen. Nach zwei bedauerlichen Unfällen beim Umgang mit Schusswaffen droht jedem Schüler, der mit einem Revolver oder einer Pistole erwischt wird, im günstigsten Fall der Verweis von der Schule. Einige müssen verschärften Arrest im Karzer absitzen. Auswärtige Schüler, die in Gasthäusern wohnen, müssen in Privatquartiere umziehen.
Unter Dudens Federführung wurde Ostern 1881 die Städtische Höhere Bürgerschule in Realgymnasium umbenannt und mit dem Königlichen Gymnasium zusammengeführt. Die Schülerzahlen bewegten sich in jener Zeit zwischen 280 und 400. 1892 wurde die Höhere Töchterschule (Lyceum), Luisenschule genannt, „Am Neumarkt“ eingeweiht.
Biertransport der Brauerei Engelhardt um die Jahrhundertwende
Die berufliche Zukunft seiner Schüler liegt Duden sehr am Herzen. Er fühlt sich in der Verantwortung, die Schülereltern immer wieder aufzufordern, ihre Kinder nicht zum Opfer ihres Ehrgeizes zu machen. Von den Eltern ist immer wieder zu hören: „Mein Kind soll es besser haben als ich.“ In einem Gedicht in der „Hersfelder Zeitung“ vom 22. Februar 1902 wird die abschätzige Einstellung vieler Eltern zum Handwerksberuf spöttisch aufs Korn genommen:
„Ein Handwerk soll der Bub nicht treiben, denn dazu ist er viel zu gut.Er kann so wunderniedlich schreiben, ist ein so junges, feines Blut.Nur ja kein Handwerk! – Gott bewahre, das gilt ja heute nicht für fein!
Und wenn ich mir´s vom Munde spare, es muss schon etwas „Besseres“ sein!Das ist der wunde Punkt der Zeiten. Ein jeder will aufs hohe Pferd.
Ein jeder will sich nobel kleiden, doch niemand seinen Schneider ehrt.Der Hände Arbeit geht zu Schanden. Der Arbeitsbluse schämt man sich.Das rächt sich noch in deutschen Landen.Das rächt sich einmal bitterlich!“9
Bereits bei seiner Antrittsrede hatte Duden eindringlich davor gewarnt, das Abitur als den in jedem Fall anzustrebenden Schulabschluss zu betrachten. Duden wird nicht müde, den Eltern immer wieder bewusst zu machen, dass die akademischen Berufe überlaufen und die Gehälter im öffentlichen Dienst sehr niedrig seien. Von ihm soll der schöne Ausspruch stammen:
„Nicht jeder Hahn kann auf dem Kirchturm stehen, viele müssen von der Miste krähen!“
Eltern von Schülern, die kein Universitätsstudium anstreben oder ein Studium nicht finanzieren können, legt er nahe, ihre Kinder nach der Grundschule nicht aufs Gymnasium, sondern aufs Realgymnasium wechseln zu lassen. Es schloss seinerzeit mit der Tertiareife (9. Klasse) und der so genannten „Einjährigen-Prüfung“10ab.
Auch in der recht biederen Hersfelder Gesellschaft sorgt Dr. Konrad Duden für Aufsehen und Ansehen. Ihm ist es zu verdanken, dass der segensreiche „Verein gegen Armut und Bettelei“ gegründet wird. Auch den „Allgemeinen Bildungsverein“ ruft er ins Leben. Durch Vorträge, unter anderem von renommierten auswärtigen Gastrednern, trägt er dazu bei, dass die Hersfelder über den Tellerrand ihrer Stadt hinausschauen können. Um das Kulturleben in der Stadt zu fördern, setzt er sich wortgewaltig dafür ein, Volksfestspiele einzuführen. Trotz anfänglicher Zustimmung seitens der Vereine und Bürger verläuft das Projekt im Sand. Kaum ein Einwohner traut sich, als Laienschauspieler aufzutreten. Immerhin gelingt es ihm, 1902 den „Festspielverein Hersfeld e.V.“ zu gründen. Jahrelang steht der umtriebige Dr. Duden mit viel Umsicht und Engagement der Gesellschaft „Verein“ vor. Sein Wort hat in der Stadt Gewicht.
Alte Klosterschule zu Hersfeld
Dr. Konrad Duden war über 76 Jahre alt, als er sich 1905 von Hersfeld und seinen Schülern verabschiedet und in den Ruhestand nach Sonnenberg bei Wiesbaden zurückzieht. Kurz vorher konnte er noch in der Planungssitzung, bei der es um den Erweiterungsbau des Gymnasiums ging, seine reichhaltigen Erfahrungen einbringen. Am 1. Juli 1909 wird das beeindruckende Gebäude, so wie es sich noch heute im Stadtbild zeigt, fertiggestellt.
Konrad Duden stirbt am 1. Auguste 1911 und wird auf seinen Wunsch im Familiengrab in Bad Hersfeld beigesetzt.
Nachkriegszeit, Nachkriegsleid
Nach Ankunft meines Zuges im Bahnhof Hersfeld steht mir noch ein langer Fußmarsch zum Gymnasium am Neumarkt bevor. In der ansonsten autofreien Dudenstraße kommt mir ein offener Jeep der US-Army mit dem großen weißen Stern auf der Motorhaube entgegen. Er ist mit vier martialisch aussehenden amerikanischen Soldaten besetzt. Ihre Gewehre halten die GI‘s11 zwischen den Knien und mit den Händen fest umklammert. Unter einem Stahlhelm entdecke ich das Gesicht eines „Negers“, wie man seinerzeit landläufig alle Menschen mit dunkler Hautfarbe nennt. Er ist der zweite Schwarze, den ich in meinem Leben sehe. Ich bekomme es mit der Angst, will weglaufen und mich verstecken. Aber wohin soll ich zwischen der dicht bebauten Häuserreihe verschwinden. Ich bin erleichtert, dass die Amis mich nicht beachten.
Am 30. März 1945 hatten amerikanische Truppen am Stadtrand von Hersfeld gestanden, von wo aus sie die Stadt beschossen. Sie vermuteten hier noch immer Widerstandsnester der Wehrmacht. Es ist dem mutigen Einsatz zweier deutscher Wehrmachtsoffiziere zu verdanken, dass Hersfeld vor weiteren Zerstörungen verschont blieb. Der Stadtkommandant, Major Möller, ließ die Stadt gegen erheblichen Widerstand der immer noch mächtigen Nazi-Parteifunktionäre von den hier noch verbliebenen Soldaten räumen. Die abziehenden Wehrmachtssoldaten wurden an der Autobahnbrücke am Eichhof von amerikanischen Panzer-Einheiten eingeholt und gefangengenommen. Einer der Gefangenen war Hauptmann Karl Güntzel. Er informierte die Amerikaner darüber, dass die Stadt frei von deutschen Soldaten sei. Um sich davon zu überzeugen, musste er einen amerikanischen Major in die Stadt begleiten. Am 31. März 1945 gegen 14.00 Uhr marschierten die ersten amerikanischen Panzerabteilungen kampflos in Hersfeld ein.
Der gefangene deutsche Offizier Hauptmann Karl Güntzel führt die Amerikaner in die Stadt (Foto: Konrad Lipphardt)
Die „Alliierte Militärregierung“ übernahm am 1. April 1945 die Hoheitsrechte über die Stadt und den Kreis Hersfeld. Die deutschen Behörden wurden aufgelöst, die bisher geltenden Gesetze und Verordnungen außer Kraft gesetzt. Der Landrat des Kreises Hersfeld und 52 der 82 Bürgermeister der Landgemeinden wurden abgesetzt, weil sie mehr oder weniger dem Nationalsozialismus gedient hatten. Auch der Bürgermeister der Stadt Hersfeld musste seinen Hut nehmen. Straßennamen wurden schnellstens geändert. Die „Adolf-Hitler-Allee“ hieß ab jetzt wieder „Am Kurpark“. Aus der „Hermann-Göring-Straße“ wurde „Stresemannallee“ und die Bewohner der „Wilhelm-Gustloff- Straße“ mussten ihre Adressen auf „Friedrich-Ebert-Straße“ ändern.