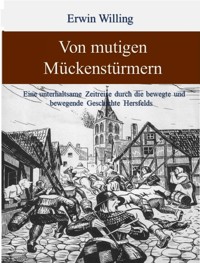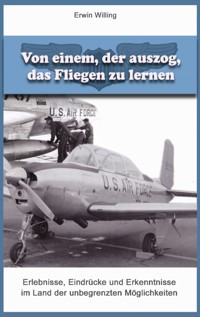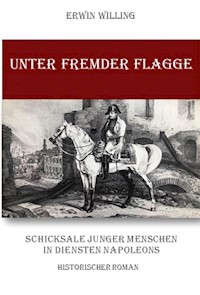Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als einer der ersten deutschen Flugzeugführer schulte der Autor auf dieses seinerzeit modernste, in seinen Flugeigenschaften faszinierendste und einmalige Superflugzeug um. Daran schloss sich eine achtjährige Tätigkeit als Fluglehrer auf diesem Muster an. Der Starfighter begleitete ihn auch weiterhin in seiner Laufbahn als Verantwortlicher in späteren Führungsfunktionen. Wer 15 Jahre lang den Starfighter geflogen ist, kann viel erzählen. Es sind erlebte Geschichten über die Sonnenseite des Fliegens, die Schatten der Abstürze und Todesfälle, nachdenkliche und heitere Erlebnisse, Verdruss über die Unzulänglichkeiten des technisch unausgereiften Flugzeugs und die miserable Ersatzteilversorgung. Die politisch und militärisch Verantwortlichen versuchten mit dem Know-How von gestern ein Flugzeug von morgen zu managen. Auch die Techniker und Piloten in den Verbänden waren überfordert. Erst die Reformen, die General Steinhoff 1966 nach seiner Ernennung zum Inspekteur der Luftwaffe entschlossen einleitete, brachten Besserung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erwin Willing
Vergöttert und verteufelt
Zum Buch
Am heutigen Tag vor 70 Jahren startete der Testpilot des US-Unternehmens Lockheed in Burbank, Kalifornien, zum ersten Flug mit dem wohl bekanntesten und aufsehenerregendsten Kampfflugzeug aller Zeiten, dem Starfighter. Niemand ahnte, dass diesem Meisterstück der Eleganz und Rasanz ein bewegtes, wechselvolles Dasein beschieden sein würde. Der Starfighter entpuppte sich zum umstrittensten und teuersten Rüstungsprojekt der Bundeswehr. Von den 916 beschafften Flugzeugen dieses Typs gingen 292 durch Abstürze und Verluste am Boden verloren. Der hochgelobte Vogel erwies sich trotz seiner taktischen Fähigkeiten als Unglücksrabe. Er wurde mit sarkastischen Schmähbegriffen wie „Witwenmacher“, „fliegender Sarg“ u.a. verspottet .116 deutsche Luftwaffen- und Marinepiloten sowie 6 Fluglehrer der US-Luftwaffe wurden bei Abstürzen getötet, Sie wurden Opfer ehrgeiziger politischer Entscheidungen, einer überhasteten Einführung und eines miserablen Managements.
Wir Piloten waren von den Flugeigenschaften des Starfighters begeistert. Obwohl uns der Tod vieler Freunde und Kameraden sehr betroffen machte, konnten wir der eleganten und eigenwilligen Diva Starfighter nicht gram sein. Ich war einer von denen, die man eigentlich hätte für verrückt erklären müssen. 15 Jahre lang saß ich insgesamt etwa 2.000 Stunden lang im Cockpit dieses, von uns Piloten vergötterten, von Anderen verteufelten Starfighters. Wie ich diesen Spannungsbogen von Enthusiasmus und ernüchternder Wirklichkeit erlebt habe, beschreibe ich in diesem Werk. Mit diesem Buch möchte ich auch an die vielen Piloten erinnern, die im Einsatz für unsere Freiheit ihr Leben gelassen haben.
Zu danken habe ich einigen Freunden und Kameraden, die meinen Erinnerungen nachgeholfen und Fakten beigesteuert haben. Hervorheben möchte ich die sehr hilfreiche Unterstützung durch den leider schon verstorbenen Major a. D. Arnulf Hartl.
Zu meiner Person:
Ich bin 1936 in einem kleinen Dorf in Nordhessen geboren und bis zum Abitur dort aufgewachsen. 1956 Eintritt in die Luftwaffe der Bundeswehr. Ausbildung zum Militärpiloten in den USA. 1983 auf eigenen Wunsch mit Dienstgrad Oberst vorzeitig aus der Bundeswehr ausgeschieden. Studium der Erziehungswissenschaften, Psychologie und Sozialwissenschaften. Abschluss M. A. Bis 2006 Referent in Seminaren der Erwachsenenbildung. Ich arbeite und lebe in Augsburg.
Erwin Willing am 4. März 2024
Erwin Willing
Vergöttert und verteufelt
Erlebte Geschichten eines Starfighterpiloten
Im Wechselbad von Faszination und Ernüchterung
ImpressumCopyright: © 2024 Erwin WillingAuflage 03.24 Vorderseite: Stephanie Balling
Rückseite: K. Kropf. „Deutsche Starfighter“Fotos: Archiv Kropf, soweit nicht andere Quellen vermerkt, Verlag: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
Inhalt
Deutschland hat uns wieder
Auf zu neuen Ufern
Aufklärer
Von bösen Buben
Stippvisite im hohen Norden
Starfighter im Anflug
Erste Eindrücke
Die neue Herausforderung
Highlights
Erste Rückschläge
Flugtag
Ende eines Kunstflugs
Familienplanung mit Hindernissen
Kalter Winter, glückliches Jahr
Ortswechsel
Schwarze Jahre des Starfighters
Neue Aufgaben
Das Maß war voll
Neue Besen kehren gut
Öffentlichkeitpflege
Ereignisse am Rande
Verhätschelte Piloten
Der Tatzelwurm
Luftveränderung
Capo Frasca, Murnau und Mettnau
Bei den „Eifelbären“
Das Beständigste war die Veränderung
Kehraus
Die Starfighter-Affäre
Überforderung
Faszination und Ernüchterung
Quellenverzeichnis
Anmerkungen
Deutschland hat uns wieder
Wir waren noch nicht lange in der Luft, als die Flugbegleiterin über die quäkenden Lausprecher unsere baldige Landung ankündigte. „Meine Damen und Herren, wir haben soeben den Anflug auf den Flughafen Hamburg Fuhlsbüttel begonnen. Stellen Sie bitte das Rauchen ein, schließen Sie Ihre Sitzgurte und stellen Sie Ihre Sitze senkrecht. Vielen Dank.“ Wir, waren ein halbes Dutzend in den USA zu Militärpiloten ausgebildete Leutnante der deutschen Luftwaffe, die nach Abschluss ihrer Schulungen aus den USA zurückkehrten. Nach einem unendlich langen Nachtflug an Bord eines Propellerflugzeugs vom Typ Super Constellation der holländischen Fluglinie KLM waren wir von New York kommend am Freitag, dem 13. Juni 1958, frühmorgens in Amsterdam-Schiphol gelandet. Nach kurzem Aufenthalt ging es weiter nach Hamburg. Wir waren nur ein kleiner Teil unserer Lehrgangsgruppe. Die Mehrzahl hatte sich für eine sechstägige Schiffsreise nach Europa entschieden. Ich aber wollte so bald wie möglich zu Hause sein und bevorzugte das schnellere und „standesgemäße“ Verkehrsmittel Flugzeug. Zudem hatte ich eine frühere Seereise von Cuxhaven nach Helgoland in unangenehmer Erinnerung. Ich war halt eine Landratte.
Von meinem Fensterplatz aus beobachtete ich, wie die Landschaft zwischen weißen Wölkchen vorbeihuschte und langsam Konturen annahm. Das Alte Land mit seinen schnurgerade ausgerichteten Obstbaumreihen und dann das grau-braune, breit geschwungene Band der Elbe, auf der ein paar Schiffe nur als kleine Punkte auszumachen waren, verschwanden unter der Tragfläche der Lufthansa-Convair CV 340 nach hinten. Für die Cockpit-Crew begann jetzt die Phase höchster Konzentration. Ich verfolgte die Landevorbereitungen so aufmerksam, als säße ich selbst im Cockpit. Schließlich kannte ich mich als frischgebackener Flugzeugführer in diesem Metier aus: Geschwindigkeit reduzieren, Landeklappen ausfahren, die erforderliche Sinkrate und die Anfluggeschwindigkeit genau einhalten.
Immer deutlicher hoben sich Felder, Bäume und Straßen von ihrer Umgebung ab. Der Grenzzaun des Flughafengeländes war kurz sichtbar. Nun galt es, im richtigen Moment die Gashebel zurückzunehmen, die Maschine aus dem Sinkflug abzufangen und möglichst sanft aufzusetzen. Das macht immer einen guten Eindruck bei Passagieren. Das Aufsetzen unserer Convair auf die Landebahn hätten unsere amerikanischen Fluglehrer als „smooth Landing“1 bewertet.
Als man mir im Spätsommer 1956 eröffnete, dass ich zur fliegerischen Ausbildung in die USA geschickt werden sollte, war ich wie berauscht vor Freude. Mich erwartete ein unvorstellbar faszinierendes Land, in dem es nur reiche Leute gibt, so war meine Vorstellung. Alles, was ich von jenseits des großen Teiches gehört hatte, klang wie das Paradies auf Erden. Das Goethe-Zitat „Amerika, du hast es besser als unser Continent, der alte“2aus demDeutschunterricht fiel mir spontan ein. Zu Hause war mir auch alles zu spießig. Ich wollte erst mal weg von dem geteilten Deutschland, das noch immer unübersehbare Spuren des Krieges zeigte. Die von den westlichen alliierten Siegermächten vereinbarten Besatzungszonen waren gerade erst aufgehoben worden. „Drüben“ war man modern und fortschrittlich. In dem Land, aus dem die Jazz-Musik zu uns herüberkam, spielte die Musik im doppelten Sinne des Wortes. Zwar gab es auch bei uns zarte Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung. Die Menschen aber mussten noch immer ihre gesamte Energie aufwenden, um ihr tägliches Leben einigermaßen erträglich zu gestalten.
21 Monate später hatte ich die Piloten- und Kampfausbildung in den USA abgeschlossen. Jetzt hieß es, von dem vielgepriesenen Land und den amerikanischen Freunden Abschied zu nehmen. Wir Deutschen waren stets und überall gern gesehene Gäste gewesen. Wir hatten die Menschen, ganz gleich, ob in Uniform oder Zivil, als außergewöhnlich gastfreundlich und hilfsbereit erlebt. Von solchen Tugenden waren die damals noch recht griesgrämigen Deutschen weit entfernt. Dennoch verabschiedete ich mich ohne Wehmut, denn zu Hause erwartete mich ein neuer beruflicher Lebensabschnitt jenseits des ständigen Schülerdaseins. Auch hatte sich mein anfängliches Bild von dem makellosen Amerika inzwischen doch etwas getrübt, was vor allem den rüden Methoden der Vorgesetzten während der militärischen Kadettenausbildung, die wir über uns ergehen lassen mussten, zuzuschreiben war. Zudem spürte ich zunehmend so etwas wie eine Übersättigung vom „American Way of Life“. Die vielen Partys und Barbecues langweilten mich. Die Smalltalks und der obligatorische Austausch von stereotypen Komplimenten hatten ihren Charme längst verloren.
In Wiesbaden wartete meine Freundin auf mich. Wir hatten uns regelmäßig geschrieben. Außerdem stand mein fabrikneuer VW-Käfer mit den Weißwandreifen bereit, von seinem rechtmäßigen Besitzer endlich übernommen zu werden. So sehr ich im Sommer 1956 die Reise in die USA herbeigesehnt hatte, so stark zog es mich jetzt zurück in die Heimat.
Im Ankunftsbereich des Flughafens erwarteten mich meine Mutter und mein Schwager. Sie weinte vor Freude, als sie ihren verloren geglaubten Sohn in die Arme schließen durfte. Bei meiner Abreise in die USA hatte sie sich eigentlich damit abgefunden, dass es ein Abschied für immer sein würde. Fliegen, insbesondere in den Höllenmaschinen von Düsenjägern, war für sie wie ein Ritt auf der Rasierklinge. Mutter und Schwager waren mit meinem neuen VW-Käfer Export in silbergrau und Weißwandreifen angereist. Die Überraschung war gelungen.
Am liebsten wäre ich mit dem Käfer sofort nach Hause gefahren. Dem stand entgegen, dass wir Amerika-Heimkehrer uns am nächsten Tag bei unserer Stammeinheit in Uetersen - am nordwestlichen Stadtrand von Hamburg gelegen - zurückzumelden hatten. Dort lagen die Urlaubsscheine und Versetzungsverfügungen zu unseren Einheiten in der Luftwaffe bereit. Wir hatten sie gegen Empfangsbestätigung persönlich entgegenzunehmen.
Mein Freund Jürgen (r.) und ich vor dem neuen Käfer
Am Samstagmorgen betraten wir die Kaserne, die wir vor beinahe zwei Jahren nach der Grundausbildung verlassen hatten. Zwar trugen wir noch immer dieselbe unkleidsame graue Uniform, die wir damals in der dortigen Kleiderkammer empfangen hatten. Inzwischen aber glänzten Leutnantssterne auf den seinerzeit noch blanken, heute aber mit Silberlitze umsäumten Schulterklappen des kurzen „Affenjäckchens“.
Der für uns Amerika-Heimkehrer zuständige Vorgesetzte eröffnete mir, dass ich zur 2. Staffel der Waffenschule der Luftwaffe 50, die auf dem Fliegerhorst Erding bei München stationiert war, versetzt sei. Meine Planstelle war mit dem Wortmonstrum „Aufklärungsflugzeugführer-Offizier“, abgekürzt AufklFlzFhrOffz, bezeichnet. Auf meine Frage, was meine Aufgabe bei dieser Waffenschule sei, sagte er mir, dass ich dort zum Aufklärungsflugzeugführer ausgebildet werde. Nach Abschluss der Ausbildung würde ich zu einem der noch aufzustellenden Aufklärungsgeschwader versetzt. Diese Verbände hätten im Kriegsfall Truppenbewegungen Kampfanlagen sowie Führungs- und Versorgungseinrichtungen des Gegners aufzuklären und die Waffenwirkung nach einem Angriff festzustellen. Die Waffen, deren Einsatz ich dort erlernen sollte, wären Luftbildkameras. Ich sollte also Fotoshooting für die echten Einsätze der Jäger und Jagdbomber machen. Das war, weiß Gott, nicht das, was ich mir gewünscht hatte. Der Hauptmann meinte, dass ich mir erst mal selbst ein Bild von meiner neuen Aufgabe machen solle. Sollte mir diese Verwendung tatsächlich nicht zusagen, könne ich ja jederzeit eine Versetzung zu einem anderen Verband beantragen.
Nach diesem Gespräch holte ich Mutter und Schwager im Hotel Raabe in Uetersen ab. 450 Kilometer lagen vor uns. Stolz wie Oskar fuhr ich zum ersten Mal mit einem nagelneuen Auto selbständig auf deutschen Autobahnen und Straßen. Je mehr wir uns meinem Heimatdorf näherten, desto unruhiger und aufgeregter wurde ich in Erwartung der vertrauten Landschaft und seiner Menschen. Endlich begrüßte mich das Ortsschild „Meckbach Krs. Hersfeld“. Auf der langgestreckten Dorfstraße, die noch immer ein besserer Schotterweg war, fuhr ich durch mein Heimatdorf. Man rätselte, wer in dem Wagen wohl saß und wo er hinfuhr. Für die meisten Bewohner des Dorfes war ein Auto noch immer ein Hingucker.
Dieser von vielen Augen beobachtete VW Käfer hielt schließlich auf dem Hinterhof des Schulhauses, wo meine Eltern noch wohnten. In Blitzeseile hatte es sich herumgesprochen, dass „Willings Erwin“ wieder zu Hause sei. Ein berühmter Fußballspieler, der nach gewonnener Weltmeisterschaft in seinen Heimatort zurückkehrt, hätte nicht mehr Aufmerksamkeit erregt. Welcher Ort in der näheren Umgebung konnte sich schon damit brüsten, einen Offizier und Jet-Piloten zu seinen Einwohnern zu zählen? Ich genoss es, von Eltern und Geschwistern verwöhnt und von den Verwandten, Freunden und Dorfbewohnern bewundert und gefeiert zu werden. Meine Mutter musste ich allerdings sogleich enttäuschen, denn ich hatte vor, bereits am nächsten Tag zu meiner Freundin nach Wiesbaden zu fahren.
Bis zu meinem Dienstantritt in Erding blieb mir genügend Zeit, auch meinen Segelflugverein in Bad Hersfeld aufzusuchen. Meine Fliegerfreunde, allen voran mein Klassenkamerad Pösti, bereiteten mir im Fliegerheim einen herzlichen Empfang. Es bedurfte keiner Frage, dass ich nach einem kurzen Einweisungsflug mit Fluglehrer im vereinseigenen Sportflugzeug eine Platzrunde solo fliegen durfte. Ein wunderbares Gefühl, nach längerer Pause wieder mal ein Flugzeug zu steuern, auch wenn es „nur“ eine kleine Sportmaschine war.
Als ich nach einer Platzrunde zum Landeanflug einkurvte, lag keine drei Kilometer lange Asphalt-Landebahn, sondern eine verdammt kurze Graspiste vor mir. Zudem standen Bäume im Anflugbereich, die ich mit respektvollem Abstand überfliegen musste, bevor ich den relativ steilen Endanflug beginnen konnte. Es war also doch nicht so einfach, ein kleines Propellerflugzeug zu fliegen, wie ich mir das als stolzer, über solche Kleinflugzeuge erhabener Jet-Pilot vorgestellt hatte. Ich bemühte mich nach Kräften und Können, eine saubere Landung hinzulegen, denn ich durfte mich doch hier nicht blamieren. Meine Rückkehr zur Erde wurde, wie es in Fliegerkreisen heißt, eine „Wochenlandung“. Montag, Dienstag, Mittwoch standen für drei Hopser, die meine Maschine nach dem ersten Aufsetzen vollführte, bevor ihre Räder endgültig am Boden blieben.
Auf zu neuen Ufern
Mein Urlaub war wie im Fluge vergangen. Anfang Juli machte ich mich auf die Reise zu meinem neuen Verband in Erding. Ich war gespannt wie ein Flitzebogen, was mich als zukünftiger AufklFlzFhrOffz erwartete. Als Erstes traf ich dort vier meiner Kameraden aus der Amerika-Crew. Dem gebürtigen Münchner und waschechten Bayern Helmut war der Standort Erding wie auf den Leib geschneidert. Er war begeisterter Segelflieger und Technik-Freak. Sein Zahnmedizinstudium hatte er abgebrochen, um fliegen zu können. Helmut war groß und stämmig, eben, wie man in Bayern sagt, ein gestandenes Mannsbild. Aus seinem leicht pockennarbigen Gesicht ragte eine unförmige, großporige und gerötete Knollennase heraus. Helmuts Flugtauglichkeit war dadurch nicht einschränkt. Seine Nase passte immer noch in die Sauerstoffmaske. Anfänglich glaubten wir, dass es sich um eine typische Säufernase handelte. Damit taten wir unserem Kameraden aber Unrecht, denn er trank selten Alkohol. Er beschäftigte sich lieber mit aerodynamischen und fliegertechnischen Fragen, als seine Zeit in Clubs und Bars zu verplempern. Später erfuhr ich, dass sein unförmiger Riechkolben die Folge einer Hauterkrankung war. Ich habe ihm viel zu verdanken, denn er hat meinem mäßigen technischen Verständnis während unserer Ausbildung in den USA oft nachgeholfen. Er strahlte über das ganze Gesicht, wenn er über fliegerische oder technische Fragen dozieren durfte.
Ebenfalls bayerischer Abstammung und bayerischen Gemüts war Norbert, genannt „Gammel“. Im Unterschied zu den meisten von uns war Norbert Heimschläfer, denn seine Familie lebte in Freising. Er war, wie man es in der Jugendsprache nennen würde, ein cooler Typ. Ihn konnte so leicht nichts aus der Ruhe bringen. Er stand über den Dingen, tat zumindest immer so. Während unserer Ausbildung in den USA verbrachte er seine Freizeit meist in der Kaserne. Selten nahm er an unseren Ausflügen teil. Er konnte stundenlag auf seiner Koje liegen und Abenteuerromane, vorzugsweise Karl May, im Groschenheftformat lesen. Er hielt seine Dollars, die ihm als Auslandszulage ausgezahlt wurden, behutsam zusammen, was man auch an seiner spärlichen Ausstattung mit Zivilkleidung ablesen konnte.
Norbert war begeisterter Skifahrer und Bergsteiger. Unter seiner fachkundigen und geduldigen Anleitung habe ich die ersten Rutschversuche auf Skiern gemacht. In Deutschland hatte er sich seinen Wunsch erfüllt, einen Porsche zu fahren. Ein standesgemäßes Fortbewegungsmittel für einen Jet-Piloten. Dieses Fahrzeug wurde allerdings nicht alt. Kurz nach seiner Rückkehr aus den USA war Norbert auf einer kurvenreichen Bergstraße von der Fahrbahn abgekommen und einen Abhang hinabgestürzt. Im Unterschied zu seinem Porsche blieb „Gammel“ zum Glück unbeschädigt. Danach hat er sich mit einem schlichten VW-Käfer begnügt.
Auch Horst, der bekennende Berliner, gehörte zur Gruppe der neu zur Waffenschule der Luftwaffe 50 versetzten Piloten. Er war unser Streber. Immer darauf bedacht, seine Vorgesetzten durch vorbildliches Verhalten zu beeindrucken. In den USA hatte er es bis zum „Cadet-Lieutenant“ gebracht. Er trug die glänzendsten, „spitshine3-gewienerten Schuhe von uns allen. In Erding achtete er darauf, sich nicht in den Sog des unbotmäßigen und aufmüpfigen Verhaltens seiner Kameraden hineinziehen zu lassen. Seine eng beieinanderstehenden Augen wirkten stechend und strafend, wenn wir uns aus seiner Sicht wieder einmal nicht wie Erwachsene benommen hatten. Horst war eher der Einzelgänger, der an unseren „Debriefings“4, wie wir die „After-Work-Partys“ nach Dienstschluss im Offizierskasino nannten, selten anschloss.
Wir dachten, wir hätten uns verhört, als uns Horst eines Tages zur Taufe seines neuen Autos auf den Parkplatz vor dem Offiziers-Kasino einlud. Bewundernd standen wir um seine Neuerwerbung herum, als er mit einer Flasche Sekt erschien. Weit und breit waren aber keine Gläser zu sehen. Sollten wir etwa alle reihum aus der Flasche trinken? Horst startete den Motor seines ganzen Stolzes, schaltete den Scheibenwischer ein, ließ den Korken knallen und das edle Getränk langsam über die Windschutzscheibe rieseln. Das emsig hin und her flitzende Wischerblatt beförderte den als „Prominentensprudel“ scherzhaft bezeichneten Schaumwein auf die Motorhaube. Welch ein Luxus, eine Autoscheibe zu reinigen, dachte ich mir. Währenddessen taufte er tatsächlich seinen Wagen auf irgendeinen albernen Namen, an den ich mich nicht mehr erinnern kann. Wir klatschten artig und gingen davon aus, dass wir nunmehr von ihm an die Bar eingeladen würden, um sein neues Auto mit uns zu begießen. Fehlanzeige! Horst bedankte sich für unsere Teilnahme an der Taufzeremonie, stieg in sein Gefährt ein und fuhr zu einer Spritztour davon. Das passte in das Bild, das wir von ihm hatten.
Der vierte im Bunde war Uli. Er repräsentierte den Gegenentwurf zu Horst, dem er bereits während unserer Amerikazeit in herzlicher Abneigung gegenüberstand. Uli passte nicht in das herkömmliche Bild des gehorsamen Soldaten. Er polarisierte gern und konnte sehr sperrig reagieren, wenn er den Sinn eines Befehles nicht einzusehen vermochte. Uli war sehr eloquent und schlagfertig. Bevorzugtes und dankbares Opfer seiner scharfen Zunge war selbstverständlich Horst. Mich konnte er mit seiner Lust am Ironisieren mitunter auf die Palme bringen. Er war ein ausgezeichneter Tänzer, was ihm einen weiteren Bonus bei Frauen bescherte.
Auch mancher Vorgesetzte arbeitete sich an Ulis Schlagfertigkeit ab. Er machte sich einen Spaß daraus, seine Vorgesetzten und Offizierskameraden nach Kriterien einzuschätzen, die der ehemalige Heeresgeneral und Teilnehmer am militärischen Widerstand gegen Hitler, von Hammerstein-Equord, seiner Nachwelt hinterlassen hat. Der General beurteilte seine Offiziere nach vier Gruppen: Dumme und zugleich fleißige hielt er für gemeingefährlich. Faule und dumme könnten in untergeordneter Stellung keinen Schaden anrichten. Fleißige und kluge taugten nach seiner Ansicht für mittlere, aber nicht für höchste Stellen, die den klugen und faulen Offizieren vorbehalten sein sollten. Seinen Widersacher Horst steckte Uli in die Schublade der ersten Gruppe.
Ulis Heimatsstadt war Wiesbaden. Seine südhessische Herkunft hatte ihn sowohl mundartlich als auch in seiner Lebensphilosophie geprägt. Seit unserer Ausbildung in den USA war ich mit Uli befreundet. In Erding verband uns von nun an eine Zweckgemeinschaft. Wie ihn zog es auch mich aus verständlichen Gründen an den Wochenenden nach Wiesbaden. Die Abstecher in seine hessische Heimatstadt gerieten meist kurz, denn unser Dienst endete erst am Samstagmittag. Es gab noch keine durchgehende Autobahn, so dass wir uns auf einigen Strecken mühsam auf Landstraßen und durch viele Ortsdurchfahren vorwärts quälen mussten. Uli war anfangs auf meine Fahrgelegenheit angewiesen, denn er besaß noch keinen Führerschein. Seinen blauen Karmann Ghia hatte ich kurz vor seiner Führerscheinprüfung für ihn in Wiesbaden abgeholt und nach Erding überführt.
Unsere Vorgesetzten in Erding waren durchweg kriegsgediente Offiziere. Nach einer zehnjährigen Zwangspause und einem mehr oder weniger erfolgreichen zivilberuflichen Intermezzo hatten sie sich für den Dienst in der neuen Luftwaffe beworben. Soweit sie nicht offensichtlich durch Mittäterschaft für das Nazi-Regime aufgefallen waren, wurden sie eingestellt.
Unser Kommandeur war Oberstleutnant Proll. Als wir uns bei ihm in seinem geräumigen Büro zum Dienstantritt meldeten - militärisch korrekt, versteht sich -, hieß er uns mit festem Händedruck herzlich willkommen. Ein leichtes Lächeln glitt über sein Gesicht. Es verriet uns, dass er sich ehrlich über den Nachwuchs an jungen Flugzeugführern freute. Wir nahmen in einer Sitzecke, bestehend aus bundeswehrtypischen, gelb-schwarz karierten Sesseln, einem farbgleichen, tiefen Sofa und vor dem ebenfalls aus Bundeswehrbeständen stammenden roten Couchtisch Platz. Die Sekretärin brachte Kaffee. Unser neuer Kommandeur stellte uns unseren zukünftigen Verband vor und informierte uns darüber, was uns hier bevorstand und von uns erwartet wurde. Anschließend beantwortete er sehr geduldig unsere Fragen.
Er war ein väterlicher Vorgesetzter. Es zeigte sich, dass er großes Verständnis für den Sturm und Drang seiner jungen, ungezähmten „Fohlen-Leutnante“ hatte. Oft kam er nach Dienstschluss zu unserem abendlichen „Debriefings“ in der Bar des Offizierskasinos vorbei. Manchmal lud er uns auch in seine nahegelegene Wohnung zu einem Absacker ein. Seine Frau war von diesen späten Besuchen wenig begeistert. Schluss mit lustig war es für den Oberstleutnant und späteren Generalmajor, wenn einer seiner Piloten vorsätzlich gegen fliegerische Vorschriften (man nannte dies in der Luftwaffe der Wehrmacht „fliegerische Unzucht“) verstoßen oder sich anderweitig im Dienst oder in der Öffentlichkeit schlecht benommen hatte.
Auch mein erster Staffelkapitän, Major Sommer, entsprach überhaupt nicht dem Klischee des strammen preußischen Offiziers. Er war gebildet und sehr belesen. Äußerlich unterschied er sich von seinen gleichaltrigen Offizierskameraden durch seinen absolut haarlosen Schädel, aus dem listige blaue Augen herausschauten. Sein letztes Haar war ihm schon vor vielen Jahren abhandengekommen. Nur ab und zu zeigte sich ein winziges blondes Haarpflänzchen, das auf diesem Nährboden aber keine Überlebenschance hatte. Man sagte, sein totaler Haarausfall sei durch einen Chemieunfall verursacht worden. Er selbst sprach nicht darüber. Er hatte immer ein freundliches Wort für jeden, dem er begegnete. Ich schätzte ihn auch deswegen, weil er sehr engagiert und verantwortungsbewusst an die schwierige Aufgabe heranging, den Aufbau der Luftwaffe mitzugestalten.
Dieses Pflichtbewusstsein konnte ich nicht bei allen kriegsgedienten Offizieren erkennen. Viele trauerten noch den guten alten Zeiten in der vermeintlich besseren Luftwaffe unter Hermann Göring nach. Die „Innere Führung“, das für die Bundeswehr verbindliche Prinzip der verantwortungsvollen Menschenführung und des respektvollen Umgangs mit Untergebenen in einem demokratischen Rechtsstaat, wurde von vielen älteren Offizieren spöttisch als weiche Welle abgetan und als wirklichkeitsfremd abgelehnt. Sie verspotteten das Führungskonzept und nannten es „Inneres Gewürge“. Ich muss gestehen, dass auch ich die verquasten Texte der Vorschrift zur „Inneren Führung“ nicht ganz verstanden hatte. Vermutlich lag es aber auch an dem mangelnden Interesse, mich damit auseinanderzusetzen
Unser Einsatzoffizier, ein groß gewachsener, schlaksiger Oberleutnant, hatte ein sonderbares Verständnis von seinem Beruf und seinen Aufgaben. Oft tauchte er morgens erst gegen zehn Uhr, leicht verkatert, in der Baracke des Gefechtsstands auf. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir die Einsatzplanung für den Tag zusammen mit unseren amerikanischen Fluglehrern, die in der Aufstellungsphase als Berater bei uns tätig waren, längst erstellt. Einige Maschinen waren zu diesem Zeitpunkt bereits zurück von ihren Einsätzen. Mit bedeutsamer Miene betrachtete der schlaksige Oberleutnant das „Mission-Board“5 und kommentierte es mit witzig gemeinten flotten Sprüchen. Auch sonstige Aufgaben ließ er gerne von Anderen erledigen nach dem Grundsatz: Wer selber arbeitet, verliert den Überblick.
In flüchtiger Erinnerung ist mir auch ein etwas untersetzter, umtriebiger Hauptmann geblieben. Er war sehr freundlich, meist aber nicht zu erreichen. Es hieß, er betreibe zusätzlich noch eine zivile Nebenbeschäftigung, der er manchmal auch während der Dienstzeit nachgehen müsse. Wahrlich, keine Vorbilder für uns junge Leutnante, die den „Alten“ als militärische Führer nachfolgen sollten.
Nur wenige der älteren Herren waren von der Leidenschaft des Fliegens so stark ergriffen, dass sie uns einsatzklare Flugzeuge weggenommen hätten. Besonders bei schlechtem Wetter hatte mancher einen wichtigen Termin wahrzunehmen und stornierte seinen geplanten Flug. Einige flogen am liebsten zu zweit in dem doppelsitzigen Trainingsflugzeug Lockheed T-33 (genannt T-Bird6), um die für die jährliche Verlängerung des Flugscheins und der Fortzahlung der Fliegerzulage erforderlichen Flugstunden zu sammeln.
Unsere Lehrer für die Typeneinweisung auf der RF-84F und die anschließende taktische Ausbildung waren fast ausnahmslos Piloten der US-Luftwaffe. Sie gehörten einem Beraterteam an, das aus dem Chef, einem Lieutenant Colonel7, und sieben weiteren Offizieren bestand. Alle waren erfahrene Piloten und umsichtige Fluglehrer. Sie nahmen ihre Aufgabe sehr ernst und engagierten sich, als diente ihr Einsatz der eigenen Luftwaffe. Diese Einstellung hätte ich mir auch von einigen unserer deutschen Vorgesetzten gewünscht. Viele von ihnen sprachen nur gebrochenes Englisch.
Auch durch ihr äußeres Erscheinungsbild und Auftreten machten die Amerikaner eine bessere Figur als einige unserer kriegsgedienten älteren Offiziere. Unsere Uniform war im Vergleich zu der der Amerikaner zwar nicht sehr kleidsam. Sie saß schlecht und war aus einem Stoff gefertigt, der an Pferdecken erinnerte. Allerdings achtete nicht jeder unserer Vorgesetzten darauf, in gebügelter Hose, knitterfreier Jacke und geputzten Schuhen zum Dienst zu erscheinen.
Wir jungen Offiziere waren überzeugt, dass mit den alten „Kasemattenbären“, wie wir unsere Vorgesetzten mitunter zu bezeichnen pflegten, kein Krieg zu gewinnen sei. Mit dieser Luftwaffe könne es nur aufwärts gehen, meinten wir, wenn die kriegsgedienten Kameraden endlich in Pension gegangen seien. Dann würden wir Offiziere der Nachkriegsgeneration das Kommando übernehmen und endlich Schwung in diesen schwerfälligen Laden bringen.
Erst im Dezember 1957 war der Fliegerhorst Erding von der US-Luftwaffe an die Bundeswehr übergeben worden. Die dort weiterhin stationierte 440. Jagdstaffel der Amerikaner war für die Grenzüberwachung zuständig. Die Piloten flogen das Allwetter-Abfang-Jagdflugzeug Sabre F-86D, das bereits mit Bordradar ausgerüstet war. Die von ihnen in ständiger Bereitschaft gehaltene Alarmrotte musste innerhalb von 15 Minuten gestartet sein, um unangemeldete Eindringlinge aus dem Ostblock zu identifizieren und, falls erforderlich, zur Landung zu zwingen oder gar - im äußersten Fall - zu bekämpfen.
Mit unseren amerikanischen Kameraden pflegten wir jungen deutschen Piloten gute bis freundschaftliche Beziehungen. Wir trafen uns im „Officers Club“, der später als Offizierskasino in deutsche Hände überging, Hier gab es das vielseitige Angebot an preiswerten Getränken, wie wir es von entsprechend großzügig ausgestatteten Betreuungseinrichtungen der US-Luftwaffe in den USA gewohnt waren. Auch bevorzugten wir die Speisekarte des Clubs gegenüber dem Angebot der schlichten deutschen Truppenverpflegung. Ebenfalls zu niedrigen Preisen stand uns Deutschen in dem Club ein monatliches Kontingent der heißbegehrten amerikanischen Zigaretten zur Verfügung. Wer selbst nicht rauchte, konnte sich dort mit einem Mitbringsel für rauchende Verwandte und Freunde eindecken. Natürlich waren die Glimmstängel unversteuert, was uns Jahre später beinahe auf die Füße gefallen wäre. Der Zoll war in den Besitz der Einkaufslisten gekommen und hatte Ermittlungen gegen die vielen Steuerhinterzieher eingeleitet. Mit Hilfe eines Rechtsanwalts konnten wir schließlich erreichen, dass zumindest für uns „Kleinkriminelle“ das Verfahren eingestellt wurde.
Aufklärer
Das Waffensystem, auf dem wir zu Aufklärungsflugzeugführern ausgebildet werden sollten, war der taktische Aufklärer vom Typ Republik RF-84F Thunderflash (RF steht für Reconnaissance Fighter8). Die Ausrüstung für die Luftaufnahmen befand sich in der langgestreckten Nase des Jets. Bis zu sechs Geräte von der riesigen Senkrechtkamera bis zu den kleineren rechts, links und an der Rumpfspitze in einem Winkel angebrachten Luftbildkameras hatten in dem verlängerten Bug der Maschine Platz. Deren Brennweiten betrugen zwischen 15 und 91 cm.
Die RF-84F Thunderflash war aus dem Jagdbomber F-84F Thunderstreak hervorgegangen, auf dem ich die Waffenausbildung in den USA absolviert hatte. Somit kein neues Flugzeug für uns. Daher brauchten wir wohl nur noch zu lernen, wie man aus der Luft fotografiert. So jedenfalls hatten wir es uns vorgestellt.
Wir hatten aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Bevor man uns in der RF-84F den bayerischen Himmel stürmen lassen wollte, sollten wir von Fluglehrern der Flugzeugführerschule „B“ in Fürstenfeldbruck auf der T-Bird mit den Luftverkehrsregeln im engen deutschen Luftraum und den Besonderheiten des Instrumentenflugs bei hiesigen Wetterverhältnissen vertraut gemacht werden. Während der letzten Monate in den USA hatten wir selten ein Wölkchen gesehen. Der bayerische Himmel war aber auch damals schon nicht immer weiß-blau, wie es die Touristik-Werbung gerne versprach.
Auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck war noch immer die US-Luftwaffe Herr im Hause. Aber welcher Amerikaner hätte diesen Zungenbrecher von Ortsnamen korrekt aussprechen können? Also gaben sie diesem Fliegerhorst den Namen „Försti“, da für sie der Buchstabe „ü“ ebenfalls ungewohnt war. Auch wir schlossen uns diesem Sprachgebrauch an. Ebenso schwer taten sich Amerikaner, den Namen des Nachbarflugplatzes Oberpfaffenhofen verständlich über die Lippen zu bringen. Man erzählte sich, dass ein US-Pilot, der beim dortigen Tower Landeerlaubnis einholen wollte und sich beim Aussprechen dieses Wortmonstrums so verhaspelte und verhedderte, dass er wutentbrannt meldete: “Shit, I go to Försti“.
Die Einweisung bei der Waffenschule 50 in das neue Flugzeugmuster und die anschließende taktische Ausbildung zum Aufklärungsflugzeugführer gestaltete sich interessanter als ich zu Beginn gedacht hatte. Mein Fluglehrer war 1st Lieutenant9 McCulloch. Unter seiner Anleitung habe ich viel gelernt. Er war ein recht lockerer Typ. Eines Tages erzählte er mir, dass er in „Länschat“ wohne. Mir war es sehr unangenehm zuzugeben, dass ich diesen Ort, der etwa 40 km von Erding entfernt sein sollte, nicht kannte. Er schrieb mir den Namen auf. Heraus kam „Landshut“.
Unsere Flugzeuge vom Typ RF-84F waren Gebrauchtflieger aus Beständen der US-Luftwaffe, die bereits zwischen 200 und 2.000 Stunden auf den Flügeln hatten. Sie waren Teil des „Mutual Defense Assistance Program (MDAP)“10der Amerikaner für die erst 1955 aufgestellte deutsche Luftwaffe. Sie wurden in den USA in Einzelteile abgerüstet, nach Neapel verschifft und von der italienischen Firma AERFER auf dem dortigen Flugplatz Capodichino wieder zusammengebaut sowie grundüberholt. Nach der Remontage und anschließendem Werkstattflug überführten wir die Maschinen nach Erding. Im Mai 1960 war ich für ein paar Tage nach Capodichino abkommandiert worden, um mit zusammengebauten Maschinen Werkstattflüge durchzuführen. Eine reizvolle Aufgabe. Mit Sicherheit aber auch mit einigen Risiken behaftet. Ich hoffte, dass die italienischen Techniker gute Arbeit leisteten.
Am Donnertag, dem 25. Mai 1960 gegen 16 Uhr, stand eine RF-84F zum Werkstattflug für mich bereit. Die Italiener meinten, dass ich heute noch fliegen solle, damit das Flugzeug morgen abgeholt werden könne. Die Verständigung mit den Technikern während der gründlichen Vorfluginspektion gestaltete sich recht schwierig. Ihr Chef musste in radebrechendem Englisch aushelfen. Es war noch recht warm und die Luft flirrte über dem Beton der Startbahn, als ich endlich um 17:10 Uhr auf der Startbahn losrollte. Nach etwa 1,5 km hatte ich endlich genügend Fahrt, um die lange Flugzeugnase aufzurichten und die Räder vom Boden zu befreien. Die Startbahn grenzte an einen Friedhof, dessen Gelände sanft anstieg.
Da das schwache Triebwerk der RF-84F nur einen flachen Steigwinkel erlaubte, wurde jeder Start in westlicher Richtung mit einem vollbetankten Flugzeug zum Abenteuer. Meine Maschine gewann über dem ansteigenden Grund kaum an Höhe. Fast konnte ich die Inschriften auf den Grabsteinen lesen. Am Ende des Hanges stürzte das Gelände steil in den Golf von Neapel ab. Vor mir tauchte die kleine Insel Procida und gleich dahinter Ischia auf. Nach einer Linkskurve nahm ich Kurs auf die Felseninsel Capri, die fast 600 Meter aus dem Golf von Neapel herausragt. In diesem Moment des Hochgefühls musste ich unwillkürlich an die Schlagerschnulze über die Capri-Fischer denken, die aufs Meer hinausfahren, „wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt“. Sie machten sich Sorgen um die Treue ihrer Frauen und flehten: “Bella, bella, bella Marie, Bleib mir treu, ich komm zurück morgen früh, Bella, bella Marie, Vergiss mich nie.“
Anhand einer Checkliste hatte ich Triebwerkleistung und Flugeigenschaften zu überprüfen. Nachdem ich die einzelnen Punkte in sicherer Höhe abgearbeitet hatte und keine Mängel feststellen konnte, hatte ich noch genügend Kraftstoff für eine ausgiebige Sightseeing-Tour aus der Luft. Zuerst umrundete ich die Ferieninsel Capri. Sicher zum Ärger einiger Urlauber. Über dem offenen Meer, wo es keine Hindernisse gibt und selten jemand einen sieht, kann man auch mal die vorgeschrieben Mindestflughöhe unterschreiten.
Als letzte Sehenswürdigkeit hatte ich mir den Vesuv vorgenommen. Er lag auf meinem Rückweg zum Flugplatz. Wer hat schon Gelegenheit, aus niedriger Vogelperspektive in den gewaltigen Schlund eines schlafenden Vulkans hineinzuschauen? Über dem Krater leitete ich eine steile Linkskurve ein, um dieses geologische Phänomen genauer betrachten zu können. Plötzlich spürte ich einen kurzen Ruck. Es fühlte sich an, als wäre das Flugzeug von unsichtbarer Hand kurz gebremst, aber gleich wieder losgelassen worden. Die Instrumente zeigten keine Störung an. Trotzdem entschloss ich mich, schnellstmöglich zu landen. Nach dem Aufsetzen auf der Piste zog ich den Griff, der den Bremsschirm auslösen und helfen sollte, die Fahrt am Boden zu verringern. Die erwartete Wirkung blieb jedoch aus. Auch im Rückspiegel konnte ich nichts Weißes erkennen, das auf einen geöffneten Bremsschirm hindeutete. Ich musste stark in die Bremsen steigen, um nicht über die Landebahn zu hinauszuschießen.
Nach Abstellen des Triebwerks in der Parkposition stieg ich aus und trat in gebührendem Abstand hinter das noch heiße Abgasrohr. Die Verschlussklappen des Bremsschirmbehälters standen offen. Ihr Inhalt fehlte. Jetzt wurde mir klar, was sich über dem Vesuv ereignet hatte. Der Verschlussmechanismus hatte die Klappen aus unerklärlichen Gründen entriegelt, der Bremsschirm war herausgerutscht und hatte sich kurz geöffnet, bevor er an der Sollbruchstelle abgerissen wurde.
Als der italienische Techniker seinen Mitarbeitern den Zwischenfall erklärte, entstand eine lebhafte Diskussion. Aus dem Stimmengewirr konnte ich immer wieder „Paracadute Vesuvio“ heraushören. Einige amüsierten sich köstlich darüber. Andere schienen zu befürchten, dass der schlafende Riese geweckt worden sei und mit einem Ausbruch pompejischen Ausmaßes reagieren könnte.
Zwei Tage später startete ich zum nächsten Werkstattflug. Auch diesmal störte ich die Totenruhe der verstorbenen Neapolitaner. Nach etwa 30 Minuten Flugzeit wurde ich in 5.000 Meter Höhe durch einen dumpfen Knall und anschließendem Gepolter von meiner beschaulichen Fliegerei aufgeschreckt. Das Rumpeln erinnerte mich an das Geräusch beim Ausfahren des Fahrwerks. Tatsächlich leuchteten die beiden grünen Lampen des Hauptfahrwerks, was auf ausgefahrene Räder schließen ließ. Der Fahrwerkhebel befand sich aber weiterhin in der „UP“-Position. Die Bugradanzeige blieb dagegen unverändert dunkel. Etwa in der Mitte der rechten Tragfläche entdeckte ich eine starke Ausbeulung. Ich erklärte „Mayday – Mayday – Mayday“, das internationale Notrufsignal. Nach diesem Notruf werden von den Bodenstellen unverzüglich alle Maßnahmen getroffen, um die Landung des havarierten Flugzeugs auf dem nächstgelegenen, geeigneten Flugplatz sicherzustellen.
Sie leiteten mich zum Flughafen Brindisi, der sowohl zivil, als auch militärisch genutzt wurde. Im Anflug wurde es nochmal spannend. Für eine ordnungsgemäße Landung brauchte ich auch noch ein ausgefahrenes Bugrad. Andernfalls würde die lange Nase der RF-84F kurz nach dem Aufsetzen auf die Landebahn herunterfallen und entlang einer Funkenstraße auf dem Beton dahinschliddern. Das könnte einen Brand auslösen. Für diesen Fall hätte die Landebahn vorher von der Feuerwehr mit Schaum belegt werden müssen. In höchster Anspannung legte ich den Fahrwerkhebel in die „Down“-Position und atmete auf, als auch die Bugradanzeige grün aufleuchtete. Die Landung verlief ohne weitere Vorkommnisse. Mechaniker stellten fest, dass der Zylinder, der das rechte Fahrwerk betätigt, unter dem hohen Druck der Hydraulikflüssigkeit geborsten war. Die Reparatur könnten nur die Spezialisten von der Firma AERFER in Capodichino durchführen, sagte man mir. Auch habe man hier keine Ersatzteile.
Zurück nach Neapel gab es nur die Eisenbahn. Also schnappte ich mir meinen Fliegerhelm samt Sauerstoffmaske und das Kniebrett, auf dem die Checkliste festgeklemmt war. Den Fallschirm schnallte ich mir wie einen Rucksack auf den Rücken. Ein Soldat fuhr mich zum Bahnhof, wo ich mir eine Fahrkarte kaufte und noch einen Zug für die sechseinhalb stündige Fahrt mit einmal Umsteigen nach „Napoli Centrale“ erwischte. Nicht nur wegen meiner grauen Fliegerkombination, von uns „Strampelanzug“ genannt, erregte ich überall höchste Aufmerksamkeit. Auch mein außergewöhnliches Gepäck zog verwunderte Blicke auf sich. Die anderen Fahrgäste mögen sich gefragt haben, wozu man im Zug einen Fallschirm braucht.
Die Maschine, die ich am nächsten Tag von Capodichino nach Erding überführen sollte, stand jetzt beschädigt in Brindisi. Eine lange, unbequeme und lärmintensive Rückreise mit dem Transportflugzeug Nord Noratlas der deutschen Luftwaffe, kurz Nora genannt, stand mir bevor.
Außer dem Einsatzflugzeug RF-84F standen uns in Erding einige T-Birds zur Verfügung, mit denen wir ebenfalls unsere fliegerische Fitness vor allem im Instrumentenflug aufrechterhalten konnten. Auch viersitzige, einmotorige Propellerflugzeuge vom Typ Piaggio P149 (genannt „Pitschi“) gehörten zum Flugzeugbestand der Waffenschule 50.
Besonders begehrt war die T-Bird für Überlandflüge. Der zweisitzige Trainer war zuverlässig, verfügte über eine große Reichweite und konnte fast auf jedem Militärflugplatz betankt, gewartet und nötigenfalls repariert werden. Flüge nach England, Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland, Dänemark und Norwegen gehörten zum Übungsprogramm. Es war noch die Zeit, als man damit angeben konnte, vor drei Stunden noch in Madrid gewesen zu sein. Meist flogen wir im Zweierverband. Beliebtestes Ziel war der Flugplatz Son San Juan auf Mallorca, der damals überwiegend von der spanischen Luftwaffe genutzt wurde.
Da weder die Schweiz noch Österreich dem NATO-Bündnis beigetreten waren, durften wir deren Territorien nicht überfliegen. Unsere Reisen nach Süden führten uns daher zunächst nach Westen über Straßburg und weiter nach Dijon. Erst von dort nahmen wir südlichen Kurs in Richtung Funkfeuer Lyon und weiter entlang des Rhône-Tals. Die von großen Lagunen beherrschte Landschaft der Carmargue ging fast nahtlos in das Mittelmeer über. Ab jetzt war zwölf Kilometer unter uns und unendlich weit vor uns nur noch Wasser zu sehen.