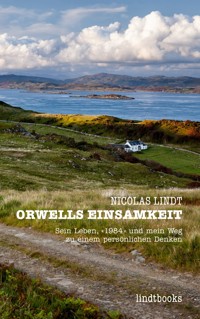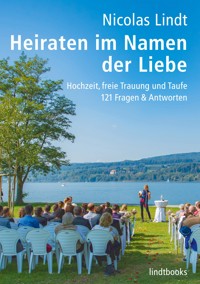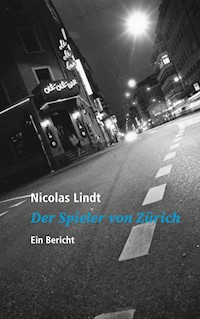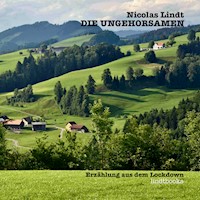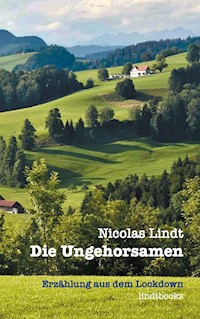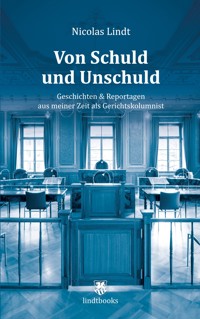
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nicolas Lindt Von Schuld und Unschuld Keine Mordtat im Zürich der letzten Jahrzehnte hat so viel Aufsehen erregt wie die Tat des Chefbeamten Günther Tschanun, der 1986 vier seiner Mitarbeiter gezielt erschoss und einen weiteren schwer verletzte. Nicolas Lindt war Ende der 80er-Jahre Gerichtskolumnist bei der «Schweizer Illustrierten». Sein umfassender Bericht über den Fall Tschanun ist der erste von rund 40 Geschichten und Reportagen in diesem Buch. Ebenso packend und engagiert schreibt der Autor über den spektakulären Steinschlag-Prozess vor dem Kriminalgericht Glarus, bei dem ein Mann angeklagt war, seine Gattin auf einer Wanderung mit einem Stein erschlagen zu haben. Nicolas Lindt gelangte durch seine Kolumne in Gerichtssäle überall in der Schweiz. Er suchte die Schauplätze auf und schildert eindrücklich, wie das Schicksal aus Menschen Täter und Opfer macht. Seine Berichte lassen uns teilhaben an der Art und Weise, wie Gerichte im letzten Jahrhundert urteilten. Vieles hat sich seither geändert - aber damals wie heute steht im Vordergrund die menschliche Dimension einer Straftat. Von ihr erzählt dieses Buch. «Brillant geschriebene Stories» Neue Luzerner Zeitung «Nach der Lektüre bleibt ein Leser zurück, der über Gerechtigkeit und Schuld reflektiert - was die Hauptleistung des Buches ausmacht.» Zürcher Oberländer «Nur zu selten findet sich interessiertes Publikum im Gerichtssaal ein - und das ist jammerschade. Vor Gericht vollzieht sich das pure Leben, in allen erdenklichen Facetten: Davon berichtet Nicolas Lindt in seinem Buch.» NZZ
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Tschanun
Vor dem Prozess
Der Prozess
Epilog
Schicksale unter Anklage
Eine liebeshungrige Hexe
Kokain in Aarwangen
Das Messer
Der Kinderfotograf
Zwei Arten von Sachbeschädigung
Mitleid in Flammen
Ein Mörder
Bösartige Weiterungen
Kollision in der Einsamkeit
Eine Heldin
Schüsse auf Spreitenbach
Im Zweifel für die Lüge
Ein Raubüberfall im rechten Moment
Riccardo und Angelina
Keine Exotik mehr
Eine Charakterfrage
Die unerträgliche Leichtigkeit des Tötens
Beim Zahnarzt
Nach dem Gesetz des Mannes
Der Doppelgänger
Keine Weihnachtsgeschichte
Der Wüterich
Alkohol hilft
Bubenspiele
Ein Herr wird rabiat
Keine Erlösung vom Bösen
Gerichtstag über dem Kandertal
Bitte keine Gefühle
In Teufels Küche
Die Stichflamme
Der gute Mensch von Würenlingen
Der Herr im Haus
Ein Kind vor Gericht
Brennende Lava
Der Rocker
«Ich kann nicht anders»
Blutverschmierte Steine
I
II
III
Angaben zum Inhalt
Dank
Werke von Nicolas Lindt
Zum Autor
Tschanun
Vor dem Prozess
Als er nach Zürich kam, brachte er seinen Revolver mit. Eine Waffe im Gepäck ist wie ein guter, verlässlicher Freund, und Günther Tschanun hatte sonst keine wirklichen Freunde. Er stammte aus Wien und war in Bern Schweizer Bürger geworden. Hinter dem 43-jährigen lag eine gescheiterte Ehe und der erfolglose Versuch, als selbständiger Architekt Karriere zu machen.
Tschanun kam aus Bern, um noch einmal neu anzufangen. Er glaubte, in Zürich werfe die Sonne keine Schatten. 120ʼ000 Franken Jahressalär. Und Vorgesetzter über 40 Mitarbeiter. Man warnte ihn freundlich, er werde sehr viel Arbeit haben als Chef der Baupolizei, doch Tschanun ging darüber hinweg mit derselben eleganten Leichtfüssigkeit, die er auch beim Tanzen aufs Parkett legte. Der klassische Tanz war eine Leidenschaft des Günther Tschanun, darin glänzte er, damit gefiel er den Frauen, die es liebten, von einem österreichischen Kavalier durch den Saal gewirbelt zu werden.
Schon nach den ersten Arbeitswochen wurde ihm klar, worauf er sich eingelassen hatte. Im alten, düsteren Amtshaus herrschte nicht gerade die beste Stimmung. Zwischen dem Amtsvorsteher, Stadtrat Wanner, und seinen Untergebenen gab es Spannungen. Führungsschwäche wurde dem Stadtrat vorgeworfen – auch in Bezug auf die Baupolizei.
Tschanuns Vorgänger hatte die Stelle aus gesundheitlichen Gründen quittiert, der Stress war zu gross gewesen. Intern wurde niemand gefunden, der den Job übernehmen wollte. Niemand, so schien es, wollte Chef unter Wanner sein; keiner wollte die Folgen seiner Amtspolitik ausbaden müssen.
Nur so war es zu erklären, dass Tschanun, ein völlig Aussenstehender, die Stelle bekam. Er brachte überzeugende Referenzen mit. Unter ihnen befand sich sogar der Brief eines Berner Nationalrats, der später Bundesrat wurde. Und Wanner, der Amtsvorsteher, fand Gefallen an der gewinnenden Art des Architekten aus Wien. Er hoffte, in ihm Unterstützung zu finden.
Die Mitarbeiter der Baupolizei reagierten mit Skepsis. Tschanun war für sie einer von Wanners Gnaden und vor allem einer, der diesem Posten wohl nicht wirklich gewachsen war. Er hatte keine Erfahrung als Vorgesetzter. Er hatte sich nie speziell mit juristischen Fragen befasst. Doch genau das Juristische war in dieser Abteilung wichtig. Mehrere Hausjuristen arbeiten hauptsächlich für die Baupolizei. Von den Juristen, den Architekten und Ingenieuren in seiner Abteilung, von ihren Kenntnissen, ihrem Urteil war Tschanun völlig abhängig.
Alle wussten besser Bescheid, und nicht nur deshalb, weil sie schon länger im Amt waren. Sie kannten sich aus in der Stadt. Sie kannten die Strassen, die Häuser, die Namen, die lokalen Besonderheiten und Tricks – während er, Tschanun, in Zürich als Neuling galt.
Trotz ihrer Vorbehalte wären seine Mitarbeiter sicher bereit gewesen, ihn einzuführen. Er aber wollte nicht. Anstatt das Gespräch mit seinen Leuten zu suchen, verschanzte er sich in seinem Büro und verbiss sich in die neue, fremde Materie. Er mietete sich nur wenige Schritte vom Amtshaus entfernt eine Wohnung am Rande der Altstadt – aus ganz praktischen Gründen. Zwischen Wohnort und Büro eilte er ohne Zeitverlust hin und her, tadellos frisiert und gekleidet, das Managerköfferchen in der Hand, immer nett grüssend und immer mit dem Blick auf die Uhr.
Über Mittag verpflegte er sich meistens im gleichen Café. Er kam fast immer allein. Der Cafébesitzer begrüsste den grossgewachsenen Mann mit den Worten:
«Guten Tag, Herr Direktor!»
Tschanun nickte gönnerhaft und erwiderte: «Noch nicht!»
Er meinte es ernst. Noch war er nicht lange dabei; noch hatte er sich nicht genügend Respekt verschafft. Dies aber konnte nur eine Frage der Zeit sein. Als Architekt hatte er nicht den erhofften Erfolg gehabt; jetzt war er Chefbeamter, jetzt musste man ihn anerkennen – kraft seines Amtes. Er betonte bei jeder Gelegenheit: «Ich bin der Chef, ich entscheide!» Dabei wussten doch alle, dass er noch nicht fest angestellt war. Seine Probezeit wurde vom Stadtrat zunächst verlängert. Und als er dann endlich gewählt werden sollte, fiel die Wahl nicht einstimmig aus. Der Stadtpräsident stimmte gegen Tschanun. Doch für den neu erkorenen Chef der Baupolizei war einzig entscheidend, dass er das Steuer nun definitiv in der Hand hielt.
Hut ab, Herr Direktor! Wer zweifelte jetzt noch an seinen Fähigkeiten?
Doch sobald man von ihm etwas wollte, war seine gängige Antwort: «Keine Zeit!» Tschanuns Vorgänger hatte trotz der starken Arbeitsbelastung viel für die Mitarbeiter getan, man hatte sich jederzeit an ihn wenden können. Tschanun dagegen war viel zu sehr mit sich selber beschäftigt. Mit aller Kraft versuchte er den Anforderungen des Amtes Genüge zu tun. Es war ein intellektueller Gewaltakt. Es war der Versuch, das Unmögliche zu erzwingen, Überforderung wettzumachen durch Leistung – die typische Männerkrankheit.
Tschanun gehörte zur Risikogruppe, zu den besonders Gefährdeten. Denn erstens war er sehr ambitiös und zweitens allein. Sein Ehering war bloss noch eine vergoldete sentimentale Erinnerung. Er machte zwar diese oder jene neue Bekanntschaft – doch mehr wurde nicht daraus. Ein Verhältnis mit einer verheirateten Frau aus der Gegend von Bern stand auf tönernen Füssen. Einsamer als zuvor fand er sich jeweils in seinem Appartement wieder. Von da war der Weg ins Büro, auch am Wochenende, nicht weit.
In der Arbeit suchte der 44-jährig Gewordene seine Zuflucht. Er setzte alles daran, als Vorgesetzter Anerkennung zu finden. Peinlich vermied er es, sich eine Blösse zu geben, Fehler einzugestehen. Er wusste nicht, dass es eine Stärke ist, wenn man Schwächen zugeben kann.
Obwohl er sich krampfhaft bemühte, den Erfolgsmann zu spielen, stand hinter dem Herrn Direktor ein unsicherer Mensch, der trotz seiner akademischen Bildung unfähig war, selbstkritisch über sich nachzudenken. Er vermochte nicht zu verstehen, warum seine Frau ihn verlassen hatte, warum er keine bleibenden Freunde hatte und warum er auch im Beruf vor neuen Problemen stand. Weil ihm all das nicht begreiflich war – suchte er die Schuld bei den anderen.
Jedermann, der auch nur einigermassen gebildet ist, weiss, dass in einer schwierigen persönlichen Lage eine Drittperson vielleicht helfen kann – sei es ein Therapeut oder auch nur ein Freund, zu dem man Vertrauen hat. Doch Tschanun verstand nicht, dass er es war, der die Hilfe brauchte. Total überzeugt von sich selbst, glaubte er an seine Fassade. Und er wollte sie aufrechterhalten, verteidigen.
Um jeden Preis.
***
In der Baupolizei herrschte ein zunehmend unerträglicher Zustand. Die längst fällige Reorganisation der Abteilung verzögerte sich. Die unerledigten Baugesuche füllten schon ganze Ordner, die Ordner füllten schon mehrere Schränke, und auf dem Chefsessel sass ein Mann, der seiner Aufgabe nicht gewachsen war. Menschen, die sich permanent überfordern, gelangen zum Punkt, wo sie sich immer weiter bewegen, aber nicht mehr vom Fleck kommen. Tschanun rotierte und schuftete, doch der Aktenberg wurde nicht kleiner. Der Baupolizeichef konnte sich nur noch mit grosser Mühe auf seine Aufgaben konzentrieren. Immer häufiger kam es vor, dass er sich in Nebensächlichkeiten verlor – dass er Versprechen gab, die er nicht halten konnte – dass er das Thema eines Gesprächs verliess, sobald er es nicht mehr im Griff hatte – dass er stattdessen geistreich über die Stadtplanung von Paris referierte.
Für seine Mitarbeiter waren dies alles weitere Anzeichen, dass ihr Vorgesetzter für diesen Posten nicht der richtige Mann war. Manche wunderten sich, warum er nicht kündigte. Aber sie kannten nun seinen Ehrgeiz. Er würde bestimmt nicht freiwillig gehen. Unter den Mitarbeitern der Baupolizei entstand ein Unmut gegen den Chef. Man begann sich zu ärgern über seine Allüren. Man begann ihm auszuweichen. Man redete hinten herum über ihn.
Tschanun spürte die Ablehnung, schon bevor sie sich manifestierte. Er war sehr empfindlich. So übertrieben gewissenhaft, wie er in seine Arbeit verbissen war, registrierte er auch jede Regung seiner Umgebung. Und da er die Schuld für seine Überforderung bei den anderen suchte, begann auch er einen Argwohn gegen bestimmte Leute zu hegen. Er bekam den Verdacht, man wolle ihn abschiessen, um seinen Platz einzunehmen. Er war überzeugt davon.
Das einzige, woran er sich immer festhalten konnte, war sein Notizblock. Der Notizblock war seine Waffe und Vertrauensperson. Unaufhörlich machte er sich Notizen, pedantische Protokolle, kurze Bemerkungen zu Personen, taktische Anweisungen an sich selbst.
Da stand zum Beispiel: «Mafiöse Zustände!» Oder: «Ein ständiger Mehrfrontenkrieg.» Oder: «Tue einzelnen Leuten zu viel Ehre an, die sogar in meinem Privatleben herumschnüffeln.»
Einmal telefonierte er von Büro zu Büro mit einer Sachbearbeiterin. Es war ein lockeres Gespräch, Tschanun gab sich ungewohnt kollegial. Als er aber heraushörte, dass seine Gesprächspartnerin nicht allein war, änderte sich sein Tonfall:
«Sie sind nicht allein? Jemand hat uns zugehört? Kommen Sie sofort in mein Büro!»
Die Mitarbeiterin kam zu ihm, und Tschanun war wie verwandelt. Er machte der Frau den Vorwurf, warum sie sich ihm gegenüber einen derart lockeren Ton erlaubt habe. Die erschrockene Angestellte verteidigte sich. Er habe doch genauso mit ihr geplaudert! Und sie fügte hinzu, sie sei bis jetzt mit Vorgesetzten immer gut ausgekommen.
Tschanun fragte lauernd zurück: «Das heisst, mit mir ist das nicht der Fall? Warum nicht? Können Sie Gründe nennen?»
(Verneinende Kopfbewegung) «Das muss ich mir überlegen.»
Tschanun: «Überlegen Sie es und bedenken Sie, dass die Verantwortung für ein gutes Arbeitsklima beidseitig ist.»
Nachdem die Frau das Zimmer verlassen hatte, schrieb der Baupolizeichef den Dialog mit ihr wortwörtlich in sein Notizbuch. Er musste alles aufschreiben, was ihn beunruhigte. Jede Notiz war ein weiterer Stein in seiner Verteidigungsmauer.
Auch andere Mitarbeiter erlebten solche Überraschungen mit dem Chef. Zuerst war er aufmerksam und korrekt – plötzlich, aus scheinbar nichtigem Grund, wurde er unverhältnismässig autoritär. Viele gingen nur noch in sein Büro, wenn es sich nicht vermeiden liess. Irgendwie fanden sie kein Vertrauen zu diesem Menschen. Es war ihnen unwohl in seiner Gegenwart, ohne dass sie recht begriffen, warum.
Der Baupolizeichef wusste nicht mehr, wie weiter. Er sass festgefahren in seinem Büro, umstellt von Pflichten und Aktenstössen, er fühlte sich chronisch müde – und vor allem: im Stich gelassen von seinem König, dem Stadtrat Wanner.
Endlich sandte er ihm einen Hilferuf: «Einmal mehr muss ich die – auf Dauer – inakzeptable Arbeitsbelastung erwähnen. Bedingt durch die Ferienabwesenheit des Stellvertreters betrug meine Arbeitslast beispielsweise in der vergangenen Woche 86 Stunden.»
Ungefähr zur selben Zeit bekam Wanner auch ein Beschwerdeschreiben des Kreisarchitekten Robert Beck, der unter Tschanun nicht mehr arbeiten wollte und sich schon ernsthaft nach einer anderen Stelle umsah. Wanner gestand in seiner Antwort an Beck freimütig ein, der Zustand sei unhaltbar. Er versprach «Sofortmassnahmen», aber die Stadtratswahlen standen bevor, und Wanner wollte sich nicht die Finger verbrennen. Er überliess das schlingernde Schiff sich selbst.
Manchmal war Tschanun einfach nicht da. Er sagte niemandem, wo er hinging. Und wenn er da war, hatte man immer öfter den Eindruck, er sei innerlich völlig abwesend. Immer wieder passierte es, dass er mitten im Gespräch plötzlich fragte: «Was haben Sie eben gesagt?»
Tschanun hatte an Wichtigeres zu denken als an baupolizeiliche Dossiers: Wer ist für mich? Wer gegen mich? Wer ist besser als ich? – Das waren die Fragen, die ihn dauernd beschäftigten. Fast jeder Kreisarchitekt, jeder amtsinterne Jurist konnte sich als sein Gegner entpuppen; bei jedem musste er auf der Lauer sein – und bei einigen ganz besonders.
Eines Abends, kurz vor Arbeitsschluss, hatte Tschanun mit seinem Kreisarchitekten Robert Beck eine Besprechung. Unerwartet lud er ihn danach zu einem Glas Wein ein. Der Wein löste die Zunge, und Tschanun zeigte sich im Lauf des Gesprächs von einer anderen Seite – von einer Seite, die bei Beck ein unangenehmes Gefühl hinterliess. Als der Beamte etwas später nach Hause kam, war er beunruhigt. Beck sagte zu seiner Frau: «Der missgönnt uns unser Glück.» Und er fügte bei: «Der ist noch fähig und greift eines Tages zur Waffe.»
Irene Beck glaubte im ersten Moment, ihr Mann rede davon, Tschanun könnte Selbstmord begehen. Doch Robert Beck bat seine Frau dringend, auf keinen Fall aufzumachen, sollte Tschanun vor der Tür stehen.
Die Befürchtung des Mitarbeiters war nachvollziehbar. Tschanun erkannte nicht nur, dass Leute wie Beck besser, kompetenter waren als er. Sie waren glücklicher – das fand er am schlimmsten. In sein Notizbuch notierte er: «Amt erfordert intakte Familie.» Er aber hatte dies nicht geschafft. Und alle wussten es. Sie wussten, dass der Chef kein Familienfoto auf seinem Schreibtisch hatte. Sie wussten, dass er in Trennung lebte. Nun wollte man ihn auch noch beruflich erledigen. Ein hasserfüllter Neid nahm Besitz von ihm, ein Neid auf jene, die glücklicher waren als er, die Familienväter, die fähigen Männer in seinem Amt. Er wollte sich von ihnen nichts mehr gefallen lassen.
Dann geschah, was sich viele im Amt von den städtischen Wahlen erhofft hatten: Stadtrat Wanner wurde nicht mehr gewählt. An seine Stelle trat Monika Koch. Bis die neue Magistratin ihr Amt begann, verging indessen noch einige Zeit. In diesen Wochen der Unsicherheit verdüsterte sich der Himmel über der Baupolizei. Zwar sah es zunächst danach aus, als würde endlich etwas geschehen. Eine Arbeitsgruppe Reorganisation wurde eingesetzt. Mitglieder waren Tschanun, Kreisarchitekt Rolf Ritschard, Jurist Reto Zanni und ein Reorganisationsberater der Firma Hayek, weshalb das Gremium auch «Arbeitsgruppe Hayek» genannt wurde. Nach jeder Sitzung versprach Tschanun, er werde sich auf das nächste Mal vorbereiten. Doch er hielt sein Versprechen jedesmal nicht und erschwerte damit die Arbeit der Gruppe.
Rolf Ritschard machte das Angebot, den Chef vorübergehend partiell zu entlasten. Doch bei der nächsten Zusammenkunft hatte Tschanun sich wieder nicht vorbereitet. Ritschard, der sechs Jahre älter war als sein Vorgesetzter, verlor die Geduld. Er erzählte seinem Kollegen Beck von der neuesten Entwicklung, und gemeinsam entschlossen sie sich zu einer Beschwerde gegen Tschanun – in der Hoffnung, die neue Stadträtin werde handeln. Auch Reto Zanni und ein weiterer Baujurist, Hanskaspar Landolt, wurden über das Vorhaben informiert.
Der Brief war noch nicht geschrieben, als in der Gratiszeitung «Züri Woche» ein Artikel erschien, der wie eine brennende Zündschnur durch die Korridore und Büros des Amtshauses züngelte. Die Überschrift lautete:
Wer wird von der Köchin zuerst in die Pfanne gehauen?
Aus dem Artikel ging unmissverständlich hervor, dass der Chef der Baupolizei in seinem Amt überfordert war und die neue Stadträtin hoffentlich den Mut haben werde, für seine Abwahl zu sorgen. Der Bericht, geschrieben vom Journalisten Adalbert Leu, war ein Schuss aus dem Hinterhalt. Ungenannte «böse Zungen» hatten die Munition geliefert. Der Schuss traf ins Schwarze, doch enthielt er mehrere Unrichtigkeiten – was in der angespannten Situation verhängnisvoll war.
Robert Beck las den Bericht als erster und ärgerte sich darüber, dass die Zeitung so unsachlich vorgeprellt war. Er erkundigte sich bei seinen Kollegen, wer von ihnen der Informant war – doch niemand schien es gewesen zu sein. Beck und Ritschard entschlossen sich noch am gleichen Tag, ihre Beschwerde endlich weiterzuleiten. Man durfte nicht länger zuwarten.
Das giftgelbe Flämmchen der Zündschnur frass sich fort bis in Tschanuns Büro und führte dort zur erwarteten Detonation. Alles, woran sich Günther Tschanun noch geklammert hatte, stürzte ein. Mit seiner Karriere war es vorbei, das wusste er nun. Weder in der Baupolizei noch auf einem anderen Chefposten der Verwaltung hatte er eine Zukunft. Verzweiflung packte ihn – und eine höhnische Erbitterung. Er wusste genau, wer die Schützen waren.
Doch dann hörte er die Vermutung, der Stadtpräsident höchstpersönlich – Christoph Honegger – habe das Wochenblatt informiert. Tschanun war wie vor den Kopf geschlagen. Seine Gedanken irrten ziellos im Kreis herum. Er schwankte zwischen Abgründen der Ausweglosigkeit und Überlegungen, wie er sich verteidigen könnte. Schliesslich verfasste er ein Rechtfertigungsschreiben an Honegger. Er schilderte dem Stadtpräsidenten seine dauernde Überlastung, nannte die Zahl von 660 Überstunden in einem Jahr, gab sogar zu, er sei krank geworden vor lauter Stress, suchte Verständnis und Hilfe.
Das nun folgende Wochenende war das einsamste und niederdrückendste im Leben des Günther Tschanun. In seinem Hirn muss es unaufhörlich, maschinenhaft gearbeitet haben. Er spielte alle Varianten, alle möglichen Auswege durch, er dachte an Klage, Kündigung, Flucht, an Selbstmord sogar – und er dachte an Rache. Unaufhaltsam brachen die Hassgefühle aus ihm hervor, der tiefsitzende Hass auf die Glücklichen.
Als ihm der Stadtpräsident überraschend telefonierte, konnte sich Tschanun ein wenig beruhigen. Honegger versicherte ihm, der Informant sei nicht er gewesen; und er kam mit Tschanun überein, man werde am Montag gemeinsam eine Stellungnahme für die «Züri Woche» verfassen.
Das geschah dann auch. Tschanun sah wieder eine Chance für sich. Es tat ihm gut, dass sich der Stadtpräsident von Zürich hinter ihn stellte. Doch unter der wieder einsetzenden Normalität brannte unverändert schmerzhaft die erlittene öffentliche Demütigung, brannte die Angst vor den Folgen – brannte noch immer die Frage nach den bösen, übelwollenden Zungen: Wer hatte das Gratisblatt informiert?
Am Dienstagmorgen eine weitere Sitzung der Arbeitsgruppe Reorganisation: Tschanun wieder nicht vorbereitet – heftige Wortgefechte mit Ritschard und Zanni. An der Sitzung nahm zum ersten Mal auch der Stabschef des Bauamtes II, Martin Zollinger, teil. Zollinger sagte gleich zu Beginn, er sei bloss als Zuhörer hier, um sich vom Stand der Arbeit ein Bild zu machen.
Doch Tschanun dachte nur: Warum kommt er gerade heute? Und warum hilft er mir nicht? – Alles, was jetzt noch geschah und geäussert wurde, war Öl in das Feuer. Der Brand im Innern des Mannes war nicht mehr zu stoppen, die Flammen seiner Verbitterung suchten bloss noch letzte Beweise. Sie brauchten nicht lange zu suchen.
Am späteren Dienstagnachmittag erfuhr Tschanun vom Beschwerdebrief seiner Mitarbeiter Ritschard und Beck. Das Schreiben mündete in sechs Punkte: 1. der Chef Baupolizei erfüllt seine Aufgaben nicht, 2. der Chef Baupolizei besitzt keine Führungsqualitäten, 3. durch ihn werden unnötige Kosten und Zeitaufwände verursacht, 4. er belastet durch sein Verhalten die Untergebenen, 5. Er hält Versprechungen nicht, 6. er ist nicht ehrlich.
Der Brief endete mit den Worten: «Beim Personal der Baupolizei besteht der Eindruck, dass der Chef volle Narrenfreiheit geniesse. Es müssen nun endlich Schritte geschehen, ihn zu ersetzen oder zu disziplinieren.»
Als jemand kurz vor Büroschluss mit Tschanun eine Besprechung für den nächsten Tag vereinbaren wollte, erhielt er vom Chef eine Absage.
«Man wird dann schon sehen, warum», bemerkte Tschanun. Er sagte es wörtlich so.
Das Feuer loderte. Eine lange und furchtbare Nacht hielt Gericht, kämpfte mit immer wiederkehrenden Zweifeln – und beseitigte sie.
***
Am frühen Mittwochmorgen – es war der 16. April 1986 – räumte Tschanun sein Appartment säuberlich auf und schrieb eine letzte Verfügung, in welcher er seinen ganzen Besitz zum Teil seiner Freundin und zum anderen Teil seiner Frau vermachte, von der er noch nicht geschieden war. Hierauf begab er sich – in aller Frühe – ins Amtshaus, um in Ruhe seine Papiere zu ordnen und einiges mitzunehmen. An seinen Stellvertreter, einer der wenigen, von denen er sich Verständnis erhoffte, verfasste er einen Abschiedsbrief.
Nach einer kurzen Rückkehr in seine Wohnung gleich um die Ecke verliess er diese erneut, in der Hand seinen Aktenkoffer, in welchem sich seine Pistole befand. Die Patronen steckte er in die Aussentasche seines dunkelblauen Anzugs, zu dem er ein hellblaues Hemd mit Krawatte trug. Wie jeden Morgen begab er sich in sein Stammcafé, bestellte dort seinen Kaffee und blätterte in der Zeitung, obwohl er vermutlich von ihrem Inhalt nichts mitbekam. Sein ganzer Denkapparat befand sich in höchster Aufruhr. Immer und immer wieder von vorn.
Zwischen den Häusern trat die Sonne hervor, ein schöner Frühlingstag nahm seinen Anfang. Doch der Baupolizeichef sah den sonnigen Morgen nicht, als er aus dem Café trat. Er suchte wieder sein Büro auf, verliess dieses aber nochmals, um seinen Wagen – der in der Nähe parkiert war – direkt vor einen Seitenausgang zu stellen. Er kehrte ins Gebäude zurück und begab sich von neuem in sein Büro, wo kurz vor 8 Uhr für die Besprechung des Tages wie üblich sein Stellvertreter erschien.
Heute sei die Besprechung nicht nötig, sagte Tschanun zu ihm.
Etwas später sprach der Kanzleisekretär bei ihm vor, um mit dem Chef zusammen die tägliche Post zu bearbeiten. Darauf erklärte Tschanun dem Beamten wörtlich, es sei etwas passiert. Er habe den Posteingang noch nicht durchsehen können.
Der verwunderte Sekretär anerbot Tschanun, die Post am Nachmittag zu erledigen, und der Baupolizeichef war damit einverstanden, worauf sich der Mitarbeiter zurückzog. Doch kaum stand er wieder in seinem Büro, trat Tschanun bei ihm ein und liess den Beamten wissen, dass es «keine belastenden Akten» über ihn gebe. Der Kanzleisekretär fragte Tschanun darauf irritiert, wie er das meine, doch dieser erklärte nur: «Das brauchen Sie nicht zu verstehen.»
Um 8.30 Uhr wurde Tschanun von einem zufällig anwesenden Techniker im Kopierraum gesehen. Der Chefbeamte habe nur unverständlich gemurmelt, gab der Techniker später zu Protokoll. Etwas gesagt habe er nicht.
Unmittelbar danach verliess Tschanun den Kopierraum und trat – auf der gleichen Etage – in das Büro des Kreisarchitekten Rolf Ritschard, der sich gerade mit einem Besucher in einer Besprechung befand. Ohne sich um den Besucher zu kümmern, ging Tschanun auf den Kreisarchitekten zu, zog wortlos seinen Revolver und schoss ihm direkt in den Kopf, verliess das Büro – die Waffe auf den Besucher gerichtet –, zog die Tür hinter sich zu, begab sich dann ins Nachbarbüro, erschoss auf die gleiche Weise den Kreisarchitekten Robert Beck, wechselte mit dem Lift hinauf in den vierten Stock, erschoss den Juristen Reto Zanni, erschoss den Juristen Hanskaspar Landolt, machte die Tür auch diesmal wieder hinter sich zu, lud in der Halle draussen die Waffe nach – und eilte ohne übertriebene Hast weiter zu Martin Zollinger, dem Stabschef, der durch seine doppelt verschalte Tür von den Schüssen überhaupt nichts vernommen hatte und sein Büro gerade durch einen Vorraum verlassen wollte.
Im gleichen Moment erschien auch ein anderer Mitarbeiter im Vorraum. Tschanun stiess den Mann zur Seite und sagte zu Martin Zollinger, ohne jedes Anzeichen von Erregung:
«Ich habe es mir lange überlegt. Es geht nicht anders.»
Dann zog er die Waffe und drückte ab. Der 57-jährige Zollinger spürte, dass er getroffen war, doch er flüchtete an Tschanun vorbei in die Halle hinaus. Der Baupolizeichef schoss hinter ihm her und traf ihn ein zweites Mal. Zollinger flüchtete weiter die Treppe hinunter. Tschanun stand oben und feuerte noch einmal auf den Flüchtenden. Zollinger suchte mit letzter zäher Kraft im nächstgelegenen Büro Hilfe. Dann brach er zusammen – in der Schulter, im Bauch, in der Lunge getroffen, lebensgefährlich verletzt.
Der Täter jedoch nutzte das nach den Schüssen entstehende Chaos, begab sich zurück zum Lift, der noch immer bereitstand, fuhr damit wieder nach unten – und verliess das Gebäude durch jenen Ausgang, wo sein Auto parkiert war. Niemand verfolgte ihn, weil niemand, wirklich niemand in einem Amtshaus so etwas erwartet hatte. Tschanun konnte ungestört in sein Auto steigen und flüchten. Alles verlief wie geplant. Diesmal konnte niemand behaupten, er habe versagt. Tschanun hatte es allen gezeigt.
Er startete den Motor und fuhr los. Doch schon nach wenigen Metern – so beschrieb er seine Flucht später in den ersten Verhören – stoppte er wieder. Der Flüchtende überlegte sich, dass sein Wagen, der noch immer Berner Kontrollschilder trug, zu sehr auffiel. Kurzentschlossen ergriff er den Aktenkoffer, verliess den Wagen und ging zu Fuss weiter – kehrte aber noch einmal zurück und holte aus dem Auto den Regenmantel. Dann begab er sich auf Nebenstrassen zum Hauptbahnhof.
Diesen betrat er durch die Passage, die am hinteren Ende des Bahnhofs liegt. Den Haupteingang wollte er nicht riskieren, und eine Fahrkarte wollte er auch nicht lösen. Er suchte den erstbesten Zug heraus, eine Verbindung nach Baden, stieg ein und kaufte das Billett beim Kondukteur. In Baden hob er am Bancomat die maximal mögliche Summe ab – 1ʼ000 Franken – und erkundigte sich bei einer Garage nach Möglichkeiten, ein Auto zu mieten. Dann änderte er seine Absicht und löste stattdessen ein Bahnbillett von Baden nach Burgdorf.
In Olten, wo er umsteigen musste, nahm er indessen den Zug nach Basel, kaufte sich dort am Kiosk eine Karte von Frankreich, überschritt problemlos den Zoll und fuhr mit der Bahn bis Mulhouse. Von dort setzte er seine Reise nach Besançon fort und bestieg, nachdem er in einem Restaurant zu Mittag gegessen hatte, einen Zug nach Dijon. Seine Flucht endete vorerst im burgundischen Beaune, wo er im kleinen «Hotel de la Bretonnière» abstieg.
Niemand hatte sich ihm in den Weg gestellt. Niemand, der ihm begegnete, hätte für möglich gehalten, was der gutgekleidete Herr am Morgen des gleichen Tages getan hatte. Tschanun durfte sich in Sicherheit wähnen. In Zürich hatte die Polizei vom Verbleib des Geflüchteten keine Ahnung. Seine Spur verlor sich dort, wo sein Auto stand. Weil er ein Testament hinterlassen hatte, konnte es sein, dass er gar nicht mehr lebte. In den Wäldern am Stadtrand und sogar in der Limmat suchte man deshalb nach seiner Leiche. Ebenso denkbar war aber auch, dass er sich noch in der Nähe befand und auf weitere Rache sann. Sowohl der Stadtpräsident wie auch der Journalist Adalbert Leu erhielten präventiv Polizeischutz.
5 Tage lang ging die Polizei allen Hinweisen aus der Bevölkerung nach, überprüfte sämtliche Orte, wo sich der Flüchtige hätte versteckt halten können und schrieb ihn auch im Ausland zur Fahndung aus – ohne Erfolg.
Währenddessen hielt sich Günther Tschanun im Burgund auf. Zunächst war er in Beaune geblieben, im «Bretonnière», doch nach drei Nächten, als er gebeten wurde, für neue Gäste das Zimmer zu wechseln, fand eine Mitarbeiterin des Hotels, die seine Sachen ins andere Zimmer räumte, unter dem Kopfkissen seinen Revolver.
Sie sprach den Hotelgast, der gerade beim Frühstück sass, etwas unsicher auf die Waffe an, worauf Tschanun gesagt haben soll, er sei ein «homme bien». Mehr liess sein dürftiges Französisch nicht zu, doch die Frau vom Hotel fand seine Antwort durchaus beruhigend. Ausserdem gab der Herr mit den guten Umgangsformen grosszügig Trinkgeld. Einen solchen Gast bewirtet man gern.
Tschanun hielt es dennoch für klüger, zu bezahlen und abzureisen. Er traf noch am gleichen Tag im elf Kilometer entfernten Dörfchen St. Loup de la Salle ein. Er hatte den Ort auf einer Reise durch das Burgund schon im Vorjahr besucht, und so nahm er auch diesmal ein Zimmer in der Pension «La Terrasse». Den Wirtsleuten gab er an, eine Autopanne erlitten zu haben. Sein Auto befinde sich in Beaune zur Reparatur.
Fünf Tage und Nächte blieb er in der Pension, ging spazieren – noch immer im gleichen dezent blauen Anzug wie am Tag seiner Tat –, begab sich zum Essen ins Dorfrestaurant und besuchte am Sonntag sogar die Kirche. Er zeigte auch hier wieder seine guten Manieren, doch im Unterschied zum vorigen Jahr wirkte er eher wortkarg. Hinzu kam, dass er diesmal allein war. Er zog sich oft auf sein Zimmer zurück, und er hatte auf einmal Zeit – soviel Zeit wie schon lange nicht mehr. Massenhaft Zeit zum Nachdenken.
Er hätte sich jederzeit stellen können.
Am sechsten Tag seiner Flucht, während er bereits im «La Terrasse» logierte, wurde bankintern festgestellt, dass der Gesuchte vierzig Minuten nach seiner Tat an einem Bancomat in Baden 1ʼ000 Franken bezogen hatte. Dieser erste Hinweis verstärkte die Vermutung der Polizei, dass der Täter noch lebte. Doch weiter als Baden reichte die Fährte nicht, und es vergingen wieder drei Tage ohne neue Erkenntnisse.
Am achten Tag nach der Tat fand in der Zürcher Fraumünsterkirche der Trauergottesdienst für die vier Männer statt, deren Leben der Baupolizeichef ausgelöscht hatte. Vor 1ʼ000 anwesenden Trauergästen, unter ihnen auch die Familien der Opfer, bezeichnete Stadtpräsident Christoph Honegger die von Tschanun Getöteten als «stets zuverlässige, engagierte Beamte» und sprach von einem «hinterhältigen, grausamen Verbrechen». Am Rande der Trauerfeier wurde bekannt, dass sich das fünfte Opfer, Martin Zollinger, noch immer im Koma befinde. Sein Zustand, hiess es, sei kritisch.
Am zehnten Tag nach den tödlichen Schüssen im Zürcher Amtshaus wurde die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf ein anderes Geschehnis gelenkt: Im ukrainischen Tschernobyl ereignete sich am 26. April jener Reaktorunfall, dessen Auswirkungen danach ganz Europa betrafen. Die radioaktive Katastrophe verdrängte vorübergehend die Schlagzeilen um die Flucht von Tschanun.
Am zwölften Tag nach der Tat hingen in sämtlichen Polizeiposten in der Schweiz Fahndungsplakate des Flüchtigen, und für Hinweise aus der Bevölkerung wurden bis zu 10ʼ000 Franken Belohnung versprochen. Doch Tschanun blieb verschwunden. Weitere Tage verstrichen ergebnislos – bis am 30. April eine Berner Bekannte Tschanuns einen Brief des Gesuchten erhielt: Abgestempelt am 25. April in Beaune, Frankreich.
In diesem Brief deutete der Verschwundene seiner Bekannten an, er werde sich umbringen. Die Briefempfängerin leitete das Lebenszeichen des Täters an die Behörden weiter und fügte hinzu, Günther Tschanun habe sich schon mehrere Male im Burgund aufgehalten. Er werde bestimmt dort zu finden sein.
Ihre Vermutung täuschte sie nicht. Tschanun befand sich noch immer in der Gegend von Beaune. Am Tag, als man in Zürich der Opfer gedachte, hatte er die Pension «La Terrasse» verlassen. Der Wirtin erklärte er, sein Auto sei jetzt geflickt, er könne es abholen. Noch am gleichen oder am nächsten Tag warf er in Beaune den Brief an seine Berner Bekannte ein. Doch den Freitod, den er darin erwähnte, beging er nicht, denn wieder einige Tage später tauchte er in Meloisey auf, das ebenfalls in der Nähe liegt, und nahm ein Zimmer im kleinen «Hotel-Restaurant de la Renaissance».
Er erzählte der Wirtefamilie auch hier, sein Auto werde in Beaune repariert. Solange müsse er bleiben. Als der Wagen nach einigen Tagen immer noch in Reparatur war, fand dies der Wirt etwas seltsam, doch der Gast aus der Schweiz zerstreute jeglichen Argwohn mit seiner freundlichen Art. Tagsüber war er meist unterwegs – immer zu Fuss –, doch abends setzte er sich in die Gaststube, bestellte Burgunderschnecken, trank dazu gern ein Glas Wein, lobte die gute Küche und machte beim Pfeilwerfen auf eine Zielscheibe mit.
Meistens gewann er. Tschanun traf auch diesmal – wie schon in Zürich zwei Wochen vorher. Fünf Schuss enthielt das Magazin seiner Waffe. In jener schrecklichen Stunde, während er von Büro zu Büro, von Exekution zu Exekution schritt, hatte er nur einmal nachladen müssen. 8 Kugeln hatten genügt, um an 5 Menschen blutige Rache zu üben.
Trotz burgundischer Küche und Gastfreundschaft kam der Baupolizeichef auch in Meloisey nicht von seiner Tat los. Mit der Wirtin, die Englisch konnte wie er, unterhielt er sich einige Male, und die Frau spürte, dass ihn etwas bedrückte. Seine Scheidung stehe bevor, erklärte er ihr, und beruflich habe er auch Probleme. Einmal – erinnerte sich die Wirtin – sagte er zu ihr:
«Man arbeitet hart, Jahr für Jahr, baut etwas auf, will etwas erreichen. Und dann kommen andere und machen einen kaputt.»
Über den 1. Mai hinaus blieb Tschanun im «Hotel de la Renaissance». Unterdessen hatte die Zürcher Kantonspolizei direkten Kontakt mit der Polizei im Burgund aufgenommen. Den Kollegen in Frankreich wurde erst jetzt die Schwere des Falles klar. Sie begannen Tschanun in Beaune und Umgebung endlich zu suchen – allerdings immer noch nicht systematisch.
Am 19. Tag seiner Flucht, als Tschanun das Hotel gerade verlassen wollte, gewahrte er vor dem Eingang ein paar Soldaten. Wie die Wirtin später der Presse erzählte, zog er sich hastig ins Haus zurück. Das kam ihr verdächtig vor; und weil sie dem undurchschaubaren Gast im Grunde nicht traute, telefonierte sie der Gendarmerie. Als Tschanun das Hotel wenig später erneut verliess und im gleichen Moment zwei Beamte erschienen, beschleunigte er seine Schritte und eilte davon. Die Polizisten holten ihn ein, kontrollierten den Mann – und liessen sich von ihm überzeugen, dass er nicht habe flüchten wollen. Sein überstürztes Davongehen begründete er mit akuten familiären Problemen. Die Polizisten gaben sich damit zufrieden und zogen ab. Das Fahndungsbild des Flüchtigen war noch nicht bis zu ihnen gedrungen.
Die Wirtin entschuldigte sich darauf bei Tschanun für den falschen Verdacht, doch der Gast aus der Schweiz wollte so oder so nicht mehr bleiben. Noch am gleichen Tag löste Tschanun in Beaune einen Euroscheck ein und bezahlte damit im «Renaissance» seine Rechnung. Er verabschiedete sich am folgenden Morgen und kehrte dem Dorf den Rücken. Es war der 20. Tag seiner Flucht, ein Dienstag, und er hätte sich immer noch stellen können.
Am gleichen Dienstag trafen aus Zürich zwei Polizeibeamte in Beaune ein. Sie waren ausgeschickt worden, um die Fahndung nach dem Täter zu unterstützen, und brachten Hotelprospekte aus dem Burgund mit, die – neben anderen Ferienprospekten – in der Wohnung Tschanuns gelegen hatten. In Zweiergruppen wurde ein Hotel nach dem andern rund um Beaune aufgesucht. Bis in den Abend hinein wurde die Suche verlängert – ohne Erfolg. Doch die Schlinge zog sich zusammen.
Am Mittwochmorgen, fast auf die Stunde genau drei Wochen nach den tödlichen Schüssen im Zürcher Amtshaus , sprechen zwei französische Polizisten in der Pension «La Terrasse» in St. Loup de la salle vor. Als sie der Wirtin das Fahndungsfoto Tschanuns zeigen, deutet die Frau wortlos in den oberen Stock. Die beiden Beamten fordern Verstärkung an, dann begeben sie sich leise nach oben. Vor der ersten Tür bleiben sie stehen, als sie dahinter Geräusche hören. Sie öffnen die Tür – und vor ihnen, mitten im Zimmer, steht der Gesuchte.
Er war am Vorabend ins «La Terrasse» zurückgekehrt, erschöpft und apathisch, wie man später nachlesen konnte. Noch immer trug er den blauen Anzug, in der Hand seinen Koffer, am Arm seinen Regenmantel. Er mochte kaum etwas essen und liess sogar sein Glas Wein stehen. Seine Brieftasche enthielt noch 57 französische Francs. Mehr hatte er nicht mehr.
Die Beamten müssen mit Widerstand rechnen, ihre Waffen sind schussbereit – doch Tschanun steht mit leeren Händen vor ihnen. Ob er sie kommen sah oder nicht, spielt keine Rolle. Der Geflüchtete ist am Ende. Dass er es schaffte, seinen Verfolgern drei Wochen lang zu entkommen, gibt ihm keine Genugtuung mehr. Wie selbstverständlich lässt er sich festnehmen. Als er, begleitet von den Beamten, die Treppe herunterkommt, hat die Wirtin den Eindruck, ihr Gast sei erleichtert und geradezu froh, endlich kapitulieren zu dürfen.
***
Das Bild von Tschanun, das die Öffentlichkeit nach seiner Verhaftung erhielt, zeigte keinen gefühlskalten Menschen, der vier, beinahe fünf Menschen umgebracht hat. Als er abgeführt wurde, sah man «Tränen in seinen Augen», wie die Zeitungen zu berichten wussten. «Doch er bewahrte Haltung. Auch in Handschellen. Er dankte der Wirtin für die nette Bedienung und entschuldigte sich für die Umstände.»
Sein französischer Anwalt war von ihm «tief beeindruckt». «Tschanun ist ein Mann von grosser Sensibilität», lobte er seinen Mandanten.