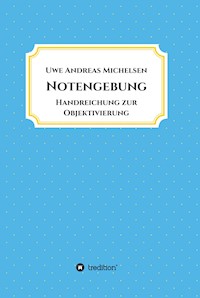2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In Publikationen zur Geschichte der Berufserziehung wird für den Beginn des zünftlerischen Denkens und Handelns frühestens das 12. Jahrhundert n. Chr. festgelegt. Ungeachtet dessen finden sich Vorläufer zünftlerischen Denkens und Handelns bereits in der Antike, insbesondere zeigen dies die hier vorgestellten Beispiele Babyloniens und Judäas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 55
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
© 2017 Uwe Andreas Michelsen
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN Taschenbuch: 978-3-7439-2076-7
ISBN Hardcover: 978-3-7439-2077-4
ISBN e-Book: 978-3-7439-2078-1
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Vorformen zünftlerischen Denkens und Handelns in der Antike
Insbesondere in Babylonien und Judäa
Inhalt
1 Berufsausbildung in Babylon
2 Berufsausbildung in Judäa
2.1 Die göttliche Abkunft allen beruflichen Tuns
2.2 Die ständische Gliederung der Gesellschaft
2.3 Die Bedeutung der Familie als Trägerin der beruflichen Erziehung
2.4 Die zunftartige Gliederung in Berufsgenossenschaften
3 Handwerkstypische Ausbildungsformen in den Zünften
3.1 Die sozio-ökonomischen Bedingungen
3.2 Die göttliche Abkunft allen beruflichen Tuns
3.3 Die ständische Gliederung der Gesellschaft
3.4 Das Zunftwesen
3.5 Die Bedeutung der Familie als Trägerin der beruflichen Erziehung
Literatur
Uwe Andreas Michelsen
Vorformen zünftlerischen Denkens und Handelns in der Antike, insbesondere in Babylonien und Judäa
Überlieferung und Erziehung sind Korrelatphänomene; keine Überlieferung wird ohne jede Einwirkung auf gegenwärtige Erziehungsbemühungen bleiben. “Die Geschichte der Erziehung in der Antike ist für unsere moderne Kultur nicht gleichgültig; sie führt die unmittelbaren Ursprünge unserer eigenen erzieherischen Tradition vor Augen” (Marrou 1977, S. 16). Sie behandelt das Vergangene - die Vergangenheit des Gegenwärtigen. Aus heutiger Sicht bewundernswert sind die technischen Bauwerke und Konstruktionen der Antike. Dieselben weisen auf ein hohes technisches und damit auch handwerkliches Können, somit auch auf eine spezielle Ausbildung der in Handwerksberufen Tätigen. Einige grundlegende Schriften, die ausschließlich technische Fragen der Antike zum Inhalt haben, sind die Werke des Heron von Alexandria [er lebte im oder nach dem 1. Jhd. n. Chr.], Vitruvs [ ca. 75 - 15 v. Chr.] Bücher über De architectura a libri decem und Frontius’ [ca. 35 v. Chr. - 103 n. Chr.] Buch über die Wasserversorgung der Stadt Rom. Plinius der Ältere [23 - 79 n. Chr.] geht in seinem enzyklopädischen Werk Naturalis historia ... ebenfalls auf technische Fragestellungen ein. Wichtige Quellen zur Landwirtschafts- und Lebensmitteltechnik sind die Werke De re agricultura Catos des Älteren [243 - 149 v. Chr.] und Columellas [4 - 70 n. Chr.] zweibändiges Werk De re rustica ( vgl. Cech 2012, S.12). Vieles, was heute problematisch ist, wurzelt in dem Erbe älterer Generationen. Insofern kann die rechte Erkenntnis der Vergangenheit als Schlüssel zum Verständnis der Gegenwart dienen und dem Gewordenen dort gerecht werden, wo es noch heute anzutreffen ist. Mit den nachfolgenden Ausführungen werden bestimmte Strukturähnlichkeiten und Merkmalkonkordanzen des mittelalterlichen zünftigen Denkens und Handelns mit Vorformen in der Antike aufgezeigt; sie ersetzen keine Geschichte der Berufserziehung. Hierzu sei auf die umfänglichen und wegweisenden Studien von Stratmann und Zabeck verwiesen. Als spezifische Ausprägung unserer handwerkstypischen Ausbildungsformen gilt das mittelalterliche Zunftwesen. Es hat, so typisch es für die Berufsausbildung war und in seinen Nachwirkungen zum Teil noch heute ist, seinerseits historische Wegbereiter. Beispielhaft sei hier an früheste Formen der Berufsausbildung in Babylonien und in Judäa erinnert.
1 Berufsausbildung in Babylon
Bereits um 1700 v. Chr. gab es in Babylonien ein nach König Hammurabi 1 benanntes Gesetzeswerk, das in 280 Paragraphen nicht nur das gesamte Straf-, Zivil- und Handelsrecht umfasste, sondern auch eine Rechtsgrundlage für die Berufsausbil- dung - eine Art “Berufsbildungsgesetz” - darstellte 2.
Wie im Berufsbildungsgesetz unserer Tage finden sich in der Gesetzesstele Hammurabis Vorschriften über den Abschluss und die Unterzeichnung von Lehrverträgen; auch waren die Ausbildungszeiten für freie und unfreie Lehrlinge genau festgelegt, wie überhaupt die Abfassung von Arbeitsverträgen eine erstaunlich große Rolle im altbabylonischen Recht spielte. So heißt es im § 274 der Gesetzesstele Hammurabis:
“Wenn ein Bürger einen zünftigen [Hervorhebung vom Verfasser] Handwerker jeweils mietet, so [gi] 3 bt er als Miete eines [...] 5 Gran Silber,
als Miete eines Ziegelstreichers 5 (?) [ Gran Sil ] ber,
als M [ iete eines Leinenw ] ebers (?) [ Gran ] Silber,
[ als Miete eines Siegelschn ] eiders (?) [ Gran Silber],
[ als Miete eines Juwe ] liers (?) [ Gran Si ] lber,
[ als Miete eines Schm ] iedes (?) [ Gran Si ] lber,
[ als Miete eines ] Tischlers 4 (?) Gran Silber,
als Mieter eines Lederarbeiters [ ... ] Gran Silber,
als Mieter eines Rohrarbeiters [ ... ] Gran Silber,
als Miete eines Baumeisters [ ... ] Gran Silber [ an ] 1 [ Tage ]” (Eilers 1932, S.52f.).
Tagelöhnern wurde weitaus weniger bezahlt. Sie erhielten nur ungefähr 1/50 eines Sekels, dem ein Wert von 8 g Silber entsprach, also 0,16 g Silber. Der Warenaustausch erfolgte durchweg auf der Grundlage der Silberwährung. Abgaben konnten auch in Naturalien geleistet werden. 1 Gur (d.h. 120 l) Getreide oder Datteln entsprach dabei einem Sekel. Münzen waren noch unbekannt (vgl. Schmökel 1958, S. 18 und 20).
Die gesetzliche Verankerung solcher Arbeitsverträge weist dem Handwerk in Babylonien eine besondere Bedeutung zu. Es wurde hoch geachtet, galt geradezu als eine göttliche Einrichtung, und war, ähnlich wie im Mittelalter, in Gilden bzw. Zünften organisiert (vgl. Historia Mundi 1953, S. 315). Wir dürfen davon ausgehen, dass die straffe Organisation dieser “Zünfte” und ihre planmäßige Einordnung in das Wirtschaftsleben als eine wichtige Regierungsaufgabe betrachtet wurde (vgl. Schmökel 1958, S.18).
Die gesellschaftliche Struktur Babyloniens lässt sich aus den verfügbaren Quellen nicht genau feststellen. Von einer Adelsschicht in der uns geläufigen Auffassung kann wohl nicht die Rede sein. Die Höhe der sozialen Stellung eines jeden richtete sich jedenfalls nicht nur nach seiner Herkunft, sondern in hohem Maße nach seiner beruflichen Stellung (vgl. Historia Mundi 1953, S. 315).
Der Beruf des Vaters entschied letztlich über den sozialen Status seiner Nachkommen; denn die Tradierung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten geschah meist innerhalb der Familie (vgl. Schmökel 1958, S. 18). Für Ausnahmefälle - etwa wenn kein leiblicher Nachkomme vorhanden war - ermöglichten die §§ 188 und 189 der Gesetzesstele Hammurabis die Adoption:
“ § 188: Wenn ein Gildenhandwerker einen Sohn als Ziehkind angenommen hat und ihm sein Hand-werk beibringt, so kann dies nicht vindiziert werden; § 189: Wenn er ihm nicht sein Handwerk beibringt, so kann dieses Ziehkind ins Haus seines Vaters zurückkehren” (Eilers 1932, S. 44f.).
Somit können wir an der Berufsausbildung Altbabyloniens bereits typische Ausprägungen dessen erkennen, was uns später, bei der Betrachtung des mittelalterlichen Zunftwesens, erneut und in noch deutlicherer Konturierung begegnen wird:
1. Die göttliche Abkunft allen beruflichen Tuns, die als früher Vorläufer des als Vocatio, gleichsam als ein Aufruf Gottes, erlebten Berufsverständnisses des Mittelalters angesehen werden kann,
2. die ständische Gliederung der Gesellschaft, zu deren Fortbestehen,
3. die zunftartige Gliederung in Berufsgenossenschaften beiträgt, und schließlich
4. die außerordentliche Bedeutung der Familie als Trägerin der beruflichen Erziehung.