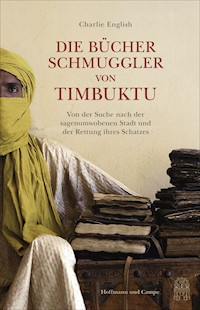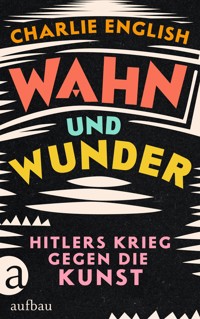
18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hitler, Psychiatriepatient:innen und die moderne Kunst: Ein unerzähltes Kapitel deutscher Geschichte
An einem klaren Wintertag des Jahres 1898 springt Franz Karl Bühler in einen Hamburger Kanal, um seinen inneren Dämonen zu entfliehen. Doch er wird gerettet und geht in die Geschichte ein: Als mit Schizophrenie diagnostizierter Maler der Sammlung Prinzhorn, einer Sammlung von Werken, die in Psychiatrien entstehen und eine neue Generation von Künstlern, darunter Paul Klee, Max Ernst und Salvador Dalí, zu ihren größten Werken inspirieren. Bald nach seiner Machtergreifung jedoch erklärt Hitler – der sich selbst für einen verkannten Künstler hält– der modernen Kunst den Krieg. Die Nazis veranstalten riesige Ausstellungen "Entarteter Kunst“ und beschlagnahmen und zerstören die besten Sammlungen in Deutschland. Für Hitler zeigen sowohl psychisch Kranke wie Bühler als auch die moderne Kunst die »Entartung« der Gesellschaft – und er beginnt mit ihrer beider systematischen Vernichtung, die zu seinem ersten Massenmordprogramm führt, der Aktion T4. Charlie English erzählt an erstaunlichen Lebensgeschichten entlang packend vom Wahnsinn der Zeit, der außerhalb der Klinikmauern um einiges größer ist als innerhalb und schreibt gleichzeitig ein Kapitel Kunstgeschichte neu.
»Eine großartig erzählte Geschichte, in der Welten aufeinanderprallen ... Es gibt so viel Wunderbares an diesem Buch, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, es zu loben. Es ist abwechselnd fesselnd, tragisch, erschreckend und lustig.«The Times
»English hat ein großartiges Buch geschrieben, spannend und thematisch mitreißend ... Es ist ebenso schön wie düster.«The Guardian
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
In den ersten Jahren der Weimarer Republik trug der deutsche Psychiater Hans Prinzhorn eine bemerkenswerte Sammlung von Werken schizophrener Patientinnen und Patienten zusammen, die die Welt in Erstaunen und Entzücken versetzte. Die Sammlung Prinzhorn spielte eine wichtige Rolle in der Entstehung der modernen Kunst der Zeit. Was Prinzhorn jedoch nicht ahnen konnte, war, dass diese Werke bald dazu dienen würden, den Boden für einen Massenmord zu bereiten.
Denn schon kurz nach seiner Machtergreifung erklärte Hitler der modernen Kunst den Krieg. Die Nazis veranstalteten riesige Ausstellungen "Entartete Kunst" und verunglimpften gleichzeitig psychisch kranke und behinderte Menschen als ebenso „entartet“. Was darauf folgte, war die Aktion T4, der Massenmord an den psychisch Kranken des Landes – unter ihnen Prinzhorns Künstlerinnen und Künstler, denen Charlie English mit seinem Buch endlich ein Denkmal setzt.
»English hat ein großartiges Buch geschrieben, spannend und thematisch mitreißend ... Es ist ebenso schön wie düster.« The Guardian
Über Charlie English
Charlie English war Redakteur beim Guardian, zuletzt arbeitete er als Chefredakteur des Auslandressorts. Als Journalist und Autor bereiste er die ganze Welt und auf Deutsch erschienen bisher »Das Buch vom Schnee« (2009) und das vielgelobte »Der Bücherschmuggler von Timbuktu« (2018) mit über 10.000 verkauften Exemplaren. Er lebt mit seiner Familie in London.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Charlie English
Wahn und Wunder
Hitlers Krieg gegen die Kunst
Aus dem Englischen von Helmut Ettinger
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Wichtige Künstlerinnen und Künstler
VORBEMERKUNG ZUM Sprachgebrauch
VORWORT — Ein Brief aus Berlin
ERSTER TEIL — BILDNEREI
Kapitel 1 — Der Mann, der in den Kanal sprang
Kapitel 2 — Hypnose im Wald
Kapitel 3 — Eine Begegnung in Emmendingen
Kapitel 4 — Anschauen gefährlich!
Kapitel 5 — Die schizophrenen Meister
Kapitel 6 — Abenteuer im Niemandsland
ZWEITER TEIL — »ENTARTUNG«
Kapitel 7 — Gefällige Bildchen
Kapitel 8 — Ein Abendessen bei den Bruckmanns
Kapitel 9 — Einblicke in eine transzendentale Welt
Kapitel 10 — Kunst und »Rasse«
Kapitel 11 — Eine Kulturrevolution
DRITTER TEIL — BILDERSTURM
Kapitel 12 — Der Bildhauer Deutschlands
Kapitel 13 — Die Säuberung des Kunsttempels
Kapitel 14 — Deutsch sein, heißt klar sein
Kapitel 15 — Der Heilige und der Irre
Kapitel 16 — Das Mädchen mit den blauen Haaren
VIERTER TEIL — »EUTHANASIE«
Kapitel 17 — Weiße Füchse
Kapitel 18 — Der Würgengel
Kapitel 19 — Du kommst noch mit dem grauen Wagen fort
Kapitel 20 — Im Irrenhaus
Kapitel 21 — Landschaften des Gehirns
EPILOG
Bildteil
DANK
ANMERKUNGEN
VORWORT
ERSTER TEIL: BILDNEREI
ZWEITER TEIL: »ENTARTUNG«
DRITTER TEIL: BILDERSTURM
VIERTER TEIL: »EUTHANASIE«
AUSWAHLBIBLIOGRAPHIE
Bildnachweis
Index
Erläuterungen
Impressum
Für Doris Noell-Rumpeltes
1949–2021
Wichtige Künstlerinnen und Künstler
Franz Karl Bühler
Else Blankenhorn
Karl Genzel
August Natterer
Hyazinth von Wieser
Paul Goesch
Carl Lange
Katharina Detzel
Joseph Schneller
Gustav Sievers
Agnes Richter
August Klett
Frau von Zinowiew
Josef Forster
Wilhelm Werner
VORBEMERKUNG ZUM Sprachgebrauch
Ich habe mich bemüht, einige Klippen zu umschiffen, die auftauchen, wenn man über geistige Gesundheit schreibt. Eine besteht darin, das Stigma zu verfestigen, wenn man Menschen nur durch ihre Diagnose definiert, einen Zustand als Defekt und nicht als Unterschied sieht und davon ausgeht, dass jeder darunter »leiden« muss. Genauso falsch wäre es, die Schwierigkeiten eines Lebens mit Schizophrenie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu unterschätzen, das für viele lebenslanges Eingesperrtsein und für Hunderttausende Sterilisation oder Ermordung bedeutete. Ich gebrauche Termini jener Zeit und zitiere gelegentlich auch brutale Schimpfwörter, um vorhandene Einstellungen und die Feindseligkeit sichtbar zu machen, denen die Prinzhorn-Künstler ausgesetzt waren.
Redaktionelle Anmerkung zur deutschen Ausgabe:
Im Gegensatz zum Englischen »race« ist die Verwendung des deutschen Wortes »Rasse« in Bezug auf Menschen mit Diskriminierung konnotiert und wissenschaftlich haltlos. Im historischen Kontext der nationalsozialistischen »Rassentheorie« nimmt das Wort jedoch eine zentrale Rolle ein, und es konnte in diesem Buch leider nicht komplett auf seine Reproduktion verzichtet werden. Sofern es nicht Teil eines direkten Zitats aus der Zeit ist, steht es zur Kenntlichmachung stets in Anführungszeichen. Dasselbe gilt auch für einige andere Wörter aus dem historischen Kontext, die im Deutschen nicht mehr zeitgemäß und diskriminierend sind.
VORWORT
Ein Brief aus Berlin
Am 9. Oktober 1939 – der Zweite Weltkrieg war kaum einen Monat alt – erließ das Ministerium des Inneren des Dritten Reichs eine Direktive an alle Heilanstalten für psychische Krankheiten im Land, die von Reichsgesundheitsführer Dr. Leonardo Conti unterzeichnet war. Als Teil neuer Wirtschaftsmaßnahmen der Kriegszeit fordert Conti die Ärzte darin auf, alle Patienten in ihrer Obhut mit psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie, Epilepsie, Altersdemenz, Syphilis, »Schwachsinn«, Enzephalitis oder Morbus Huntington zu registrieren. Ebenso Menschen ohne derartige Erkrankungen, wenn sie sich seit fünf oder mehr Jahren in einer solchen Anstalt befanden, als kriminell galten oder nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besaßen bzw. »nicht deutschen oder artverwandten Blutes« waren. Im Zweifelsfall sollten die Mediziner sich stets für die Registrierung entscheiden, da es für Berlin günstiger wäre, zu viele als zu wenige Patienten in den Listen zu haben.
Contis Brief lagen Meldebogen bei – einer für jeden Patienten. Neben der Angabe der sogenannten Rassekategorie (wobei unter Kategorien wie »Jude«, »jüdischer Mischling I. oder II. Grades«, »Neger«, »Negermischling«, »Zigeuner« und »Zigeunermischling« auszuwählen war) hatten die Ärzte Einzelheiten über die Arbeitsfähigkeit der Patienten und ihre Krankheiten mitzuteilen und anzugeben, ob und wie häufig sie Besuch erhielten. Die Formulare sollten möglichst mit Schreibmaschine ausgefüllt und so rasch es nur ging nach Berlin zurückgeschickt werden.
Als die Direktive in den psychiatrischen Heilanstalten überall im Lande eintraf, suchte das Personal herauszufinden, was sie wohl bedeuten mochte. Wollte die Regierung diese Patienten verlegen? Wenn ja, wohin? Brauchte sie Arbeitskräfte, die an der Front Schützengräben ausheben sollten, oder wollte sie für verwundete Soldaten Krankenhausbetten freimachen? Sie durchsuchten also die Meldeformulare nach versteckten Hinweisen. Da die Bürokraten nicht viel Raum für eine detaillierte medizinische Beurteilung vorgesehen hatten, kam zumindest ein Arzt zu dem Schluss, es könne sich um keine allzu drastische Aktion handeln. Andere fanden die Frage nach den Besuchern sehr merkwürdig. Wozu musste Berlin das wissen?
Der geheime Zweck des Conti-Briefs klärte sich in den darauffolgenden Wochen. Alle Papiere, die zurückkamen, wurden kopiert und an ein Gremium von Psychiatern, sämtlich stramme Nazis, geschickt. Diese hatten den Auftrag, jeden Fall entweder mit einem roten Plus oder einem blauen Minus zu markieren. Die wenigen Patienten, die ein blaues Minus erhielten, ließ man in Ruhe. Ein rotes Plus hingegen bedeutete ihr Todesurteil. Diese Menschen wurden in ihren Krankenhäusern und Heilanstalten eingesammelt, in Busse gesetzt und in speziell dafür vorbereitete Anstalten gebracht. Dort wurden sie entkleidet, gewogen und in luftdicht abgeschlossene Räume gestoßen, die man mit tödlichem Kohlenmonoxid flutete. Sobald sie alle tot waren, wurden ihre Leichen verbrannt und die Asche auf Feldern verstreut. Aktion T4, wie man dieses Programm nannte, war das erste Beispiel dafür, dass eine Regierung die industrielle Vernichtung eines Teils der Bevölkerung ihres eigenen Landes organisierte. Für die Nazis sollte dies der Prototyp eines weit größeren Massenmords sein, der noch bevorstand.
Unter den Hunderttausenden psychisch kranker und behinderter Menschen, die den »Euthanasie«-Aktionen zum Opfer fielen, befanden sich zwei Dutzend, deren Kunstwerke der Psychiater Hans Prinzhorn in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg gesammelt hatte. Wie diese Künstler, die zugleich Patienten waren, mit dem Naziregime in Konfrontation gerieten, davon will ich in diesem Buch erzählen.
Kunst im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus zu untersuchen, scheint widersinnig oder gar deplatziert zu sein. Was kann Malerei oder Bildhauerei bedeuten, wenn man sie an der ungeheuren Zahl der Toten misst? Sind Hitlers Vorstellungen von Kultur nicht eine Ablenkung von seinen weitaus schlimmeren Verbrechen, über die schon so viel geschrieben wurde? Mein Bericht wird zeigen, dass das Gegenteil zutrifft. Hitlers Massenmordprogramme und seine Kunstauffassungen waren durch ein ganzes Netz pseudowissenschaftlicher »Theorien« über »Rassen«, die Moderne oder die Konzepte von »Entartung« und »lebensunwertem Leben« eng miteinander verknüpft.
Die Kunstsammlung, die Hans Prinzhorn in Heidelberg aufgebaut hat, besteht ausschließlich aus Werken von Patienten psychiatrischer Heilanstalten. Zunächst als Forschungsarchiv der psychiatrischen Klinik der Universität Heidelberg geplant, wurde sie für Prinzhorn bald viel interessanter ob ihres künstlerischen Wertes, denn als Hilfsmittel zur Diagnose von psychischen Krankheiten. Das lag wesentlich an der außerordentlichen Qualität des Materials, das er fand.
Die Männer und Frauen, von denen die Werke stammten, hatten ihr Leben von aller Welt abgeschnitten verbracht, vergessen von ihren Freunden und oft sogar von ihren Familien. Meist diagnostiziert mit Schizophrenie, wollten die wenigsten unbedingt »Kunst« schaffen. Vielmehr benutzten sie Zeichnungen, Skulpturen und Texte, um Aspekte ihrer psychotischen Wirklichkeit abzubilden oder Botschaften von ihrer isolierten Innenwelt auszusenden. Die Sammlung enthält alle möglichen Schöpfungen – von Gemälden, Zeichnungen und Collagen bis hin zu Kritzeleien, Gedichten und Musik. Dafür verwendeten sie, was ihnen gerade in die Hände fiel: abgelaufene Pflege- und Speisepläne, Tüten, benutzte Briefumschläge und sogar Toilettenpapier. Plastiken finden sich neben Entwürfen für große Erfindungen, Tagebüchern oder Briefen, die wahrscheinlich niemals abgeschickt wurden. Eine Frau schrieb immer dieselben Worte – »Liebling, komm« – auf Hunderte Blatt Papier, bis jedes einzelne schwarz von ihrer Sehnsucht war. Manche zeichneten pornografische Szenen. Andere stellten mit Nadel und Faden Stoffpüppchen her oder bestickten Wäschestücke, die sie am Körper trugen, mit Worten und Satzfetzen. Diese oft sehr merkwürdigen Dinge zu betrachten, ist ein bewegendes, zuweilen transzendentes Erlebnis. Besucher äußerten, sie sähen darin »Aufwallungen aus der Tiefe der menschlichen Seele«, welche »Fenster in eine andere Wirklichkeit öffneten«. Eine ehemalige Kuratorin verglich ihren ersten Eindruck von der Sammlung mit dem Augenblick, in dem ein Damm bricht: »Phänomenale Welten öffneten sich mir, schlugen mich in ihren Bann und brachten mich aus dem Gleichgewicht.«
Prinzhorns Verdienst besteht darin, diese Kunst aus ihrem Entstehungsort, den psychiatrischen Kliniken und Pflegeeinrichtungen, herausgeholt und der Außenwelt zugänglich gemacht zu haben. Er präsentierte sie einer neuen Generation von Künstlern, die damit beschäftigt waren, den Wahnsinn zu verarbeiten, den sie im Ersten Weltkrieg erlebt hatten. Bekannte Maler, Bildhauer und Schriftsteller, darunter Paul Klee, Max Ernst, André Breton und Salvador Dalí, sahen in dieser Sammlung einen von bürgerlicher Erziehung und Bildung unverfälschten, unmittelbaren Ausdruck des menschlichen Innenlebens. Das führte dazu, dass für ein paar stürmische Jahre zwischen 1920 und 1930 von Wahnsinnsideen inspirierte Kunst bei der Avantgarde in hohem Ansehen stand. Doch sie blieb stets eine Provokation, und als in Deutschland die Weimarer Republik ihren Niedergang erlebte, geriet die moderne Kunst unter die Attacken der äußersten Rechten.
Die Nationalsozialisten suchten den Leuten den Traum von einer Zukunft zu verkaufen, die auf einer mythischen Vergangenheit, einer Zeit von »Blut und Boden« beruhte, in der das Feld von einer ethnisch reinen »Rasse«, dem Volk der Arier, bestellt wurde. Adolf Hitler, der Messias der Bewegung, hatte mit Prinzhorns Künstlern mehr gemein, als er zuzugeben bereit gewesen wäre. Obwohl nur wenige ihn jemals untersucht haben, hat seine hysterische, psychopathische Persönlichkeit Psychiater und Fachleute für mentale Gesundheit gleichermaßen zu einer Unzahl von Diagnosen veranlasst. Zudem sah sich Hitler als Mann der Kultur. Die skrupellosesten seiner Aktionen wurden aus dem Glauben geboren, er sei der »Künstler-Führer«, eine in der deutschen Geschichte periodisch wiederkehrende Figur, fähig, dem Volk den Weg zu weisen und es ohne Rücksicht auf Verluste auf ihn zu leiten. Seine Politik stellte er als eine kulturelle Unternehmung dar. In der Kunst der Moderne mit ihren Anleihen bei der Psychiatrie, ihren Abstraktionen und ihrer groben emotionalen Expressivität, die sich so sehr von seinen eigenen lauen Aquarellen unterschied, sah er ein Symptom für »geisteskranke« Einflüsse, welche die »Volksgemeinschaft« der Deutschen verunreinigt hätten. Wahre arische Kunst, so glaubte er, sei Ausdruck deutschen Geistes, und dieser werde nur gesunden, wenn die »Entartung« ausgemerzt sei. So ging die kulturelle Säuberung der rassischen Säuberung voraus. Prinzhorns Künstler sollten auf einzigartige Weise von beiden Vorgängen erfasst werden.
Prinzhorn war klar, dass das Projekt seiner Sammlung Kontroversen auslösen konnte. Wenn er in schizophrener Kunst mehr als nur ein Symptom sah, forderte er damit das gesamte konventionelle psychiatrische und künstlerische Denken seiner Zeit heraus. Natürlich konnte er nicht ahnen, welch extreme Konfrontation ihm bevorstand, in welche Gefahr seine Künstler geraten und zu welch destruktiven Zwecken ihre Arbeiten letztlich benutzt werden sollten.
Charlie English
London
ERSTER TEIL
BILDNEREI
»Ich könnte mein Leben damit verbringen, die Wahnsinnigen zu ihren Bekenntnissen zu provozieren. Sie sind Menschen von peinlicher Ehrlichkeit und von einer Unschuld, die sich nur mit der meinen vergleichen lässt. Ko-lumbus hätte mit einer Mannschaft von ihnen ausfahren sollen, um Amerika zu entdecken.
André Breton,
Das Manifest des Surrealismus, 1924
1
Der Mann, der in den Kanal sprang
An einem Wintertag des Jahres 1898 eilte ein untersetzter junger Mann mit Schnurrbart das Ufer eines Kanals in Hamburg entlang. Pohl, der Name, unter dem ihn die Welt bald kennen sollte, war ein eleganter Dreißiger. Gern zeigte er sich mit Stock oder Regenschirm und einem Zylinder auf seinem pechschwarzen, geölten Haar. Doch zu diesem bestimmten Zeitpunkt hatte Pohl für solcherlei Dinge überhaupt keinen Sinn. In seine eigene Wolke der Angst gehüllt, versuchte er den mysteriösen Gestalten zu entkommen, die ihn quälten. Er wusste nicht, wer sie waren, sie konnten zu jeder Zeit, an jedem Ort und in unterschiedlichster Verkleidung auftauchen. Aber er hatte eine recht gute Vorstellung davon, wer sie schickte.
Angefangen hatte all das in Straßburg, einer damals deutschen Stadt, wo er gerade seine schlimmste berufliche Demütigung hatte hinnehmen müssen: Er wurde aus der städtischen Kunstgewerbeschule geworfen. Und der Direktor der Schule hatte sich nicht etwa damit begnügt, eine brillante Laufbahn zu stoppen, sondern auch noch Spione ausgeschickt, die Pohl beobachteten, an seinem Schlüsselloch horchten und ihn dazu trieben, immer wieder das Quartier zu wechseln. Am Ende sah er sich gar gezwungen, die Stadt zu verlassen. Er ging ans andere Ende des Landes, nach Hamburg, und verlor sich in den Vergnügungen des berüchtigten Rotlichtviertels, wo er viel Geld für Prostituierte und Peep-Shows ausgab. Aber selbst dort kamen ihm seine Feinde auf die Spur. Fremde drohten ihm auf der Straße. In der Pferdebahn beleidigte ihn der Schaffner, der vor allen Fahrgästen brüllte: »Der ist verrückt!« Zuhälter riefen »Gauner!«, »Strolch!« oder »Macht ihn kalt!« Selbst von der Bühne des Theaters schleuderten ihm die Schauspieler nur für ihn bestimmte geheime Botschaften entgegen.
An diesem Tag im März wusste er, dass sich der Ring um ihn zu schließen begann.
Hamburg, die große Hafenstadt an der Elbe, das »Tor zur Welt«, das einer ganzen Flotte von Hochseeschiffen Heimathafen war, die Deutsche nach Boston und Baltimore, Hoboken oder Hongkong brachten, war ein Gewirr von Buchten und Seen, Kanälen und anderen Wasserstraßen. Sie versperrten Pohl den Fluchtweg. Ihm blieb nur eine Wahl: Er musste schwimmen. In diesen späten Wintertagen war das Wasser im Kanal so kalt, dass es beinahe gefror, aber er sprang trotzdem hinein. Das finstere Nass schlug über ihm zusammen, doch er tauchte wieder auf und versuchte, das andere Ufer zu erreichen.
Als er schließlich klatschnass und zitternd an Land gezogen wurde, sahen die Passanten sofort, dass mit dem merkwürdigen Schwimmer etwas nicht stimmte. Von Verfolgern war weit und breit nichts zu sehen. Niemand war ihm nachgelaufen. Er wirkte gestört, verwirrt, vielleicht psychisch krank. Daher brachte man ihn ans Tor der Heilanstalt Friedrichsberg, eines riesigen Komplexes auf einem Hügel im Nordosten der Stadt. Dort nahm man ihn auf. Für die nächsten 42 Jahre sollte er in der fragwürdigen Obhut des Systems der Psychiatrie bleiben, als einer von Hunderttausenden Insassen, die hinter den Mauern deutscher Anstalten ein prekäres, nahezu unsichtbares Leben führten.
»Pohl« war ein Deckname, der seiner Familie den Makel eines »Geisteskranken« ersparen sollte. Der richtige Name des Mannes war Franz Karl Bühler. Ihn nach seinem erlernten Beruf lediglich als Schmied zu bezeichnen, würde seiner Person in keiner Weise gerecht. Bühler war einer der weltweit führenden Kunstschmiede zu einer Zeit, da sich dieses Kunsthandwerk in ungeahnte Höhen emporschwang. Er erhitzte Stahl im heißen Schmiedefeuer, bis er weich und elastisch wurde. Durch Ziehen und Biegen, Stauchen, Schlagen und Schweißen gelang es ihm, daraus Blumen, Gräser und Schilfrohr zu formen, die man berühren musste, um glauben zu können, dass sie nicht echt waren. Aber Bühler war etwas zugestoßen, eine innere Entgleisung, die seinen Realitätssinn störte und ihn seinen eigenen Erfindungen und Einbildungen auslieferte. Die Ärzte, die ihn in den folgenden Monaten und Jahren untersuchten, stellten ihm verschiedene Diagnosen, bis schließlich die der Schizophrenie an ihm hängen blieb.
Schizophrenie, die schwerste unter allen psychischen Erkrankungen, ist am schwierigsten zu verstehen. Selbst sprachgewandten Menschen, die daran leiden, fällt es schwer, diesen Zustand anders als seltsam, befremdlich oder unheimlich zu beschreiben. In einem Bericht heißt es, Schizophrenie sei vergleichbar mit »einem Land, das der Wirklichkeit entgegengesetzt ist, in dem ein unerbittliches Licht die Menschen verwirrt«, sie sinnlose Gesten und Bewegungen machen lässt. Andere beschreiben sie als ein Gefühl der Auflösung oder der Betrachtung ihrer Umgebung durch ein umgedrehtes Fernglas. Manche Psychiater glauben, während die meisten Menschen ihre Wahrnehmungen zu einem Gesamtbild der Welt zusammenfügen, in der sie agieren können, verknüpfen mit Schizophrenie Lebende zusammenhanglose Sinnesdaten miteinander, die nur durch irrationale intellektuelle Sprünge zu begreifen sind. So war es möglich, dass Bühler, als er sich in Straßburg verfolgt glaubte, einen Straßenbahnschaffner rufen hörte: »Der ist verrückt!«, während der Mann nur die nächste Haltestelle ankündigte. Doch nicht alle Erscheinungsformen sind gleich, und nicht jeder Betroffene empfindet den Zustand als belastend. Manche sehen ihn als eine Bereicherung, die ihnen ungewöhnlich tiefe Einblicke gewährt. Heutzutage wird nur ein Drittel der Fälle als fortgeschritten bewertet, und die meisten Menschen mit Schizophrenie führen ein aktives, erfülltes Leben. Als Bühler in klinische Behandlung kam, war die Diagnose noch brandneu und wurde als Anzeichen für einen unumkehrbaren Verfall gesehen. Bei ihm sei nichts zu machen, glaubten seine Ärzte. Es sei nur eine Frage der Zeit.
Bühler hatte schon immer als eigenartig gegolten. Er wurde am 28. August 1864 in Offenburg geboren, einem pittoresken Städtchen mit Glockengeläut und Spitzdächern im Tal des Oberrheins. Seine Mutter Euphrosyne starb jung, und sein Vater, der in ihrem Haus in der Glaserstraße eine Schmiede betrieb, heiratete eine zweite Frau namens Theresia. Während der Vater ein ruhiger, höflicher Mann war, wuchs Franz Karl zu einem unbändigen, exzentrischen Jungen heran, der Stimmen hörte, seit er sechzehn war. Intelligent und beliebt, brachte er gute schulische Leistungen. Er liebte die Musik und spielte in einem Kammermusikensemble die Geige. Aber Anerkennung sollte er sich vor allem in der Schmiede erwerben. Dort war er ein wahrer Virtuose.
Im Jahr 1871 wurde das Großherzogtum Baden und mit ihm Offenburg dem neu gegründeten Deutschen Reich unter Kaiser Wilhelm I. zugeschlagen. Das ehrgeizige Kaiserreich benötigte kühne imperiale Architektur, und so wurde Bühler & Sohn zum führenden Lieferanten von Schmiedeeisen für die Schlösser und riesigen Bauten, die überall in der Gegend aus dem Boden schossen. An den Kunstgewerbeschulen von Karlsruhe und München lernte Bühler, wie man die damals so beliebten eleganten Rokoko-Formen schmiedete. Dabei zeigte er auch eine subversive Seite: Als der Kaiser für Straßburg im von Frankreich eroberten Gebiet einen riesigen Palast in Auftrag gab, integrierte Bühler in alle Geländer Karikaturen mit dessen riesiger Nase und Don-Quixote-Schnurrbart. Die kreative Ader brachte Bühler bald Preise bei Handwerkswettbewerben überall im Land ein. 1893 – er war noch in den Zwanzigern – erreichte seine Karriere bereits zwei Höhepunkte: Er wurde zum Leiter der Werkstatt der Straßburger Kunstgewerbeschule ernannt und dazu auserwählt, Deutschland auf der Kolumbus-Weltausstellung in Chicago zu vertreten. Als dieser brillante, beliebte und bereits etwas überhebliche junge Mann in jenem Sommer einen Dampfer nach Amerika bestieg, schickte er sich an, einer der angesehensten Handwerker Europas zu werden.
Die Industrie befand sich zu jener Zeit mitten in einem Umbruch, was sich 1893 nirgendwo drastischer zeigte als in Chicago. Ein Autor jener Zeit schrieb, die Welt habe sich seit Jesus Christus weniger verändert als in jenen Jahren bis zum Ersten Weltkrieg. Während noch 1870 die meisten Menschen in Westeuropa und den USA auf dem Land lebten und arbeiteten, hatte schon bis 1910 eine Fülle neuer Berufe die Mehrzahl in die Städte gezogen. In London, Paris und Wien verdoppelte sich die Einwohnerzahl, in München stieg sie um das Drei- und in Berlin gar um das Vierfache. New York vergrößerte sich um den Faktor sechs. Am schnellsten von allen Städten in der Weltgeschichte wuchs Chicago. Kaum sechzig Jahre alt, strebte es bereits nach dem Titel der zweitgrößten Stadt der USA und hatte als Ort der Weltausstellung, dieses Schaufensters technologischen und kulturellen Könnens, New York bereits geschlagen.
Die Kolumbus-Weltausstellung, wie das Ereignis von 1893 aus Anlass des 400. Jahrestages der Kolonialisierung Amerikas offiziell genannt wurde, war die jüngste in der Reihe großer Weltausstellungen, die 1851 in London begonnen hatte. Wie Bühler feststellte, fiel die Show von Chicago größer und spektakulärer aus als alle ihre Vorgängerinnen. Auf einer Fläche von nahezu 300 Hektar am Ufer des Michigansees waren die Spitzenprodukte des technologischen Fortschritts der Zeit ausgebreitet. 27 Millionen Besucher wurden gezählt – eine Zahl, die fast der Hälfte der gesamten US‑Bevölkerung jener Zeit entsprach. Vier Jahre zuvor in Paris hatten die Gäste Gustave Eiffels Turm bestaunt, eine unglaubliche Metallkonstruktion, die über 300 Meter hoch in den Himmel ragte. Die Antwort der Amerikaner, das weltweit erste Riesenrad, war so hoch wie der größte der neuen Wolkenkratzer, und es bewegte sich auch noch. Von Dampfmaschinen mit einer Leistung von 1000 PS angetrieben, war es in der Lage, 38 000 Besuchern am Tag etwas zu ermöglichen, was bisher nur sehr wenigen vergönnt gewesen war – die Menschenwelt von oben zu bestaunen. Schon dieser Perspektivwechsel war ein radikal neues Erlebnis, aber unten in den Hallen und Gärten der »Weißen Stadt« wartete eine Unmenge weiterer frappierender Entwicklungen – das erste Kino, das man für Geld besuchen konnte, das erste rollende Laufband, die Urform des Reißverschlusses, die ersten Frühstückscerealien oder Mr. Wrigleys Prototyp für den Kaugummi. Nachts wurde der Himmel über Chicago auf so spektakuläre Weise erleuchtet, dass einem Besucher der Mond leidtat, weil er im Vergleich dazu so armselig und blass wirkte. Warnungen für das kommende Jahrhundert gab es auf diesem futuristischen Technikspielplatz auch: In dem millionenschweren Pavillon der Firma Krupp am Südrand des Geländes wurde die Technik ausgestellt, die Jahre später die Schlachtfelder Flanderns in Schutt und Asche legen sollte.
Bühlers Beitrag auf dieser Messe stand in dem größten je von Menschen auf der Erde errichteten Bau, im Manufactures and Liberal Arts Building. Es war eine seiner schönsten und größten Arbeiten – ein etwa zwölf Meter breites dreiflügeliges Tor im Stil des Neobarock. Auf jedem der Teile wuchs von unten her ein wahrer Dschungel von Blüten und Blattwerk empor, ein geheimnisvoller schmiedeeiserner Garten. Witzig, verspielt und in großartiger technischer Ausführung zeugte es davon, dass »Deutschland in der Schmiedearbeit weitaus an der Spitze« stand, wie es in einem offiziellen Bericht nach Berlin hieß. Bühler erhielt dafür die höchste Bewertung in seinem Fach und trug so dazu bei, dass Deutschland insgesamt den ersten Preis gewann. Es war die größte Ehrung, die man in Bühlers Profession erlangen konnte.
In Chicago verbrachte er sechs Wochen. Die berauschende Atmosphäre schien in ihm die Lust zum Experimentieren geweckt zu haben. Er begann, sich für das Okkulte zu interessieren, und ließ sich mit einer Gruppe Spiritisten ein, die glaubten oder vorgaben, mit den Toten in Kontakt treten zu können. Vier Jahre später sollte Bühler die Stimmen, die er hörte, und die Visionen, die er hatte, mit spiritistischen Begriffen beschreiben. Sicherlich schaute er sich auch in den Rotlichtvierteln von Chicago, darunter dem Levee, um, wo Prostituierte nackt in Haustüren herumstanden und Drogensüchtige sich in dunklen Gängen ihren Schuss setzten. Im Jahr darauf musste er sich wegen Syphilis behandeln lassen, einer Krankheit, die zu der Zeit mit Schizophrenie in Verbindung gebracht wurde. Als er wieder nach Europa fuhr, wurde seine Persönlichkeit bereits von einem gefährlichen Gemisch verschiedener psychotischer Risikofaktoren bestimmt. Bis zum Wahnsinn war es nur noch ein Schritt.
Mit stolzgeschwellter Brust kehrte er zu seinem neuen Job in Straßburg zurück – ein Sieger über die weltweite Konkurrenz in seinem Metier. Doch das blieb, was es war – ein Handwerk, der arme Verwandte der schönen Künste. Um selbst weiter aufzusteigen, glaubte Bühler seinen gesamten Berufszweig aufwerten zu müssen. Das wurde zu seinem Lebensziel. Für den Anfang beschloss er, seine Straßburger Werkstatt wahrhaft modern und effizient zu gestalten.
An diese Aufgabe ging er mit einer Verve, die seine neuen Kollegen überraschte und ihn bald mit dem Direktor der Schule, Anton Seder, in Konflikt brachte. Bühler wollte die Werkstatt für Lernende aus der ganzen Welt öffnen, während Seder sich vor allem der Stadt verantwortlich fühlte. Bühler hatte den Wunsch zu reisen und in Budapest, Berlin, Stuttgart, Nürnberg und Dresden die Technik anderer Meisterschmiede zu studieren. Doch Seder verlangte von ihm, in Straßburg zu bleiben und zu unterrichten. Bühlers Pläne stießen überall auf Widerstand. Verglichen mit dem klassenlosen Chicago war Straßburg ein Labyrinth unsichtbarer sozialer Schranken. Im Café Broglie, wo die Kunstmeister sich nach der Arbeit trafen, war der unverfrorene Handwerker bald Tagesgespräch. Er fing an, Lehrstunden ausfallen zu lassen. Ende 1896 wurde er nach drei Jahren wegen Unzuverlässigkeit, nicht genehmigten Handelns und Arbeitszeitverletzungen aus der Schule geworfen.
Bühler wusste, dass dieses öffentliche Scheitern für immer einen Makel in seiner Karriere darstellen sollte. In einem dreißig Seiten umfassenden, weitschweifigen »Verteidigungsbrief« an Bürgermeister und Stadtrat versuchte er sich zu rechtfertigen. In dem mit Wortspielen und Vergleichen gespickten Schreiben legte er seine Vision für die Werkstatt dar und warf Seder vor, diese vereiteln zu wollen. Er erhielt nie eine Antwort: Dieses Schweigen bildete den Nährboden für seine Paranoia.
»Ich befinde mich zwischen Scylla und Charybdis«, schrieb er, »und kenne nicht den Ort, wo der Felsen sich befindet, wo mein Steuer zerbrechen soll.«
Bald kam es ihm vor, als horchten Seders Spione an seinem Schlüsselloch. Einige Male wechselte er die Wohnung, bevor er im Herbst 1897 endgültig nach Hamburg ging. Mehr und mehr lebte er in einer eingebildeten, paranoiden Gegenwelt. Anfang 1898 sprang er bei einem Nervenzusammenbruch in den Kanal.
Die Heilstätte Friedrichsberg bot Raum für mehr als 1300 Patienten und hatte selbst für damalige Verhältnisse einen schlechten Ruf. Den Pflegern wurde Gewaltanwendung nachgesagt, und die neuen Blöcke hatten vergitterte Fenster, was Besucher eher an Elefantenhäuser im Zoo erinnerte. Doch die Einrichtung erfüllte ihre Aufgabe, »Verhaltensgestörte« mit möglichst geringen Kosten von der Straße fernzuhalten. Es war ein geeigneter Ort, um Unbequeme wegzusperren.
Bühler blieb dort nicht lange. Acht Tage nach der Aufnahme wurde er seinem Vater übergeben, doch bereits im Zug gen Süden streckte er dem Schaffner die Zunge heraus, überzeugt, der habe das zuerst ihm gegenüber getan. In Offenburg wurde er bald zum »Ärgernis«, weil er sich mit allen stritt, besonders mit seiner Stiefmutter. Die Familie beschloss, Bühler zu einer Erholungskur ins Sanatorium Breitenau in der Schweiz zu schicken, doch schon nach zwei Wochen entkam er von dort durch ein Fenster und bestieg einen Zug nach Deutschland. Weil er keine Fahrkarte hatte, versteckte er sich unter einer Bank. Auf einem Postamt wurde er von der Polizei festgenommen. Er hatte versucht, telefonisch um Geld zu bitten, hörte aber eine Stimme, die ihn einen Betrüger nannte, und wurde ausfallend. Man brachte ihn nach Breitenau zurück, wo er in der geschlossenen Abteilung untergebracht wurde. Er glaubte, Ärzte, Pfleger und Patienten hätten sich gegen ihn verschworen. Er hatte Halluzinationen, nachts sah er merkwürdige Hunde.
Nach zwei Monaten kehrte er nach Deutschland zurück. Zwei Wärter brachten ihn zur Heil- und Pflegeanstalt Illenau in Achern. Nach wie vor war er eine elegante Erscheinung. Bei der Aufnahme fiel er durch einen Zylinder und sehr gute Manieren auf. Er erklärte, er sei nicht psychisch krank, sondern nur deshalb dort, weil sein Vater wünschte, er möge sich gründlich untersuchen lassen. Er bat darum, wenn möglich, auch seine Verdauungsprobleme zu behandeln. In der ersten Nacht schlief er vortrefflich und sang am Morgen ein Loblied auf die Angestellten, weil es ihm in der Illenau so gut gefiel. Was er nicht wusste: In seine Akte schrieben die Ärzte, »dass wir es wahrscheinlich mit einem constitutionellen Psychopathen zu tun haben und dass die vorliegende Krankheit auf der Basis abnormer Charakteranlage allmällig (sic!) sich entwickelte und steigerte«. Am 4. Juni schrieb Bühler einen Brief an den Direktor, dankte ihm für den Aufenthalt und kündigte an, er sei nun bereit, die Einrichtung zu verlassen. Er wolle sich an einen Kurort begeben. Zu seinem Erstaunen erfuhr er, dass man ihn nicht gehen lassen wollte. Da begnügte er sich damit, um eine Geige und Gerätschaften zum Zeichnen zu bitten.
In den darauffolgenden Wochen geriet Bühler in tiefe Verzweiflung. Er schrieb täglich sechs bis zehn Briefe, in denen er drohte, bat und flehte, man solle ihn freilassen. Er untersuchte die Schlösser, ob sie zu knacken wären. Er stieg auf einen Baum im Garten, um nach einem Fluchtweg Ausschau zu halten. Als er gefragt wurde, was er da treibe, antwortete er, es seien Leibesübungen. Als ihm klar wurde, dass er seine Freiheit verloren hatte, wurde er frustriert und zornig. Er zertrümmerte einen Nachttopf, stritt mit Pflegern und anderen Patienten und fing Prügeleien an. Obwohl ihm rationales Denken immer schwerer fiel, arbeitete er so intensiv wie vor der Einlieferung, schrieb, zeichnete und übte sich in der Malerei, um sein künstlerisches Programm wiederaufnehmen zu können. Nach eineinhalb Jahren in der geschlossenen Anstalt schien er im Herbst 1899 eine Lösung für seine inneren Konflikte gefunden zu haben.
Ein Hauptprinzip der Psychiatrie zu jener Zeit war Beobachtung. In der Illenau wurden die Patienten in großen, offenen »Observationsstationen« untergebracht, wo sie im Bett liegen mussten. Ihr Verhalten wurde rund um die Uhr beobachtet. Da Bühler klar wurde, dass es von diesem Ort kein Entkommen gab, schlug er sich auf die Seite seiner Wärter. Von nun an war er »Doktor« Franz Bühler, ein »sanitätspolizeilicher Beamter« mit dem Auftrag des Ministeriums in Karlsruhe, eine Studie der Patienten anzufertigen. Dazu gehörte es, alle Insassen der Anstalt zu zeichnen, über jeden einzelnen Fall biografische Informationen zu sammeln, alle Aspekte ihrer Existenz sorgfältig zu dokumentieren, zu nummerieren, zu katalogisieren und zu beurteilen.
Die ausführlichen Chroniken, die Bühler anfertigte, dienten nicht dem von ihm beabsichtigten medizinischen Zweck, denn die Ärzte beachteten seine Zeichnungen kaum. Aber sie fingen die Atmosphäre des Lebens an diesem Ort ein. Der kanadische Soziologe Erving Goffman hat die verstörende psychologische Wirkung »totaler Institutionen« wie dieser auf die Patienten beschrieben. Im Unterschied zu Gefängnishäftlingen, die nach dem Verbüßen ihrer Strafe in die Welt zurückkehren, wurden viele Patienten psychiatrischer Anstalten nie entlassen. Ihr Leben bestand aus einer endlosen Abfolge der Schritte Schlafen, auf dem Bett sitzen, auf Essen warten, Rauchen und zum Haareschneiden anstehen. Jedes sinnvollen Zieles beraubt, konnte auch der gesündeste Insasse zur Verzweiflung getrieben werden. All das dokumentierte Bühler: die leeren Gesichter, die hängenden Köpfe, die fragenden, verständnislosen Blicke. Seine selbst gewählte Aufgabe hatte noch einen weiteren Effekt: Während er eine Zeichnung nach der anderen von Personen und Gruppen anfertigte, verfeinerte er seine Technik und entwickelte sich zu einem bildenden Künstler von beträchtlichem Niveau.
Da nach zwei Jahren Aufenthalt in der Illenau keinerlei Besserung seines Zustandes zu erkennen war, wurde entschieden, den selbsternannten »sanitätspolizeilichen Beamten« in eine Anstalt für Unheilbare nach Emmendingen in der Gegend von Freiburg im Breisgau zu verlegen. Er war froh, dass er gehen konnte, erklärte er seinen Ärzten, denn das Ministerium in Baden habe ihm den Auftrag erteilt, eine neue Gruppe von Insassen zu beobachten und zu katalogisieren. Am 17. April 1900 traf er in der neuen Anstalt ein. Und wahrscheinlich hätte die Außenwelt nie mehr etwas von Franz Karl Bühler gehört, wäre da nicht der Mann gewesen, der ihm zwanzig Jahre später einen Besuch abstattete.
2
Hypnose im Wald
Im Alter von 32 Jahren war Hans Prinzhorn gleichzeitig fertig ausgebildeter Arzt, promovierter Kunsthistoriker, dekorierter Kriegsveteran und, als wäre das nicht genug, auch noch ein professionell ausgebildeter Sänger mit einem Bariton, der sein Publikum zu Tränen rühren konnte. In späteren Jahren erweiterte er seinen eindrucksvollen Lebenslauf um Stationen als Psychotherapeut, Schriftsteller, Dozent, Vorkämpfer des Volkes der Navajo, als Übersetzer der Werke von D. H. Lawrence und André Gide. Doch sein größtes, langfristig wirkendes Verdienst sollte die in Heidelberg geleistete Arbeit zur Kunst der psychisch Kranken werden. Mit Prinzhorns Hilfe wurde der Wahnsinn ein Vergrößerungsglas zur Betrachtung der Schrecken des Ersten Weltkrieges und ein Mittel zur Erforschung der von Sigmund Freud entdeckten Sphären der Psyche, die jeder Mensch in sich trägt.
Im Januar 1919 – der Waffenstillstand war erst zwei Monate zuvor unterzeichnet worden – trat Prinzhorn seinen Dienst in der Psychiatrischen Klinik der Universität Heidelberg an. Mit seiner jungen Familie bezog er ein Haus in der Neuen Schlossstraße. Tochter Ursula war noch ein Kleinkind und seine Frau Erna mit einem zweiten Mädchen schwanger, das sie Marianne nennen wollten. Die Straße wand sich in Serpentinen einen steilen Berg hinauf und war von pseudo-herrschaftlichen Villen gesäumt, zu deren Schmuckwerk Zinnen, Wappen und sogar ein Ritter in voller Rüstung gehörten, all das aus dem roten Sandstein der Gegend gehauen. Aus ihren Fenstern konnten die Prinzhorns über die Stadt schauen, eine pittoreske Ansammlung von roten Ziegeldächern und Kirchtürmen, die sich zwischen dem rasch dahinschießenden Neckar und dem Hang des Königstuhls zusammendrängten. Seit über einem Jahrhundert wurden Dichter und Maler von diesem zentralen Ort der deutschen Romantik angezogen, stiegen auf die grünen Berge, um den herrlichen Blick auf die Burgruine, den Odenwald und den Fluss im Spiel von Licht und Schatten zu genießen. Heidelberg war eine Stadt der Studenten, die für Philosophie oder Poesie schwärmten und Bootsfahrten unternahmen, ein Ort für Liebende, die sich bei langen Spaziergängen in den märchenhaften Wäldern ergingen. Mark Twain, der hier ein Jahr verbrachte und sich mit den Abenteuern des Huckleberry Finn abplagte, beschrieb die Stadt als »die letzte Möglichkeit des Schönen«.
Nach einem Fußmarsch von dreißig Minuten erreichte man die Universitätsklinik, einen Komplex massiver Gebäude im imperialen Stil, der sich auf einem flachen Gelände zwischen Bahnhof und Fluss ausbreitete. Die vierstöckige Psychiatrische Klinik wirkte zu jener Zeit recht heruntergekommen. Schon vor dem Krieg war dort kaum noch investiert worden, und nun standen Sanierungsmaßnahmen für mehrere Millionen Mark an. Nach wie vor galt sie jedoch weltweit als der Ursprungsort der modernen Psychiatrie. Im Jahre 1898 hatte Emil Kraepelin, ein ehemaliger Direktor, hier die alte Klassifizierung der psychischen Krankheiten auf zwei reduziert: die manisch-depressive Psychose und die Dementia praecox, später als Schizophrenie bekannt. Dies war außerdem der Ort, an dem Karl Jaspers sein bahnbrechendes Werk der theoretischen Psychiatrie, Allgemeine Psychopathologie, verfasst hatte. »Ohne diese Klinik und diese Männer«, schrieb Jaspers, wäre dieses Werk »nie entstanden«.
Prinzhorn betrat die Klinik vom Botanischen Garten her durch einen mächtigen Portikus und nahm die wenigen Stufen zur Empfangshalle mit den typischen Geräuschen einer psychiatrischen Heilanstalt jener Zeit, als es gegen psychische Krankheiten noch keine Medikamente gab. Wie überall in Deutschland waren die Patienten in verschiedenen Abteilungen, nach Geschlecht und Zustand getrennt, untergebracht. Während die »Unruhigen« in einem separaten Haus weitab vom Eingang lebten, lagen die »Halbruhigen« und »Ruhigen« in den Zimmern an den langen Korridoren des Hauptgebäudes, die Frauen links, die Männer rechts.
Prinzhorn fand seinen Platz im Dachgeschoss, einem Labyrinth aus kleinen Kammern und Büros, die durch die mächtigen hölzernen Dachsparren voneinander getrennt waren. Die Räume teilten sich die niederen Angestellten mit einer Gruppe Nonnen, die während des Krieges als Aushilfskräfte hierhergekommen waren. Als Prinzhorn sich ein wenig eingelebt hatte, wandte er sich einem Problem zu, das ihn seit Monaten umtrieb: Er wollte eine Sammlung psychiatrischer Kunst anlegen, die zu der größten werden sollte, die die Welt je gesehen hatte.
Prinzhorn war in einigen Fragen radikal, in anderen konservativ und in manchen beides zugleich. Später einmal sollte er sich selbst als »Revolutionär für ewige Dinge« beschreiben. Die höchste Wertschätzung seiner Person stammt von dem amerikanischen Psychologen David L. Watson, für den er »einer der bedeutendsten Literaten unserer Zeit« war, von so noblem Charakter, dass er mit dem Dichter John Keats zu vergleichen sei. Mit seiner Tiefe, schrieb Watson, und mit einer Güte, die auf Stärke und nicht auf Schwäche beruhte, habe Prinzhorn Nietzsches Ideal vom Menschen des 20. Jahrhunderts verkörpert. Er werde einen »herausragenden Beitrag zur ideellen Führung unserer [menschlichen] Rasse« leisten. Jene, die Prinzhorn besser kannten, wiesen auf weniger schmeichelhafte Züge hin. Er neige zu heftiger Opposition. Er leide an Eitelkeit. Er sei psychisch labil und von beinahe krankhafter Ruhelosigkeit. Später sollte er diese Eigenschaften seinen Eltern und seiner Erziehung in der ländlichen Kleinstadt Hemer in Westfalen zuschreiben, wo er am 6. Juni 1886 geboren wurde.
Hans Prinzhorns Vater Hermann war ein Selfmademan, der im Deutsch-Französischen Krieg von 1870 das ländliche Sachsen verlassen und danach bei einer Papierfabrik in Hemer Arbeit gefunden hatte. Dort legte er einen Aufstieg vom Arbeiter bis zum Teilhaber hin. Hermann heiratete Julie Varnhagen, die Tochter des Pfarrers am Ort, mit der gemeinsam er eine auf Glauben, Selbstdisziplin und wirtschaftlicher Vernunft beruhende bürgerliche Existenz aufbaute. Hans beschrieb seinen Vater Hermann als einen Haustyrannen, einen »dumpf Drohenden«, einen »Schleuderer absoluter Blitze«. Noch härter beurteilte er seine Mutter Julie, die er als eine Art schwarzes Loch empfand. Er konnte sich nicht erinnern, jemals Freundlichkeit von ihr erlebt zu haben. Dazu schrieb er: »Schlimmer ist, dass ich eine Mutter im seelischen Sinne, den Inbegriff alles schlichten Seins, aller Geborgenheit und die Pforte zum All – nie ›gehabt‹, nie erlebt habe.« Die Vorstellung, er hätte sie je um Hilfe bitten können, erschien ihm geradezu grotesk.
Trotz alledem vererbten die Eltern Hans, dem dritten ihrer fünf Kinder, gewisse Vorzüge. Einer war die Musikalität der Mutter. Sie hatte eine schöne, volle Singstimme, und wenn sie im Haus erklang, schlüpfte er ins Wohnzimmer, wo das Klavier stand, holte sich eine Fußbank und hörte beglückt zu. Ein weiteres Geschenk war sein gutes Aussehen. Prinzhorn war ein hochgewachsener junger Mann mit feinen Gesichtszügen und blondem gewelltem Haar, das eine hohe Stirn und einen intelligenten Blick aus blassen Augen freigab. Zwar scheiterten mehrere seiner Beziehungen, doch er blieb nie lang allein. Sex begann für Hans bereits im Alter von zehn Jahren mit einem ebenso frühreifen Mädchen auf einer Waldwiese. Weiter ging es mit einer langen Folge von Jungen, die er nach dem Unterricht traf, um gemeinsam zu masturbieren. Zugleich entwickelte er eine Besessenheit für den Tod, die ihn zum Schlachthaus des Dorfes zog. Dort versteckte er sich zwischen Bottichen mit dampfendem Blut, um zuzusehen, wie das Vieh abgestochen wurde und der durchdringende Gestank vom Spülen der Gedärme den Raum erfüllte. Es war eine grausige Vorahnung seines Kriegsdienstes. »Blut und Töten […] gewannen eine schaurige Gewalt über mich«, erinnerte er sich später.
Die Prinzhorns waren eine gebildete Familie. Hans fiel das Lernen leicht, es hatte für ihn »durchaus Spielcharakter«. Als es ihm gelungen war, die Versuche seines Vaters abzuwehren, einen Geschäftsmann aus ihm zu machen, wurde ihm gestattet, seinen kulturellen Interessen an Deutschlands besten Universitäten nachzugehen. Er begann in Tübingen, wo er sich in Kunstgeschichte und Philosophie einschrieb. Doch schon nach einem Semester wechselte er nach Leipzig, wo er bei dem berühmten Kunsthistoriker August Schmarsow studierte. Drei Semester später war er wieder unterwegs. Diesmal ging es nach München, wo der Philosoph und Psychologe Theodor Lipps lehrte. Prinzhorn kam im Frühjahr 1906 im Alter von neunzehn Jahren in die bayrische Hauptstadt, bereit für die dynamischste Phase seines Lebens.
München stand zu jener Zeit als eines der glanzvollsten Kulturzentren Europas auf einer Stufe mit Paris und Wien. Vor allem war es eine Stadt der Kunst. So beschrieb es Thomas Mann: »Die Kunst blüht, die Kunst ist an der Herrschaft, die Kunst streckt ihr rosenumwundenes Zepter über die Stadt hin und lächelt.« Unter seinem berühmten kobaltblauen Himmel rollten bekannte Maler mit ihren Geliebten in offenen Kutschen dahin, nahmen die Jubelrufe der Passanten und die Bewunderung der Polizisten entgegen. Junge Männer in runden Künstlerhüten und lockeren Krawatten flanierten durch die Stadt, pfiffen Wagner-Motive, suchten Liebe, Sex und Inspiration, während aus geöffneten Fenstern der Klang von Celli und Geigen ertönte. Das Künstlerviertel der Stadt war Schwabing, ein Nährboden für Experimente, wo es in jedem fünften Haus ein Atelier gab. Dramatiker, Avantgardisten, Sozialisten und konservative Revolutionäre füllten die Salons, wo sie sich um die charismatischsten Figuren scharten – den Dichter Stefan George, den Mystiker Alfred Schuler oder den Philosophen Ludwig Klages – und Theorien und Ideologien schufen. Ihre Ideen wurden nicht überall begrüßt und hatten doch Erfolg. Nicht zufällig brachte die Stadt eine ganze Reihe modernistischer Kunstbewegungen hervor, darunter die Münchner Sezession, die Phalanx, die Neue Künstlervereinigung München und den Blauen Reiter.
Wie Prinzhorn an seinen Vater schrieb, fand er in München »mehr als ich geglaubt habe von allem, was mir wünschenswert erschien«. Mit Freunden gründete er einen Kunstverein, organisierte Festivals und Aufführungen, bei denen er zuweilen selbst auftrat. In Wiener Zeitungen schrieb er über Ausstellungen, ging ins Theater und in die Oper, genoss gierig neue Inszenierungen der Werke von Ibsen und Wagner. Er lernte Nietzsches Philosophie kennen (die Vater Hermann als »gefährlich« beschrieb) und hatte Dutzende Freunde in Künstlerkreisen, vom Dirigenten Wilhelm Furtwängler bis zum Maler Hans Schwegerle. Letzterer verewigte Prinzhorns jugendliche Euphorie in einem Porträt. Nackt in einem langen Mantel, einen Hut auf dem Kopf und eine Leier im Arm, ist er halb Apollo, halb Orpheus.
»Tübingen gab mir Frische, Leipzig neue Wege, München den nötigen Mut«, schrieb Prinzhorn an seine Eltern. Im Rückblick auf diese Jahre erklärte er später: »Eine reichere Zeit kann kaum noch kommen.«
1908 schloss er seine Dissertation über den Architekten Gottfried Semper ab. Zu dieser Zeit lernte er Eva Jonas, die Tochter eines reichen jüdischen Anwalts aus Berlin, kennen und heiratete sie 1909. Er begann fünf Jahre Gesangsunterricht zu nehmen, um ein ausgebildeter Bariton zu werden. Während seines Studiums am Leipziger Konservatorium kam er zum ersten Mal mit einer schweren psychischen Krankheit in Berührung.
Im Frühjahr 1910 nahm sich einer der Gesangslehrer der Hochschule drei Tage vor seiner geplanten Heirat mit Prinzhorns Mitstudentin Erna Hoffmann das Leben. Die Braut stürzte in eine so tiefe Depression, dass sie in eine Klinik eingewiesen werden musste. In den nächsten zwei Jahren, in denen Prinzhorn alles tat, um sie aus einer ganzen Folge von Krisen zu retten, kamen sich beide zunehmend näher. 1912 ließ sich Prinzhorn von Eva scheiden und heiratete Erna. Doch bereits zwei Wochen nach der Hochzeit erlitt Erna einen schweren Rückschlag und wurde zu einem Pflegefall. Prinzhorn musste jede Hoffnung auf eine Sängerlaufbahn begraben. Stattdessen, so berichtete er seiner Schwester Käthe, »bin ich zu dem Schluss gekommen, einen rechtschaffenen Beruf anzugehen, in dem man unzweifelhaft Gutes tun muss«. Er wollte Arzt werden. Prinzhorn brachte Erna in dem exklusiven Sanatorium Bellevue in der Schweiz unter und ging dann nach Freiburg im Breisgau, um ein Medizinstudium aufzunehmen.
Als im Sommer 1914 der Krieg ausbrach, befand er sich nach wie vor dort. Er wurde sofort als Sanitäter eingezogen. Eine zufällige Begegnung während des Krieges führte Prinzhorn zu der Aufgabe, die ihm einen Platz in der Kunstgeschichte sichern sollte.
Karl Wilmanns war ein Militärarzt von hohem Rang, der in Südwestdeutschland mehr als 40 000 Krankenhausbetten für den Kriegsbedarf organisiert hatte. Im zivilen Leben war er Psychiater. Seine Ausbildung hatte er in der Heidelberger Klinik unter Kraepelin erhalten. Wilmanns war von einer kleinen Sammlung Patientenkunst fasziniert, die Kraepelin in seinen Lehrveranstaltungen einsetzte. Er grübelte darüber nach, wie man sie noch weiter nutzen könnte, und dachte zunächst daran, gemeinsam mit anderen Forschern Einzelfälle zu studieren, um aus den Bildern und Zeichnungen Schlüsse für die weitere Behandlung der betroffenen Patienten zu ziehen. Als Wilmanns Prinzhorn Ende 1917 in einem Lazarett bei Straßburg begegnete, kamen beide bald auf die von psychisch Kranken hergestellten Bilder und Gegenstände zu sprechen sowie auf die Denkprozesse, die diesen zugrunde lagen. Mit seiner medizinischen und kunsthistorischen Ausbildung war Prinzhorn ungewöhnlich qualifiziert dafür, an solchen Problemen zu forschen: In seiner Dissertation hatte er sich bereits kurz mit der Psychologie des Kreativen beschäftigt und ähnliche Probleme mit Malerfreunden und dem Direktor des Sanatoriums Bellevue, Ludwig Binswanger, diskutiert. Wilmanns, der die Gabe hatte, Talente früh zu erkennen, fragte den jungen Sanitäter, ob er interessiert sei, sich mit den in Heidelberg gesammelten Arbeiten zu beschäftigen. Prinzhorn lehnte zunächst ab, weil er annahm, die Sammlung sei zu klein und unbedeutend. Doch die Idee setzte sich in seinem Kopf fest, und er nahm sie mit an die Front.
Im Sommer 1918 wurde Prinzhorn an die Marne befohlen, wo er bei der letzten deutschen Großoffensive in diesem Krieg einen mobilen Verbandsplatz leiten sollte. In den Morgenstunden des 15. Juli, es war ein Montag, hockte er in einem Schützenloch in einem Wald westlich von Reims inmitten von 52 deutschen Divisionen, die zum Sturm bereit waren. Kurz nach Mitternacht eröffnete die Artillerie ringsum mit ohrenbetäubendem Dröhnen den Beschuss. Der Feind antwortete, und bald erinnerte das Geschehen um ihn herum an ein »Höllenfest«. Um drei Uhr morgens rückte seine Einheit in knöcheltiefem Morast durch den stockdunklen Wald vor. Prinzhorn musste einen Weg zwischen den Geschützstellungen finden, die pausenlos Blitz und Donner spien. Als er den Waldrand erreichte, erhielt er offene Sicht auf den Fluss und das von den Sternen und farbigem Geschützfeuer erleuchtete Schlachtfeld:
»Im dunstigen Grunde leckten matte Flammen aus Dormans, in das vor kurzem mit einem Schlag eintausend Minen gegangen waren. Der Feuerschein erhellte eine Flusswindung – und ringsum erkannte man nun deutlich die Gestalt der Hänge an unzählig aufblitzenden Mündungsfeuern.«
Als sich im Osten trübes Morgenlicht zeigte, drängte Prinzhorn mit seiner Einheit unter pausenlosem Sperrfeuer in Richtung Marne vor. Unvermittelt tat es kaum zehn Meter hinter ihm einen gewaltigen Schlag. Er spürte, wie es ihm das linke Bein hochriss, und stieß einen Schmerzensschrei aus. Als er, im Schlamm liegend, nach der Wunde tastete, konnte er nur eine Prellung feststellen, rappelte sich wieder auf und humpelte zur nächsten Deckung. Einer Ohnmacht nahe, untersuchte er das Bein noch einmal und sah, dass »der rote Saft fließt«. Von einem Sanitäter gestützt, schleppte er sich zwischen dröhnenden Haubitzen weiter nach hinten. Sechs Tage später lag er bereits zwischen frischen Laken im Victoria-Hotel von Wiesbaden. Für ihn war der Krieg vorbei. Man verlieh ihm das Eiserne Kreuz erster Klasse.
Seit der Begegnung mit Wilmanns ging Prinzhorn ihr Gespräch nicht aus dem Kopf. Schließlich schrieb er dem Psychiater und schlug vor, das Problem an möglichst breiter Front anzugehen. Sie sollten andere Anstalten und Kliniken zu überzeugen versuchen, ihnen Material zur Verfügung zu stellen. Wilmanns stimmte zu. Als der Krieg in diesem Winter einem unbestimmten Ende entgegentaumelte, wurde der Psychiater zum Direktor der Heidelberger Klinik ernannt. Ohne Zeit zu verlieren, bot er seinem jungen Bekannten eine Stelle für die Erweiterung der Kunstsammlung an. Nur wenige Wochen nach seiner Demobilisierung zog Prinzhorn im Januar 1919 in die Universitätsstadt am Neckar, um dort den Dienst als Assistenzpsychiater anzutreten.
Im Frühjahr 1919, dem fünften Kriegsfrühling, wie der junge Bertolt Brecht diese Zeit nannte, war Deutschland geschlagen, gedemütigt und zusammengebrochen. Vor allem war es hungrig. Die Lebensmittelblockade der Alliierten blieb nach Unterzeichnung des Waffenstillstands weitere acht Monate in Kraft. Im Land brach eine Hungersnot aus, die bis zum nächsten Sommer anhalten sollte. Es mussten schlimme Entscheidungen darüber getroffen werden, wer etwas zu essen bekam und wer nicht. Die Insassen der psychiatrischen Anstalten standen ganz am Ende der Schlange. Was sie bekamen, war kaum verdaulich, es fehlte an Getreide, Fleisch und Fett. Aufgrund der schlechten Ernährung wurde eine banale Infektion zur tödlichen Gefahr. Von 1914 bis 1919 starben dreißig Prozent der Patienten in Deutschlands Pflegeeinrichtungen, das waren 70 000 Menschen, an Hunger, Krankheiten oder Vernachlässigung. Die bewusste Bevorzugung der Gesunden gegenüber den Kranken sollte weitreichende Folgen haben. Karl Bonhoeffer, der Vorsitzende des deutschen Vereins für Psychiatrie, formulierte es so:
»Fast könnte es scheinen, als ob wir in einer Zeit der Wandlung des Humanitätsbegriffs stünden. Ich meine nur […], dass wir unter den schweren Erlebnissen des Krieges das einzelne Menschenleben anders zu bewerten genötigt wurden […] und dass wir uns damit abfinden mussten zuzusehen, dass unsere Kranken in Anstalten in Massen an Unterernährung dahinstarben, und dies fast gutzuheißen in dem Gedanken, dass durch diese Opfer vielleicht Gesunden das Leben erhalten bleiben könnte.«
Während Bonhoeffer vor der Gefahr warnte, die Lage eskalieren zu lassen, sahen andere darin eine Gelegenheit, dem geschlagenen und verarmten Staat eine ökonomische Last abzunehmen. In ihrem Pamphlet Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens entwickelten Karl Binding und Alfred Hoche einen Plan zur vermehrten Tötung bestimmter Typen von Psychiatriepatienten durch »unfreiwillige Euthanasie«. Für Binding, einen Juristen im Ruhestand, waren diese »unheilbar Blödsinnigen […] nicht nur absolut wertlose, sondern negativ zu wertende Existenzen«, »die das furchtbare Gegenbild echter Menschen bilden und fast in Jedem Entsetzen erwecken, der ihnen begegnet.« Hoche, ein Professor der Psychiatrie in Freiburg, suchte dem Traktat etwas medizinischen Glanz zu verleihen, indem er behauptete, diese Patienten stünden »auf einem intellektuellen Niveau, das wir erst tief unten in der Tierreihe wiederfinden.« »Der durchschnittliche Aufwand für die Pflege der Idioten« habe »bisher 1300 M. pro Kopf und Jahr betragen«, argumentierten die beiden Verfasser, wodurch »ungeheures Kapital […] dem Nationalvermögen […] entzogen« werde. In dieser schwierigen Lage sei es gerechtfertigt, dass Deutschland sich solcher »Ballastexistenzen« entledige.
Binding und Hoche führten den Terminus »lebensunwertes Leben« in den Diskurs über die Behandlung psychischer Krankheiten ein und traten damit eine Debatte unter Psychiatern, Theologen und Rechtsanwälten los, die weit mehr als ein Jahrzehnt anhalten sollte. Einige unterstützten Bindings und Hoches Idee und schlugen Details zu ihrer Ausführung vor, doch viele wandten sich dagegen. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Empfehlungen des Pamphlets jedoch zunächst nicht realisiert.
Die psychisch Kranken waren nicht die Einzigen, die auf Sparrationen saßen. Überall im Land waren die Tagträume der Menschen nur noch vom Essen erfüllt. Carl Zuckmayer, ein Kriegsveteran und Dichter, der sich in denselben Heidelberger Kreisen bewegte wie Prinzhorn, erinnerte sich an einen »irren Hunger« im Frühjahr 1919, geradezu ein Gelüst nach Süßigkeiten und Alkohol. Seine Freunde und er sehnten sich nach den Dosen klebriger, gesüßter Kondensmilch, die mit den Sendungen ausländischer Hilfe ankamen, und als Gipfel des Nahrhaften galt eine Büchse Corned Beef. Alkohol jeglicher Art, dessen sie habhaft werden konnten, darunter saurer Wein und in staatlichen Destillen aus Kartoffelschalen hergestellter Schnaps, wurde genossen, bis ihnen der »Schädel rauchte«. Auch Kleidung war knapp. Das einzige Gewebe, das es im Überfluss gab, war grau-grüner Uniformstoff, aus dem man nun Anzüge herstellte. Jedoch all die Entbehrungen konnten die Hochstimmung der Kriegsveteranen nicht trüben, denn wenn sie morgens aufwachten, wussten sie, dass man nicht auf sie schießen werde, und wenn sie abends zu Bett gingen, waren sie sicher, nicht von Alarm aus dem Schlaf gerissen zu werden. »Wir hatten das Leben«, erinnerte sich Zuckmayer, »und wir wollten es nutzen und auskosten bis zur Neige mit all unserer aufgesparten Kraft.«
In einer ähnlich befreiten Stimmung befand sich auch Prinzhorn. Eine Generation junger Männer hatte man gezwungen, ins Schussfeld der Kanonen zu marschieren, und wofür? Deutschlands Niederlage zeigte, dass das Sterben vergeblich gewesen war. Nun stand alles infrage – vom Glauben an den menschlichen Fortschritt bis zur Vernunft selbst. Prinzhorn »war allen Kulturformen gegenüber im tiefsten Nihilist«. Keine Religion oder Ideologie bot ihm eine Anschlussmöglichkeit oder gar Unterstützung. Er war »von allen derartigen Bindungen so frei, wie es im Heutigen überhaupt möglich ist«. Entschlossen, »in der lebendigen Schwingung zu anderen Lebewesen, zur Natur und zu Menschenwerk […] den echten Lebensgrund zu erkunden«, stürzte er sich in seine neue Aufgabe.
Die Sammlung, die Prinzhorn in der Heidelberger Klinik vorfand, war klein; wahrscheinlich bestand sie nur aus mehreren Dutzend nach der Diagnose geordneten Stücken. Wilmanns hatte für Prinzhorn bereits ein paar Zeichnungen zum Anschauen ausgewählt. Stellung und Ruf des Professors sollten ihm Zugang zu anderen Anstalten verschaffen. Doch es war Prinzhorn, der das Problem formulierte. Das tat er in einem ersten Rundbrief an die Direktoren psychiatrischer Einrichtungen, zwei knappen Absätzen auf einem DIN‑A4‑Bogen. Der erste Satz lautete:
»Sehr geehrter Herr Kollege,
die darstellende Kunst Geisteskranker ist zwar wiederholt schon Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung gewesen. Der Stoff, aus dem die bisherigen Ergebnisse gewonnen wurden, war jedoch beschränkt.«
Wenn Einrichtungen bereit wären, Malereien, Zeichnungen und Skulpturen ihrer schizophrenen und paranoiden Patienten zu schicken, dann dürfe »wohl erwartet werden, dass ein reichhaltigeres Material zur Grundlage einer Untersuchung gemacht werden könnte«. Die Heidelberger Klinik sei bereit, alle Kosten zu übernehmen, und benötige die Arbeiten nur für kurze Zeit, wonach man sie unversehrt zurückgeben werde. Zudem wäre es außerordentlich nützlich, wenn auch die Patientenakten der Schöpfer übersandt werden könnten. Sollte von dem Material etwas veröffentlicht werden, versprach Prinzhorn, zuvor die Genehmigung einzuholen.
Mit Wilmanns schöner Unterschrift versehen, wurde dieser Brief Mitte Februar an psychiatrische Anstalten in ganz Deutschland verschickt. Die Antwort kam schnell und war geradezu überwältigend. Künstlerische Betätigung von Psychiatriepatienten gab es in Krankenhäusern des ganzen Landes, und nun flatterten die Früchte ihrer Arbeit in Prinzhorns Bodenkammer. Mit der Zeit dehnte er seine Erkundungen immer weiter aus. Nach und nach ging Material aus ganz Europa und sogar aus Lateinamerika und Japan bei ihm ein. Doch die ersten und ergiebigsten Quellen waren Heilanstalten in der deutschsprachigen Welt. Von dort kamen Arbeiten aller nur vorstellbaren Arten und Materialien. Neben Zeichnungen und Malereien waren es Collagen, Musikstücke oder handgeschriebene Bücher. Etwas bessergestellte Patienten arbeiteten mit Skizzenblöcken, Tagebüchern oder Leinwand. Andere benutzten Zeitungspapier, Gewebe, leere Papiertüten, Toilettenpapier und alles, was sie in Papierkörben fanden – Essen- und Pflegepläne, benutzte Briefumschläge oder aus Zeitschriften gerissene Seiten. Skulpturen wurden aus gekautem Brot geformt oder aus altem Möbelholz geschnitzt. Das gängigste Zeichengerät war der Tintenstift des medizinischen Personals, der sich lila färbte, wenn er angeleckt wurde. Aber auch Wasser- und Pastellfarben, Lebensmittelfarben und Tusche kamen zum Einsatz. Manche Stücke waren lackiert, gekalkt oder übermalt, um ihren Sinn zu verschleiern. Es gab Selbstporträts, Landschaften, Bilder von Innenräumen, Texte und Tattoos.
Als immer mehr Material eintraf, katalogisierte Prinzhorn es nach Inhalt und Form. Jeder Künstler erhielt eine Nummer. Prinzhorn versuchte, die Arbeiten so sorgfältig aufzubewahren, wie es sein schmales Budget hergab, und hängte Bilder in Rahmen auf. Die wachsende Sammlung zeichnete sich durch enorme Vielfalt und überraschende Qualität aus. Sie war nicht nur von medizinischem Interesse, sondern, wie Prinzhorn feststellte, auch von künstlerischem Wert. Er unterhielt eine lebhafte Korrespondenz mit den Einrichtungen, die er ermutigte und unterstützte, wo er nur konnte.
Typisch für sein Engagement war der Austausch mit Dr. Carl Hermkes, dem Direktor der Anstalt Eickelborn in Westfalen. Am 1. März 1919 schickte Hermkes eine Auswahl von Zeichnungen und Plastiken seiner Patienten, darunter Arbeiten des Gastwirts Peter Meyer und eines ehemaligen Bauhandwerkers namens Karl Genzel. Prinzhorn war von den Arbeiten beeindruckt und fragte bei Hermkes an, ob er so nett sein könnte, Genzel und Meyer zur Fortsetzung ihrer Arbeit zu ermutigen. Prompt traf im Mai eine weitere Plastik Genzels ein, eine kleine dickbäuchige Holzfigur mit Rüstung, Krone und einem Offiziersschnurrbart ausgestattet, die Prinzhorn an Schnitzereien der Ureinwohner Neuguineas erinnerte, aber gleichzeitig auch als der Feldmarschall und Kriegsheld Paul von Hindenburg zu erkennen war. Genzel hatte besonders Hindenburgs »dicke Backen« hervorgehoben. »Die großen Ohren hat er, weil er alles hören muss, die Nase steht nach vorn, weil er alles riechen muss«, erklärte Genzel. Es war nicht leicht, allem zu folgen, was Genzel über seine Arbeiten äußerte. Doch ein Satz hob sich für Prinzhorn von dem Übrigen ab: »Wenn ich ein Stück Holz vor mir habe, dann ist da drin eine Hypnose – folge ich der, so wird etwas daraus – sonst aber gibt es einen Streit.«
Meyer arbeite währenddessen an einem Gemälde mit dem Titel »Die zehn Gebote«, schrieb Hermkes: Zurzeit wolle er nur religiöse Werke schaffen. Für Genzel bat er um etwas Ton und Farben, die selbst zu beschaffen er nicht in der Lage war.
Werden auch Öl- oder Wasserfarben gebraucht?, fragte Prinzhorn zurück und erkundigte sich, woher dieser Künstler seine Inspiration bezog. Hatte er Skulpturen aus Afrika gesehen? Kannte Meyer, der in Köln und Münster mit ihren großen Kathedralen gelebt hatte, die Buntglasfenster, an die seine Arbeiten erinnerten? Selbst wenn er das hatte, hielt Prinzhorn dessen selbstständige Arbeiten für erstaunlich. Die Heidelberger baten Hermkes erneut, die Männer zu weiterem Schaffen anzuregen, und versprachen sogar, dafür einen kleinen Geldbetrag aufzutreiben. Hermkes schlug Kautabak für Genzel und ein Anerkennungsschreiben für Meyer vor, was beide Männer wahrscheinlich zu weiterer Tätigkeit anregen werde.
Bei etwa drei Vierteln von Prinzhorns Patienten-Künstlern war Schizophrenie diagnostiziert worden. Die übrigen galten als manisch-depressiv, gelähmt, geistig behindert oder epileptisch. Obwohl über die Hälfte der Patienten in deutschen Anstalten weiblich war, stammten weniger als zwanzig Prozent der Arbeiten, die bei Prinzhorn eingingen, von Frauen. Das spiegelte ihre Stellung in der Gesellschaft wider, war aber auch einem engen Kunstbegriff geschuldet, der viele traditionell weibliche Handarbeiten ausschloss. Eine Ausnahme war Agnes Richters Jäckchen. Die Dresdnerin hatte man 1893 eingewiesen, nachdem sie wegen Ruhestörung verhaftet worden war. In der Heilstätte Hubertusberg begann sie, an einem Kleidungsstück aus dem grauen Leinen der Anstalt zu nähen, wobei sie die Ärmel von links mit Schriftzügen bestickte, in denen sie ihren Nöten Ausdruck gab. »Ich bin nicht groß«, lautete einer, »meine Jacke«, »Ich bin«, »Ich habe«, »Heute fehlt mir« oder »Du musst nicht« war anderswo zu lesen. Immer wieder tauchte ihre Wäschenummer 583 auf. Die Stickereien befanden sich hauptsächlich im Inneren des Kleidungsstücks, das ihrem Körper am nächsten war – offenbar ein Versuch, ihr Selbstgefühl zu stärken, das an einem Ort wie diesem leicht verloren gehen konnte. Die Jacke war Agnes Richters einzige Arbeit in der Sammlung.
Mit einigen Arbeiten war auch Katharina Detzel vertreten, ein starker Charakter in der Anstalt Klingenmünster. Dort hatte man sie eingeliefert, nachdem sie 1907 als politischen Protestakt Sabotage an einem Eisenbahngleis verübt hatte. Sie wehrte sich gegen die »Strafbehandlung« durch die Ärzte und unternahm mehrere Fluchtversuche. Sie schrieb ein Buch und ein Theaterstück. Später begann sie, aus zerkautem Brot winzige Figuren zu formen, und ging nach und nach zu festerem Material über. Ihr erstaunlichstes Stück war eine Plastik in Lebensgröße mit männlichen Genitalien, die sie »Mann« nannte.
Allmählich schälten sich die Themen der Arbeiten deutlicher heraus. Eines betraf die nahezu übernatürliche Kraft der Maschinen. Jakob Mohr, ein Bauer mit der Diagnose Schizophrenie, zeichnete ein teuflisches Gerät, das unsichtbare Wellen aussandte. Nach seiner Meinung lösten sie die seltsamen Visionen und Empfindungen aus, von denen er heimgesucht wurde. Der Weber Gustav Sievers erfand einen »Fallschützenwebstuhl«, von dem er behauptete, er werde das Leben auf der Erde in den kommenden dreitausend Jahren verändern. Seiner Erfindung wurde sogar ein Patent gewährt. Sievers beschäftigte sich auch damit, das erotische Potenzial von Fahrrädern zu untersuchen, indem er vollbusige Damen zeichnete, die damit hin und her fuhren: In Anstalten, wo Männer und Frauen sich nicht begegnen durften, boten sexuelle Phantasien ein reiches Betätigungsfeld. Joseph Schneller, ein Zeichner bei der Bayrischen Eisenbahn, der an Paranoia litt, malte verschiedene pornografische »Reiz-Chicanen«, wie er sie nannte. Er schuf sogar ein opus magnum, das er »sadistisches Lebenswerk« taufte. Es enthielt umfangreiche, detaillierte Pläne von Einrichtungen, wo Sex stattfinden konnte, samt den dafür erforderlichen speziellen Gerätschaften.
Andere Künstler erlebten königliche Illusionen. Else Blankenhorn, Tochter einer reichen Karlsruher Familie, verbrachte viele Jahre im Sanatorium Bellevue, wo sie umfangreiche Phantasien entwickelte, in denen sie Else von Hohenzollern, die eingebildete Gemahlin von Kaiser Wilhelm II., war. Als deren Mission sah sie es an, verstorbenen Paaren zur Rückkehr ins Leben zu verhelfen. Dieses aufwändige Geschäft finanzierte sie dadurch, dass sie hochdotierte Banknoten malte. Außerdem schuf sie zahlreiche schöne Ölbilder in lichten Farben, die von van Gogh und Edvard Munch beeinflusst schienen. Auf ihnen ist häufig eine junge Frau zu sehen, die frei durch eine expressionistische Landschaft schwebt.