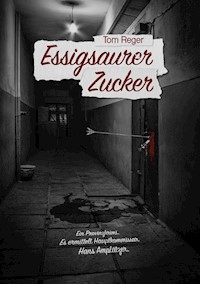9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zwei oberbayerische Gemeinden, Hubenstein und Moosen, geraten in den Fokus der Bayerischen Staatsregierung. Die beiden 'Zwerggemeinden' sollen per Regierungsbeschluss zusammengelegt werden. Die Staatskasse ist nach dem 1. Weltkrieg klamm. Die kommunale Selbstverwaltung soll reformiert werden. Dagegen regt sich erbitterter Widerstand, der seit Generationen zerstrittenen Nachbargemeinden. Alte Wunden brechen auf. Argwohn, Misstrauen und handgreifliche Auseinandersetzungen greifen um sich. Plötzlich verschwindet ein Bürger spurlos. War es Mord? Der Flusslauf im Vilstal wird für die nachkriegsgeplagte Bevölkerung zur natürlichen Konfliktlinie. Trotz der Uneinigkeit wird ein Vertreter des Bezirksamts Erding bei einer Versammlung aus Moosen gemeinsam verjagt. Ein Handeln in Eintracht gegen die Obrigkeit bleibt allerdings schwierig. Nur dem Geschick der beiden Bürgermeister ist es zu verdanken, dass ein Gerichtsverfahren gegen die Bayerische Regierung erfolgen kann. Die Bürgermeister der rivalisierenden Gemeinden haben einen Balanceakt zwischen einer feindseligen Gegenwart und einer hoffnungs-vollen Zukunft zu meistern. Der hiesige Pfarrer und christliche Hirte sieht mit Sorge auf seine Schäfchen und hat dabei eigene Kriegstraumata zu bewältigen. Der neue junge Schullehrer am Ort ist nicht nur für die Schüler eine Bereicherung. Seine Leidenschaft ist die regionale Geschichte: ein vergangenes mittelalterliches Schloss und ein Abenteuer liebender Ritter animieren sein Interesse. Und die Entdeckung eines Tunnels erweckt die Legende über einen im verborgen gebliebenen unterirdischen Wehrgang von neuem. Jedoch sehen den Lehrer nicht alle ohne Vorbehalt und so sieht er sich mit dem aufkeimenden Nationalsozialismus und Antisemitismus der frühen 1920er Jahre konfrontiert. Es ist eine Zeit des dramatischen Wandels, für mache sogar wie eine politische und gesellschaftliche Abrisskante. Aber die Welt drehte sich weiter!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Tom Reger
Wandelzeiten
Geschichte im Vilstal der 1920er Jahre und wie zwei Gemeinden gemeinsam lieber getrennt bleiben
Roman
Kurzfassung Wandelzeiten
Zwei oberbayerische Gemeinden, Hubenstein und Moosen, geraten in den Fokus der Bayerischen Staatsregierung. Die beiden ‚Zwerggemeinden‘ sollen per Regierungsbeschluss zusammengelegt werden. Die Staatskasse ist nach dem 1. Weltkrieg klamm. Die kommunale Selbstverwaltung soll reformiert werden. Dagegen regt sich erbitterter Widerstand, der seit Generationen zerstrittenen Nachbargemeinden. Alte Wunden brechen auf. Argwohn, Misstrauen und handgreifliche Auseinandersetzungen nehmen zu. Plötzlich verschwindet ein Bürger spurlos. War es Mord? Der Flusslauf im Vilstal wird für die nachkriegsgeplagte Bevölkerung zur natürlichen Konfliktlinie. Trotz der Uneinigkeit wird ein Vertreter des Bezirksamts Erding bei einer Versammlung aus Moosen gemeinsam verjagt. Ein Handeln in Eintracht gegen die Obrigkeit bleibt allerdings schwierig. Nur dem Geschick der beiden Bürgermeister ist es zu verdanken, dass ein Gerichtsverfahren gegen die Bayerische Regierung erfolgen kann. Die Bürgermeister der rivalisierenden Gemeinden haben einen Balanceakt zwischen einer feindseligen Gegenwart und einer hoffnungsvollen Zukunft zu meistern. Der hiesige Pfarrer und christliche Hirte sieht mit Sorge auf seine Schäfchen und hat dabei eigene Kriegstraumata zu bewältigen. Der neue junge Schullehrer am Ort ist nicht nur für die Schüler eine Bereicherung. Seine Leidenschaft ist die regionale Geschichte: ein vergangenes mittelalterliches Schloss und ein Abenteuer liebender Ritter animieren sein Interesse. Und die Entdeckung eines Tunnels erweckt die Legende über einen im verborgen gebliebenen unterirdischen Wehrgang von neuem. Jedoch sehen den Lehrer nicht alle ohne Vorbehalt und so sieht er sich mit dem aufkeimenden Nationalsozialismus und Antisemitismus der frühen 1920er Jahre konfrontiert. Es ist eine Zeit des dramatischen Wandels, für mache sogar wie eine politische und gesellschaftliche Abrisskante. Aber die Welt drehte sich weiter!
Stürmische Zeiten des Wandels haben immer sowohl Gewinner als auch Verlierer hervorgebracht.
Aber es gibt eine Möglichkeit:
Aus der Geschichte lernen oder wie einst
Winston Churchill zu Queen Elizabeth II. sagte:
„Je weiter man zurückblicken kann, desto weiter wird man vorausschauen.”.
Inhalt
Cover
Titelblatt
Kurzfassung Wandelzeiten
Vorwort
Der Brief aus München
Bürgermeister Sepp Netter
Lehrer Korbinian Rosshaupt
Pfarrer Nepomuk Langkofler
Korbinian Rosshaupt in Moosen
Bei Freudlmeiers in Hubenstein
Der Hirte seiner Schafe
Fröhliche Klänge in schweren Zeiten
Im Zeitstrom der Geschichte
Brunnenbauer Hermann Ziereis
Ein erschütternder Vorfall
Pfarrer Zeno Fischbacher
Hoffnungsvolles Talent
Plötzlich verschwunden
Hans Georg von Preysing Hubenstein
Land unter in Moosen
Die Vergebung der Jagd
Der Putsch
Versammlung der Gemeinden
Die Entdeckung
Das Watt-Turnier
Das Bezirksamt Erding
Der Widerstand
Ein Tag in München
Die Entscheidung bei Gericht
Der Beichtstuhl
Die Edlen von Moosen
Die Legende
Der Anfang von etwas Neuem
Meinungsumschwung
Hoffen auf Frieden und Freiheit
Geschichtliche Nachlese
Nachspann
Danksagung
Autor
Urheberrechte
Wandelzeiten
Cover
Titelblatt
Vorwort
Autor
Urheberrechte
Wandelzeiten
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
VORWORT
Das obere Vilstal ist für mich ein Stück Heimat, mit dem ich seit meiner Kindheit vertraut bin. Der Fluss, die Vils, der dem Tal den Namen gibt, gleitet an dieser Stelle zwischen den sanften Hügeln links und rechts von ihm dahin. In Kindesjahren war die Vils einer meiner bevorzugten Spielorte. Meine Spielkameraden und ich waren auf dem Wasser mit einem selbstgebauten Floß unterwegs oder im Wasser auf der Jagd nach Fischen, die wir meistens nie zu fassen bekamen. Aber auch auf den Anhöhen und in den Wäldern ringsum haben wir uns, die hiesigen Jungs und Mädels, getummelt und Robin Hood samt Pfeil und Bogen wiedererstehen lassen. Oder wir haben Behausungen in die Natur gesetzt, um sich wie Robinson Crusoe zu fühlen.
Man wächst als Kind hinein in die Umgebung und erobert mit jedem Jahr des Älterwerdens das Land um sich herum. Kindergartenkinder werden Schulkameraden, selbige zu Vereinskameraden und später eventuell Nachbarn mit eigenem Häuschen und Familien mit Kindern. Der Alltag ist somit komplett ausgefüllt und man ist froh, wenn in der Familie, am Arbeitsplatz und allgemein um einen herum alles in Ordnung ist. Man ist froh, wenn die Freuden die Sorgen überwiegen. Wer würde dabei schon auf den Gedanken kommen, dass es hier im Vilstal je anders war? Dabei haben erst die Menschen dieses Land urbar und bewohnbar gemacht und in ihrem Sinne so „kultiviert und zivilisiert“, wie wir es heute erleben dürfen.
Ich hielt es für selbstverständlich, welches Bild die Natur, die Umgebung und Ortschaften zeichneten. Wenn es vielleicht nicht allen so erging, für war es für mich lange so. Derweil muss dereinst diese Region rund um die Obere Vils ursprünglich und wild gewesen sein, wie es historische Quellen andeuten. Keineswegs war das Land am Fluss so erschlossen und kultiviert wie heute, sondern die Natur selbst war alleinige Gestaltungskraft. Weitläufiges Sumpfgebiet, das Moos, wie es heißt, säumte den Fluss und der Mensch hatte wohl einige Mühe, diesem Urboden lebenswerte Bedingungen abzutrotzen. Es muss schwierig gewesen sein, Ansiedlungen und Ortschaften zu gründen, für ausreichend Nahrung und trinkbares Wasser zu sorgen. In den Anfängen war die stärkste Triebfeder für Ortsgründungen der christliche Glaube. Durch Kirchengründungen der Freisinger Bischöfe sollte das Missionsgebiet ausgebaut und gefestigt werden. Dem christlichen Glauben fernstehende Stämme der Bajuwaren hatten sich im 6./7. Jahrhundert in unserer Region angesiedelt. Immerhin durfte Moosen (Vils) im Dezember 2019 auf eine 1250-jährige Geschichte zurückblicken, was per urkundlich nachgewiesener Schenkung aus dem Jahr 769 durch Herzog Tassilo III.1 belegt ist.
Ein zufällig entdecktes Zeitdokument im Gemeindearchiv von Taufkirchen (Vils) gab den Impuls für mein gesteigertes Interesse an der Geschichte links und rechts der Vils. Das Gerichtsurteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes von 19242 zur Zusammenlegung der Gemeinden Hubenstein und Moosen wurde zum Auslöser aller nachfolgenden Recherchen. Ich fand die Vorstellung ungemein spannend, wie die damalige Bevölkerung sowie die verschiedenen Würdenträger wie Bürgermeister, Gemeinderäte usw. mit diesem Schiedsspruch wohl umgegangen waren? Je mehr ich mich diesem Gedanken hingab und weiter nachforschte, umso mehr war ich zudem in den Bann gezogen, in welch bewegten und schwierigen Zeiten zu Beginn des 20. Jahrhunderts diese Veränderung stattgefunden haben musste. Nun gehöre ich einer Generation an, die einen großen Teil der Zeit in genau diesen 1900er Jahren lebte und hoffentlich noch lange in den 2000er Jahren verweilen darf. Aber allein schon die Tatsache, dass meine mir noch zu Lebzeiten liebgewordene Großmutter Klara einen großen Teil ihres Lebens in den wirren Zeiten des 1. Weltkrieges und dann des 2. Weltkrieges zubrachte, zeigte mir, wie nah ich selbst doch dieser Vergangenheit war. Welch unglaublicher Wandel hat sich seither vollzogen? Und welch dramatische Veränderungen es für die Menschen zwischen 1914-1925 gegeben haben musste, wurde mir bewusst, als ich zum wiederholten Male das Foto der Urkunde zur Gemeindezusammenlegung von 1924/25 studiert hatte.
Daraus ist eine Erzählung entstanden, deren Protagonisten frei erfunden sind und deren Charaktere und Handlungen fiktiven Rollen folgen. Beide, Personen und Rollen, sind allerdings in eine Zeit hineingesetzt, deren Ereignisse und Rahmenbedingungen historisch belegt sind. Dieses Spannungsfeld von tatsächlich „Gewesenem“ zusammenzubringen mit fiktiven Individuen, deren Handlungsrepertoire und Lebenseinstellungen auf politisch-gesellschaftlichen Bezügen der damaligen Zeit abgestellt sind, erweckte in mir eine brennende Entdeckerleidenschaft.
Im Rückspiegel der Gegenwart mag uns der stete Wandel in der ferneren Vergangenheit, der Geschichte sogar, als ein natürliches Phänomen vorkommen, manchmal evolutionär und kontinuierlich, manchmal dramatisch und spektakulär. So richtig aber kann man sich die Intensität der Veränderung in den 1920er Jahren erst vorstellen, wenn man sich umfänglich und weitgehend damit beschäftigt. Rückblickend erscheint mir bildhaft gesprochen diese Zeit wie ein großes wild gewordenes Meer, auf dem unzählige Boote gegen dramatisch anschwellende Wellenberge und -täler ankämpften. Einige der Segler konnten durch geschickte Manöver und das notwendige Glück Kurs halten. Obwohl der enorme Seegang auf dem Meer der Geschichte alles abverlangte, hielten sie sich auf ihrer geplanten Route des Lebens. Für andere war die raue See der Geschichte allerdings existenzbedrohend. Ihre Boote standen schicksalshaft kurz vor dem Kentern, zumindest ein Segel war zerfetzt oder ein Mast war gebrochen, sodass ihr geplanter Lebensentwurf wie ein nicht mehr manövrierbarer und leckgeschlagener Kahn zu versinken drohte. Und waren sehr viele „Lebensboote“ so betroffen, waren die Schicksalsschläge vieler Einzelner zu einem gewaltigen gesellschaftlichen Wandel geworden, zu einem abrupten Umbruch und einer Zeitenwende sogar, die ganze Generationen und Gesellschaftsschichten durcheinander wirbelte.
Die Reform der kommunalen Selbstverwaltung, die letztlich zur Zusammenlegung der Gemeinden Hubenstein und Moosen (Vils) führte, war in ihrer regionalen Bedeutung in eine Zeit des epochalen Umbruches für Deutschland eingebettet. Diese 1920er Jahre hinterließen nachhaltige Folgen bis in unsere Gegenwart hinein. Der 1. Weltkrieg hatte mit bis dahin nie dagewesenen Menschenopfern die ganze Welt erschüttert. Monarchien und Adel haben in vielen Ländern Europas ein jähes Ende gefunden. Die fortschreitende Industrialisierung befeuerte den Kampf der gesellschaftlichen Schichten zwischen einer immer größer werdenden Arbeiterschaft und den sogenannten Kapitalisten. Wissenschaft und Technik gelangen gesellschaftsverändernde Entwicklungen, wie am Automobil, der Elektrizität und dem Radio an wenigen Beispielen abzulesen ist. Und die Wirtschaft erlebte dramatisch die wachsende globale Vernetzung und Abhängigkeit, wie am „Schwarzen Freitag“, dem Börsenkrach 1929 sichtbar. Wie würden meine erfundenen Personen der Gemeinden Hubenstein und Moosen (Vils) in dieser Zeit des Wandels, der Umbrüche, Widersprüche und Krisen denken, reden und handeln? Nicht nur, dass die Welt um sie herum aus den Fugen geraten schien, auch die vertraute und bekannte Gemeinschaft in den kleinen Ortschaften auf dem Land war der scheinbaren Willkür der Zeit, dem totalen Wandel ausgesetzt. Welche Gestaltungsmöglichkeiten und Handlungsoptionen hatte der Einzelne, die Gruppe, z. B. als Familie oder die gesamte Gesellschaft?
Überraschenderweise kamen mit den obigen Buchrecherchen weitere interessante Aspekte zum Vorschein. Ein besonderer Reiz war die Ergründung der noch weiter zurückliegenden Vergangenheit zum einstigen Schloss zu Hubenstein. Es gibt nicht viele mir bekannte Quellen zum Schloss, aber die, die ich fand, waren wie ein kleiner Schatz für mich. Eng verbunden mit der Geschichte des Schlosses war die Familie der Freiherrn von Preysing Hubenstein3. Deren Abkömmlinge hatten sich über Jahrhunderte den bayerischen Herzögen der Wittelsbacher angedient und brachten es dadurch zu ehrenwerten Edelleuten samt Wohlstand und Einfluss. Genaueres ist mir zu Freiherrn Hans Georg von Preysing Hubenstein4 bekannt geworden, dessen eindrucksvolle Gedenktafel über dem Ausgangsportal der Pfarrkirche von Moosen (Vils) zu betrachten ist. Es ist eines der wenigen Relikte, die glücklicherweise aus dieser Zeit mit einem festen Bezug zu einem Repräsentanten in unsere Gegenwart herüber gerettet worden waren. Seine Geschichte wird beschrieben als die eines in hoher Verantwortung stehenden Ministerials, sprich „Dienstmannes“, der damaligen Herrschern diente und als Abenteurer und Pilger die halbe Welt bereist hatte. Auch er lebte am Ende des 16. Jahrhunderts, ebenso wie die Bevölkerung anno 1920, in einer Zeit des steten Umbruchs, der stetigen Herausforderung für sein eigenes und das Leben der Seinen, der eigenen Familie. Angetrieben von Wissenschaft, Bildung, Kunst und Religion war die Epoche, in der Hans Georg gelebt hatte, eine Zeit des permanenten Wandels. Kopernikus beschrieb 1543 erstmals die Sonne als den Mittelpunkt des Universums. Das Bürgertum gewann durch Bildung an Wohlstand und Einfluss entgegen den Vorstellungen des Geburtsadels. Die Wiedergeburt der antiken Philosophen wie Platon, Sokrates oder Aristoteles begründete in der Kunst das Zeitalter der Renaissance mit ihren bekanntesten Persönlichkeiten, nämlich Leonardo Da Vinci und Michelangelo. Das Gedankengut des Humanismus griff um sich und Martin Luther, der Pfarrer aus Wittenberg, veränderte mit seinen 95 Thesen die religiöse Welt der damaligen Gläubigen. Aus der geschichtlichen Ferne betrachtet, denkt man, diese Zeit hatte keine Ruhe, keinen Frieden gesehen. Die Auflehnung und kriegerische Auseinandersetzung mit den Bauern 1525 aufgrund fehlender Freiheits- und Menschenrechte, Religionskriege innerhalb der christlichen Welt und gegen das Osmanische Reich, den Islam, der auf das Abendland übergegriffen hatte, Kriege zwischen den europäischen Herrschaftshäusern von Spanien bis Ungarn, Herzogsfehden an jeder Ecke bei unzähligen Fürstentümern und die Eroberung der neuen Welt bis Amerika sowie die Unterwerfung dortiger Urvölker bezeugen dies. Alle diese Ereignisse geben nur einen ungefähren Zustand der damaligen Epoche wieder.
Wandelzeiten überall, egal in welches Jahrhundert der Vergangenheit man blicken will. Was sagt uns das? Der Wandel scheint ein Naturgesetz zu sein. Aber wovon oder von wem wird er angetrieben? Ich würde vermuten: durch uns selbst. Der Mensch ist dank seines großen Gehirns in der Lage, einen Plan zu entwickeln, umzusetzen und die Konsequenzen seines „Kulturschaffens“ zu verstehen. Ob er dabei immer Gutes für sich selbst oder die Allgemeinheit, die Gemeinschaft oder die ganze Schöpfung erfindet, sei dahingestellt. Zu Zeiten von Hans Georg von Preysing Hubenstein herrschte das klare Prinzip der Standeszugehörigkeit vor. Es war per Geburt vorgegeben und wurde sogar von der Kirche als von Gott gegeben verkündet. Der Reihe nach kamen: der Kaiser, der König, dann Adel und freie Bauern - und später freie Bürger - und zuletzt praktisch rechtloses Gesinde. In den jeweiligen Rang ordneten sich der Papst, die Bischöfe und sonstige Geistliche ein. Selbst Martin Luther, als Reformator des christlichen Glaubens bekannt, schrieb über die Freiheit des Christenmenschen sinngemäß, jedermann soll im irdischen Leben ohne aufzubegehren an seinem Platz in der ständischen Ordnung verharren5. Grundsätzliche Prinzipien zu Ordnung und Recht entdeckt man in der Geschichte überall bis in unsere Gegenwart. Der Mensch strebt wohl nach einer gewissen Wohlgefügtheit im Leben. Allerdings, in der Rückbetrachtung erscheint uns das genaue Gegenteil immer wieder zu begegnen. Dabei strebte der Mensch vermutlich noch nie nach dem Chaos als solchem, der Unordnung als Selbstzweck. In den Jahrhunderten vor uns wuchs jedoch der Wunsch und Drang nach Gleichheit und Gerechtigkeit des Einzelnen immer mehr und damit die Hinwendung zur Veränderung. Und sei es durch Gewalt, wie wir an der Französischen Revolution unschwer erkennen können. Gegensätze prallten aufeinander. Auf der einen Seite die Mächtigen, die sich ihrem Verständnis der Ordnung und dem Recht verpflichtet und überdies ihre Privilegien bedroht sahen, und auf der anderen Seite die „Unmächtigen“, die sich ihrer Menschen- und Freiheitsrechte beraubt sahen und nach einem humanistischen Weltbild strebten.
Heute kennen wir die Demokratie als eine für uns fast selbstverständlich gewordene Form der Partizipation der Bevölkerung zur Bestimmung, wie und in welcher Art und Weise die Gesellschaft funktionieren soll. Eine Staatsform, die durch eine Gewaltenteilung auf den Säulen der Legislative (Gesetzgebung), Exekutive (ausführende Gewalt) und Judikative (Rechtsprechung) aufbaut. Wenn man den Gedanken des Jahrhunderte währenden Antriebs nach Gleichheit, Gerechtigkeit und gleichzeitig Sinn nach Ordnung und Frieden in die Zukunft weiter spinnt, frage ich mich heute: „Wohin wird uns die Reise des Gerechtigkeitstriebes noch führen?“. Im Vergleich zu Jahrhunderten vorher ist man geneigt zu sagen, dass die Welt gerechter geworden ist. Für die Menschen der Gegenwart scheint jedoch gefühlt und tatsächlich die Ungleichheit und Ungerechtigkeit nicht zwingend geringer geworden zu sein. Man denke im globalen Kontext an die Rechte von Frauen und Minderheiten oder die Ungleichverteilung von Wohlstand und Armut auf der Welt. 20 % der Weltbevölkerung verbrauchen 80 % der natürlichen Ressourcen, und weiterhin kann der Klimawandel zu einem unerwünschten Verstärker von schon vorhandenen Gerechtigkeitsproblemen führen. Wie werden wir also in Zukunft das gesellschaftliche Zusammenleben gestalten können? Werden wir in unserem Fall der westlichen Kulturen in der Lage sein, die Demokratie weiter zu entwickeln, um für kommende Aufgaben gewappnet zu sein? Werden wir es mit friedlichen Mitteln schaffen oder, wie es mit Blick auf die Vergangenheit immer den Anschein hat, mit gewalttätigen Auseinandersetzungen und Kriegen zu tun haben? Wie werden sich die geopolitischen Blöcke China, Amerika, Russland, Europa und nicht zu vergessen Afrika angesichts der unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Systeme zueinander – friedlich oder unfriedlich - verhalten?
Die Bürger von Hubenstein und Moosen (Vils) erlebten zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Zeit dramatischer Veränderungen. Ein als gerecht empfundener heiliger Krieg war verloren gegangen und in zu vielen Häusern zierten Sterbebilder den Platz auf den Küchenfensterbrettern oder es lehnten Gehhilfen für Kriegsversehrte am Bett in der Schlafkammer. Die täglichen Essensrationen waren bescheiden und das Hungergefühl ein steter Begleiter. Es reichte irgendwie nie richtig, aber gegenüber den Städten war es auf dem Land deutlich besser. Im einzigen Kramerladen am Ort gab es dennoch kaum Waren zu kaufen. Die Seife musste man also selbst aus den ausgelösten Knochen der wenigen Schlachttiere kochen. Kohle zum Heizen der öffentlichen Gebäude, z. B. der Schule waren kaum zu bekommen, aber es gab zumindest Holz von großzügigen Bauern. Es herrschte Mangel allerorten und so wäre verständlich gewesen, wenn die allermeisten Menschen in diesen beiden Gemeinden sich mehr um den täglichen Kampf ihrer Existenz kümmerten als sich um die große Politik zu scheren. Indes darf man das gesellschaftspolitische Interesse der Bevölkerung und einiger Funktionsträger nicht komplett unterschätzen. Der Wandel klopfte quasi an jede Türe, denn einerseits waren technischen Entwicklungen, wie die Elektrifizierung des Landes, der Ausbau der Wasserversorgung, die fortschreitende Mobilisierung durch Automobile, Motorrad und Traktoren in der Landwirtschaft sowie dem Beginn des Rundfunkzeitalters auch im Agrarland Bayern kaum aufzuhalten. Andererseits reichten die staatlichen Maßnahmen zum Aufbau einer modernen Verwaltung weg von den monarchie- und militärgeprägten Strukturen bis nach Moosen (Vils) und Hubenstein, indem diese beiden Gemeinden staatlich verordnet 1924/25 vereinigt werden sollten. Im Übrigen wurde Moosen bis ins Jahr 1937 ohne den Zusatz (Vils) geführt, sodass dies auch im weiteren Verlauf der Erzählung so beibehalten wird.
Wandelzeiten für eine verunsicherte und geplagte Bevölkerung. Und selbst die moralisch hochstehende Kirche verlor ihre Unschuld, indem sie zuvor von einem heiligen Krieg gesprochen hatte, der doch so viel Leid und Schuld mit sich brachte. Wie wird es ihnen wohl tatsächlich ergangen sein im Vilstal in den Zeiten des Wandels?
Ein Hinweis: Die mit Fußnoten gekennzeichneten Textstellen beziehen sich auf historische Fakten und Personen. Die historischen Belege wurden größtenteils lediglich inhaltlich wiedergegeben, historische Persönlichkeiten genannt und nur an wenigen Stellen wörtliche Zitate verwendet.
1 Tassilo III. gehörte dem Geschlecht der Agilolfinger an, die viele Klöster gründeten, auch in Freising.
2 Gemeindearchiv Taufkirchen (Vils), Zeitdokument als Kopie der Urkunde aus dem StAM
3 Bereits im 10. Jahrhundert erwähnt und über verschiedene Linien bis heute bekannt.
4 Ein Sprössling der Linie um Sigmund v. Preysing Hubenstein, 15./16. Jahrhundert.
5 „In Freiheit eines Christenmenschen“ will Martin Luther nur auf die geistlichen, nicht aber auf die weltlichen Bereiche bezogen werden.
Der Brief aus München
3. Mai 1919
Langsam schlurfte Nepomuk Langkofler, Pfarrer von Moosen6, in seinen Filzpantoffeln über die knarzenden Holzdielen der Küche des Pfarrhauses. Er war auf dem Weg zum Schüsselkorb an der Wand, um sich einen Keramikbecher für eine Tasse heißes Wasser zu holen. Nur er, wenn er sich bewegte, oder die im Küchenherd eingelegten glühend schnalzenden Holzscheite durchbrachen die Stille im Raum. Mit dem linken Oberschenkel lehnte er an der Reling des Herdes und goss sich mit einer Schöpfkelle heißes Wasser in die steingraue Tasse. Er holte seinen Gehstock zu sich, um zurück zum Esstisch zu hinken, wo er sich an seinen angestammten Platz auf ein Kissen setzte. Seine Pfarrersköchin, Therese Angermayr, war nur tageweise bei ihm im Pfarrhaus und kümmerte sich um sein Wohlbefinden. Und so war es lediglich der gekreuzigte Jesus Christus, umrahmt von Palmkätzchen, der aus dem Herrgottswinkel warmherzig, so gut es halt ging als Gekreuzigter, auf ihn hernieder blickte.
Er rückte sich am Platz zurecht und holte aus der Innentasche seiner Joppe einen Brief hervor. München, Mariahilfplatz 13, Pfarrer Zeno Fischbacher stand außen auf dem Briefumschlag. Er wusste natürlich, dass er von seinem Studienkollegen und Freund Zeno war, trotzdem hatte er ihn schon den ganzen Tag mit sich herumgetragen und hielt nun für ein paar Sekunden inne, bevor er bereit war, den Brieföffner anzusetzen. Bei funzlig flackerndem Licht einer Petroleumlampe las er.
Mein lieber christlicher Bruder im Glauben, mein lieber Nepomuk!
Wie soll ich beginnen? Es sind meine verwirrten und schmerzenden Gedanken, die es mir nicht leicht machen, die rechten Worte zu finden. Es ist ein heilloses Durcheinander hier in München und wohl überhaupt im ganzen Land. Überall in den Straßen trifft man auf herumlungernde Matrosen, junge Soldaten und Kriegsversehrte. Hungernde und bettelnde Menschen, ob alt oder jung. Sie sind allerorts zu sehen. Es wird gehamstert und erschlichen, wo es geht.
Über alledem regiert das politische Chaos dieser Tage. Eine Revolution löst die andere ab, aber das weißt Du sicherlich auch aus der Zeitung und den vielen Nachrichten aus der Stadt. Den vorläufigen Höhepunkt hatten wir von Ende April bis jetzt zum 1. Mai 1919 erlebt. Marodierende Einheiten der Roten Garden, dem militaristischen Arm der roten Räterepublik, stießen auf die Weißen Garden der reichsdeutschen Befreiungsarmee des Generals von Owen, im Gefolge ein Freikorps des Ritters von Epp, einst königlich-bayerischer Kommandeur der Leibregiments7.
Während draußen Maschinengewehrsalven herüber von der Lindwurmstraße und der Au ratterten, verharrten der Mesner und ich samt einer Gruppe bis ins Mark verängstigter Menschen jeden Alters in unser Kirche bei demütigen Gebeten. Als dann plötzlich Rotgardisten das Tor zum Kirchenportal aufrissen,
war es mit der friedlichen Andacht und dem Beten vorbei. Mit gezückten Gewehren und Pistolen im Anschlag bedrohten sie unsere ehrfürchtige Gemeinschaft, diese jungen ehemaligen Soldaten. Nur mit Mühen konnte ich sie abhalten, schlimmeres Unheil anzurichten, indem ich mich den Eindringlingen entgegenstellte, um Leibesvisitationen und mehr an den Anwesenden zu verhindern. Vehement forderte dieser gewaltbereite Mob die Herausgabe eines flüchtenden Widersachers, den sie offensichtlich angeschossen hatten und in der Kirche vermuteten. Bei meinem Leben hatte ich geschworen, dass dieser Mann nicht im Raume sei. Nur aufgrund meines forschen Auftretens als ehemaliger Feldpfarrer im Königlich-Bayerischen Infanterie-Regiment unter Hinweis auf den kommandierenden Oberst Anton von Langlois8 und meiner offenkundigen Kriegsverletzung links am Hals sowie meinem verbrannten linken Ohrstummel konnte ich dem Anführer dieser blutrünstigen Meute Einhalt gebieten. Und in der Tat, nach dem Abzug der ungebetenen Gesellschaft fanden wir nahe dem Eingang zur Sakristei einen stark blutenden jungen Mann, dem Tode näher als dem Leben.
Lieber Nepomuk, Du merkst, wie sehr mich diese Ereignisse aufwühlen. Gleichzeitig muss ich Dir leider als Kern und Ursprung meiner Einlassungen an dich mitteilen, dass unser gemeinsamer Freund und Kollegiat am Freisinger Priesterseminar, Ignatz Gutsmoser, seinen Kriegsverletzungen im Alter von 31 Jahren erlegen ist. Alle drei waren wir in diesen heroischen vaterlandsgetreuen Krieg gezogen und keiner hatte sich mehr dem allgemeinen Sog entgegengestellt als Ignatz es als Friedensstifter und Versöhner zuvor getan hatte. Er hätte nie, wie viele andere, sinngemäß gesagt: „Der Kriegsdienst ist unser heiliges Recht und … ist ein schönes Zeichen für die gesunde, vaterländisch-männliche Kraft des Geistlichen Standes, dass er nicht müßig am Markte stehen … will, sondern nach christlichem Grundsatz auch da dienen möchte, wo es den höchsten Einsatz gilt zu geben: im Heere, in der Mitte der Blüte und der Kraft unseres Volkes …“9. Ja, das waren die Worte und die Gesinnung, die uns antrieb und vermeintlich über unseren Gott stellte. Welch eine menschliche Arroganz? Wie blind und taub waren wir für Ignatzens Wort des Friedens und der Versöhnung?
Welche Ironie der göttlichen Fügung, dass Ignatz durch eine vermeintliche Blindgänger-Gasgranate am 21. Oktober 1918 ostwärts von Vouziers auf der Linie Landèves – Chamiot10 dem Sterben hingegeben ward und der Herr ihn nun am 13.Mai 1919 bei sich aufgenommen hat. Er, der nur Gott und den Menschen dienen wollte und eben nicht dem verblendeten Kriegsgeschrei und Unfrieden anheimfiel. Er, der bis zu den letzten Tagen des Krieges unversehrt geblieben war und doch von uns genommen wurde. Stunden haben wir gemeinsam darüber philosophiert, bis das Kriegsgeschrei lauter und lauter wurde. Es waren wenige, die aus dem „Bismarck’schen Kriegsgebrüll“11 ausscherten, auch wir beide nicht sonderlich laut, und das friedliche Miteinander aller Menschen predigten. Aber er gehörte zu den Lauten. Und trotzdem ging er ins Feld zu denen, die es besonders hart treffen würde. Er wollte da sein für sie und ist nun gestorben für sie. Was waren wir in Freising für alberne und blödelnde Kerle gewesen und gleichsam tief beseelt von der Kraft Gottes in fester Absicht, den Menschen die Schönheit und Mystik des Glaubens darzubringen? Und jetzt, wo stehen wir Lebenden?
Er hatte recht, zu sagen: ‚Groß fängt der Krieg an, sehr klein wird alles enden‘. Oh Nepomuk, wo sind meine Zuversicht und mein Glaube geblieben? Mehr als vier Jahre des Heldentums. Wir haben die Vielen sterben sehen. Die Frucht ihres jungen Lebens ward mit ihrem Blute zerronnen auf den Äckern und Fluren des grausamen Leidens. Immer und immer wieder haben wir ihnen die letzte Hoffnung erteilt, ihnen die Augen geschlossen auf dem Weg in die ewige Gewissheit. Wie konnten wir die innere Stimme Gottes so katastrophal überhören? Wir hatten geglaubt, berufen zu sein, ein besonderes Gehör für ihn zu haben und doch ließen wir zu, dass wir dem verbalen Götzenbild des verletzten menschlichen und nationalen Stolzes erlegen sind. Es ist eine traurige Zeit und fern von Gewissheit für die irdische Zukunft. Es scheint, als wäre eine reißende Flut über uns hereingebrochen und schwemmte uns hinweg. Dem Ertrinken nahe sind wir hinweg gerissen von einer Odyssee der irdischen Gewalten und fern von rettenden Ufern. Mir sei gewiss, dass die einige und heilige Dreifaltigkeit alle Kraft braucht, uns alle zu erretten von der großen Sünde, die wir begangen haben.
Lieber Nepomuk, nur Dir will ich meiner Seele Tiefen und manch düsteren Grund offenbaren und auf dass ich stark im Glauben und Leben für meine hart getroffene Gemeinde sein kann. Und gleichermaßen erfüllen mich mit Freude und Zuversicht deine Gedanken und Worte, wie ich sie zuletzt in deinem Brief habe lesen dürfen. Lass mich enden mit den Worten und dem Gebet unseres so sehr geschätzten Paters Rupert Mayer, dessen Mut und Frömmigkeit in den Tagen unseres Dienstes für Gott und die Menschen immer ein großes Vorbild sein wird. Er warf seinen schützenden Körper auf einen verwundeten Kameraden, uneigennützig und im Bewusstsein seiner eigenen körperlichen Verletzlichkeit. Sein Gebet erflehe für uns den gleichen Schutz jetzt und für unser aller Zukunft:
„Herr, wie Du willst, so will ich geh’n, und wie Du willst, soll mir gescheh’n.
Hilf Deinen Willen nur versteh’n.
Herr, wann Du willst, dann ist es Zeit, und wann Du willst, bin ich bereit.
Heut und in alle Ewigkeit.
Herr, was Du willst, das nehm’ ich hin, und was Du willst, ist mir Gewinn.
Genug, dass ich Dein Eigen bin.
Herr, weil Du‘s willst, drum ist es gut, und weil Du‘s willst, drum hab’ ich Mut.
Mein Herz in Deinen Händen ruht.“
Hochachtungsvoll und in verbundener christlicher Bruderschaft
Zeno Fischbacher
Nepomuk legte den Brief zur Seite und murmelte einem inneren Antrieb folgend ein Vater Unser. Noch das „… denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen“ im Munde blickte er hinauf zum Herrgottswinkel, visitierte den gekreuzigten Jesus im Bewusstsein seiner ganzer Leidensgeschichte als Sohn Gottes auf Erden.
Spontan erinnerte er sich an die Predigt am Tag der Mobilmachung am 1. August 191412. Tags zuvor war er mit dem Zug von Dorfen nach München zum bischöflichen Ordinariat unterwegs. Der kürzlich durch Kardinal Franziskus von Bettinger ernannte Feldpropst Michael von Faulhaber soll die Seelsorge der Bayerischen Armee organisieren13. Dem Ernst der Lage Glauben schenkend, dass unbescholtene Frauen, Männer und Kinder dem Schutze des Kaisers, der Armee und letztlich auch der katholischen Kirche bedürfen, hatte er sich dieser ausgerufenen „heiligen Mission“ der Feldseelsorge angeschlossen. Noch in München überreichte ihm der Sekretär des Feldprobstes eine persönliche Depesche seiner Heimatgemeinde, er möge doch eiligst kommen, „weil ein Gottesdienst gewünscht würde“. Während der gesamten Rückfahrt schlug eine Frage wie die andauernde Brandung des Meeres gegen seine Gehirnwindungen: „Wie soll das deutsche Volk, meine Gemeinde in den Krieg zieh‘n?“
Noch am Abend um 19 Uhr, nach der offiziellen Verlautbarung des Kaisers zur Mobilmachung14, hatten die Glocken zum Gebet geläutet. Die Gemeinde machte auf ihn den Eindruck einer freudig und gleichzeitig neugierig angespannten Gemeinschaft. Sie hatte zwar eine Vorstellung von der Ernsthaftigkeit des Krieges entwickelt, aber dank der vermeintlich vaterländischen Kraft und dem Siegeswillen der unverschuldet in den Krieg hinein gezogenen deutschen Nation würde es bald den erbetenen Frieden geben. Zudem, mit einem ausgeprägten christlichen Pflichtbewusstsein dem Vaterland und vor allem dem Kaiser gegenüber, wäre der gottgewollte Friedenssieg ein Leichtes und die wenigen Opfer wert. Welch andere Worte hätte Pfarrer Nepomuk Langkofler anzubieten gehabt als die, die jeder hören und glauben wollte, auch er?
Und so erinnerte er sich an Passagen aus seiner Predigt, wie: „De schwere, heilige Pflicht ruft uns und dass wir tausende von wackeren Soldat‘n für unser‘n geliebten König und teure Heimat einsetz‘n werd‘n auf Blut, Ehre und Leben“ oder „Weder des deutsche Volk noch sein hochwohlgeborener Kaiser hab‘n dies‘n Krieg g‘wollt noch verschuld‘t. Er werd uns von unser‘n Gegnern auferlegt. Es is unser heiliges Recht, unser Vaterland und alle Mensch‘n darin zu verteidig‘n, im Vertrauen auf unsere gerechte Sach und Gottes Gerechtigkeit“. Zu guter Letzt applaudierten die sonst so demütig verhaltenen Gläubigen, als er von seiner eigenen Einberufung als Feldgeistlicher berichtete. Alsbald würde er an die Front abberufen. Klatschen und Beinstampfen brandeten hoch und alle erhoben sich von ihren Bänken mit strahlend funkelnden Augen und mit Stolz für ihren Pfarrer Nepomuk Langkofler.
Nepomuk senkte den Kopf in seine Hände, schloss die Augen und seufzte ein „Gegrüßet seist Du Maria voll der Gnade. Der Herr ist mit Dir…“ und stoppte, als er bemerkte, dass der Briefumschlag von Zeno Fischbacher unter ihm lag und eine Ecke eines Fotos heraus schaute. Er griff sich das Foto und erblickte das Porträt seines verstorbenen Freundes. Es war sein Sterbebild demzufolge es hieß: „Helden-Andenken an den ehrgeachteten Pfarrer Ignatz Gutsmoser.“ Viele dieser Sterbebilder hatte er in den letzten Jahren gesehen, die zu den Trauerfeierlichkeiten an die trauernde Gemeinde verteilt wurden, wann immer in schrecklicher Wiederkehr einem lieben, anständigen und fleißigen jungen Mann, Vater, Bruder, Sohn oder Freund die letzte Ehre teilhaft werden sollte. Es war immer der Pfarrer, der, eher selten begleitet durch den Bürgermeister, die schlimme Botschaft überbracht hatte. Die Leute achteten den Priester und Hoffnungsgeber einerseits und andererseits wurde Nepomuk misstrauisch beäugt, welcher Art seine Aufwartung sein würde. Als Überbringer der Hiobsbotschaften wurde er gehasst, glaubte er insgeheim. Historiker, dachte Nepomuk, werden eines Tages Statistiken aufführen, wie viele Tote, Vermisste, Verwundete und Heimatverstorbene dieser unsägliche Krieg gekostet hatte. Die Zahlen würden gewaltig sein und noch immer klopfte der Sensenmann regelmäßig an Türen und holte sich ausgemergelte und erschöpfte Körper und Seelen. Zuletzt den Sailer Michael, der, ähnlich wie nun auch Ignatz Gutsmoser, an den Folgen der durch Senfgas innerlich verätzten Lungenflügel verstorben war. Der späte Aderlass des vor einem halben Jahr beendeten Krieges.
Ein heller Schmerz zuckte durch den kleinen Finger der linken Hand, die Nepomuk reflexartig zu sich herzog. Ein Phantom machte sich bemerkbar, denn er besaß weder den kleinen Finger noch den Ringfinger an dieser Hand. Er hatte sie bei einem Angriff der Franzosen verloren, als der Bataillonsunterstand unter Granatbeschuss lag und eingebrochen war. Mehrere schwere hölzerne Dachbalken waren auf ihn und andere, die sterben mussten, herniedergegangen. Viele Tote in der Heimat hatte er in hölzernen Särgen beerdigt und noch mehr gefallene Soldaten an der Front. Eingekeilt zwischen Brettern und Dreck, von faulem Geruch und Moder umgeben, den Geschmack von gestocktem Blut und rohem Fleisch auf der Zunge, lag er über Stunden da und glaubte nun selbst seine letzte Ruhestätte im Chaos des Krieges gefunden zu haben. Er hatte Glück im Unglück. Der Artillerieangriff hatte sein rechtes Knie zertrümmert, sodass seither ein nahezu steifes Bein und ein schwarzer Gehstock zu seinen dauerhaften Weggefährten gehörten. Seine Verwundungen waren wie eine stete Mahnung an eine von Menschen gemachte Tragödie und die Erinnerung an viele Opfer mit traumatischen Spätfolgen, sichtbar oder unsichtbar. Seine inneren und äußeren Wunden schienen letztlich gut verheilt, doch viele Heimkehrer trugen eine schwere Bürde in sich, die nicht unerkannt blieb für die übrige erwachsene Bevölkerung. Sie waren durch den Krieg andere Menschen geworden, ob nun körperlich invalid oder in der Seele traumatisiert. Und selbst die, die zu Hause geblieben waren, die Mütter, Väter, Schwestern und Brüder hatten sich verändert, da ihnen zu oft ihr Wertvollstes genommen worden war. Fast in jedem Ort und in jedem Weiler gab es menschliche Verluste hinzunehmen.
Nepomuk Langkofler war bei der Hauptoffensive der britischen Armee am 1. Juli 1916 an der Somme zwischen Serre und Maricourt15 schwer verletzt worden und kehrte daraufhin nach einer langen Genesungsphase und vom Dienst entlassen im Herbst 1916 in seine Heimatgemeinde Moosen zurück. Die Gemeinde hatte ihm einen würdigen und freudigen Empfang bereitet, an den er sich gerne erinnerte. Und trotzdem verspürte er damals die scheuen Blicke und reservierte Wehmut der Menschen angesichts seiner offenkundigen Verwundungen. Er konnte und wollte sich nicht verstecken, wie es andere Kriegsgeschädigte durchaus aus falscher Scham oder gebrochenem Stolz taten, indem sie ihre Kammern und Hofstätten nur selten verließen. Er hielt bei Messen, Andachten und sonstigen Feierlichkeiten immer erbötig die linke Hand mit den drei Fingern zum ergebenen Gruße an die Gemeinde gerichtet. Die Leute behaupteten schon, es wäre, wie auf so manch frommem Bild erkennbar, die gebenedeite symbolische Hand Jesus Christi, der die von Nägeln durchbohrte Hand zeigt, aber in seinem Fall die drei Finger die heilige Trinität darstellen würden. Mit der Zeit erschien er ihnen zu einer erhöhten Person geworden zu sein, was eben nicht nur an seinem Pfarrersein liegen konnte. Er wurde ihnen zu einer wandelnden Mahnung und Projektionsfigur ihrer teils selbst erlebten Leiden. Gleichzeitig war er ein aufrecht stehender Mensch, der trotz allem Ungemach seiner Umstände so gut wie möglich weiterzumachen versuchte. Die rechte Hand am Stock, schritt er würdevoll daher, bis er gelernt hatte, sich durchaus geschickt und angemessen im Alltag und bei den Kirchendiensten fortzubewegen. Als Nepomuk am 31. August 1914 an die Westfront abberufen worden war, hatte der Altpfarrer Alois Mooslechner mit seinen neunundsiebzig Jahren die Gemeinde so gut als möglich betreut. Der Altgeistliche bot ihm nach seiner Rückkehr vom Felddienst im Herbst 1916 spontan an, weiterhin an seiner Seite zu stehen, vermutlich auch angesichts der Invalidität seines jungen Kollegen. Pfarrer Mooslechner durfte jedoch feststellen, dass sich Nepomuk nur wenig von seiner körperlichen Versehrtheit einschränken ließ. Er nahm natürlich das Angebot des Altpfarrers gerne an, wieso sollte er auch die freundliche Hilfsbereitschaft ausschlagen.
Nepomuk war sofort aktiv geworden und organisierte Hilfen für die Soldaten und die Heimat selbst, wo es nur möglich war. Es war nicht abzusehen, wann der elende Krieg zu Ende sein würde. Der katholische Frauenverein hat für die Soldaten aus der Heimatregion gestrickt und gearbeitet. Essenspakete und Weihnachtspakete waren regelmäßig verschickt worden. Verschiedene Kollekten zur Unterstützung der Familien der Kriegsteilnehmer hatten enorme Höhen erreicht, weil auch die Not der Hinterbliebenen von Kriegsjahr zu Kriegsjahr nicht geringer geworden war. Mieten, Essen und die normalen Dinge des Alltags mussten beispielsweise bezahlt werden. Im Laufe der Zeit allerdings wurden die Einnahmen immer geringer, was in der deutlichen Verteuerung der Lebensmittel seinen Grund hatte und ohnedies viele Alltagsgüter nur noch über Wertmarken zu bekommen waren. Um besser über die Runden zu kommen, waren es vor allem die Frauen, die mehr denn je in ihren Gärten und auf den Feldern Nahrungsmittel zu erwirtschaften versuchten. Die jungen Männer waren zu großen Teilen an der Front. Trotz aller Mühen war die Anzahl der Essenspakete zurückgegangen, weil unter anderem das sehr wechselhafte Wetter immer wieder die Ernteerträge der hiesigen Bauern schmälerte und Arbeitskräfte fehlten. Dies konnten auch die vermehrt eingesetzten kriegsgefangenen Franzosen nicht wettmachen. Alles zusammen mag es auch dazu geführt haben, dass die Kindersterblichkeit deutlich anstieg und gleichzeitig die Geburtenrate sank16, selbst in der hiesigen Gemeinde auf dem Land, bemerkte Nepomuk. In den Städten war es noch drastischer. Die Stimmung in der Gemeinde wurde durchweg immer trüber. Die Sehnsucht nach Frieden stieg mit jeder Schreckensmeldung, die eine bekannte Familie, einen Freund, einen Schulkameraden oder sonstige Bekannte traf. Die heiligen Messen hatten wieder besonders guten Zulauf bekommen. Es werden wohl Mutlosigkeit und Hoffnungslosigkeit daran schuld gewesen sein, vermutete Nepomuk. Denn je mehr der Krieg der Nation und den Menschen immer heftiger den Stempel aufgedrückt und ins Leben eingegriffen hatte, desto mehr legten die verzweifelten Leute ihr Schicksal wieder in die Hände einer höheren Macht, dem Glauben. Zu Beginn 1914 und noch eine ganze Weile danach war das anders gewesen.
Die technische Neuartigkeit von Filmvorführungen sollte Abwechslung in den provinziellen Alltag einer landwirtschaftlich geprägten Gegend bringen. Josef Millner, der einst in Erding als Aushilfe und Zuarbeiter in einem Fotogeschäft gearbeitet hatte, war Organisator dieser Vorführungen gewesen. Als Gemeinderatsmitglied und ausgesprochener Monarchist aus Hubenstein erachtete er es als seine Pflicht, dem Vaterland auf diese Weise zu dienen. Die Leute waren begierig darauf, überhaupt das neue Medium Film kennenzulernen und gefesselt von noch nie gesehenen Bildern, die neuerdings das Laufen gelernt hatten. So mancher fand es sogar abstoßend und verstörend, die gezeigten Grausamkeiten schier lebensecht erleben zu müssen. Zumeist waren es die nur vereinzelt anwesenden Frauen wie die Angermayr Therese, die sich lauthals empörte und den Saal verließ. Aber die jungen Männer der Jugendvereinigungen und andere, bekannterweise parteipolitisch engagierte Herren waren bestärkt in ihrer Euphorie nach Heldentaten und Heldentum. Schließlich waren ja nur feindliche Soldatenopfer zu sehen. Allerdings hatte die Kriegspropaganda schnell gelernt, überwiegend lächelnde und vorwärtsstrebende Soldaten zu zeigen, deren Bilder die Leichtigkeit von Räuber- und Gendarmspielen verbreiten sollten. Das wäre insgesamt unverfänglicher und trotzdem wirksam, bekannten die Macher der Kriegspropaganda.
Nepomuk erwachte aus seiner weitschweifigen Erinnerungswelt und starrte auf den Brief von Zeno Fischbacher. Natürlich hatte er von den Vorkommnissen in München, wie von seinem Freund erwähnt, gehört und gelesen. Tatsächlich aber war das Pressewesen nahezu zusammengebrochen und lediglich flugblattartige Aussagen von politischen Bewegungen, vom „Münchner Roten Hahn“ der Kommunistischen Partei und andere Organe, wie der „Spiegel der Münchner Räte Republik“, waren einigermaßen verbreitet. Immer wieder wurden sie ergänzt um lose Flugblätter je nach Aktivitäten, derer es in diesen unruhigen Zeiten nicht mangelte. Um den 1. Mai 1919 herum muss es bürgerkriegsähnliche Zustände in München und Umland, vor allem in Dachau17 gegeben haben. Der äußerst beunruhigte Moosener Bürgermeister Sepp Netter hatte Nepomuk besucht und ihm aus der in seiner Amtsstube vorliegenden Zeitung einige Tage nach dem 1. Mai vorgelesen. Außerdem hatte er aus berufenem Munde gehört, wie tagelang im Häuserkampf die Roten und die Weißen sich gegenüber beschossen haben sollen. Darüber hinaus hatte ihm ein Bierfahrer der Taufkirchener Brauerei, der Max Greiter, der in Dachau auf der Seite der Roten Armee unter der Führung des Schriftstellers und Reserveleutnant Ernst Toller18 gegen die Truppen der Freikorps am Gründonnerstag stand, von schweren Kämpfen berichtet. Aber Tage darauf hätten dann in München die Roten durch die Befreiungsarmee von General Owens letztlich eine Niederlage erleben müssen. Viele seien den Kämpfen zum Opfer gefallen und wiederum, vielleicht noch mehr, wären im Schlachthof gefangengenommen und in Zehner-Gruppen standrechtlich erschossen worden19. Beide, Bürgermeister Sepp Netter und Pfarrer Langkofler, waren sich einig, so gut wie möglich beruhigend auf die verunsicherte Bevölkerung einwirken zu wollen, damit das ganze Chaos nicht doch noch auf ihre Gemeinde übergreifen würde. Wie genau sie es machen würden, wollten sie sich noch überlegen, da sie sich von der dramatischen Ereignissen überrollt sahen.
„Hier sitz i nun…“, murmelte Nepomuk in seinen Bart hinein, im Gedanken an die kürzlich erhaltene bischöfliche Depesche an die um München liegenden Pfarreien. Dem Wortlaut nach sollten die Pfarrer ihre „verängstigten Schafe als gute Hirten durch diese unruhigen Zeiten führen“. Selbstzweifel kamen in ihm hoch angesichts der überaus schwierigen Lage.
Er sprach zu sich selbst und mit Jesus im Herrgottswinkel, wie er es immer tat, seit er Pfarrer geworden war und als würde er um eine Eingebung bitten: „I hab ja ned einmal während des Kriegs verhindern können, dass im Herbst 1918 zwei der drei Glocken unserer Pfarrkirche von der Heeresleitung beschlagnahmt word‘n san. Außer sich war‘n de Gemüter der christlichen Gemeinde und von Bitterkeit und Zorn ergriff‘n. Sie wurden an zwei Tagen aus‘baut, ein paar Pfeiler rund um die Schalllöcher des Glockenturms entfernt und de Glocken zu Boden geworf‘n und abtransportiert. Und du weißt“, duzte und erklärte er Jesus, als wüsste dieser von nichts, „wia rasch sich Gerüchte und Verdächtigungen in den Reih‘n einiger Moosener Bahn brach’n. Eine Hum‘stoaner Sippschaft (wie die Einheimischen den Ort Hubenstein und seine Bewohner, die Hubensteiner, nannten) aus dem Nachbarort hätt des durch verleumderische Hinterhältigkeit bewirkt. Natürlich war‘n die Anschuldigungen aus der Luft griffen und fußten auf keinerlei tatsächlichen Beleg‘n, wia du weißt. Es war‘n die üblich‘n Animositäten zwisch‘n rivalisierenden Nachbargemeinden, die einerseits aufeinander angewies‘n war‘n und andererseits als Gemeind‘n einander um die Gunst der staatlich‘n Behörd‘n konkurriert‘n. Aber i sag dir, und du weißt, was ich meine, mein Ehrwürdigster, bei aller mir selbst auferlegt‘n Neutralität und Diplomatie nach außen, insgeheim hab i nach wie vor meine eigenen Verdachtsmomente.“
Noch während der Kriegszeit, aber vor dem besagten Herbst 1918, waren ihm anonyme Briefe zugespielt worden, die sich über sein Glockengeläut beklagt hatten, wie wenig vaterländische und soldatische Verbundenheit es mit den Vaterlandsverteidigern gäbe und dass man auch nicht davor zurückschrecken würde, Konsequenzen folgen zu lassen. Eine offene Drohung an ihn, die ihren Grund darin gefunden hatte, dass Nepomuk, anders als andere Gemeinden, von pompöser Beflaggung und minutenlangem Glockengeläut abgesehen hatte, wann immer es scheinbar triumphale Siege mit tausenden Gefangenen und geschlagenen feindlichen Soldaten zu vermelden gegeben hatte. Ebenso wenig war er für einen schulfreien Tag gewesen, den die Kinder letztlich aus Langeweile mit Kriegsspielen verbracht hätten. Seiner Meinung nach sollte die christliche Glaubenslehre für die noch wankelmütigen jungen Christen im Vordergrund stehen. Zu Beginn des Krieges bekreuzigten sich die Leute auf dem Feld, in den Häusern, wohl im ganzen Vilstal und darüber hinaus. Sie hielten für eine Weile inne, wenn sie die Kirchenglocken von wo auch immer her hörten. Aber im Laufe der Zeit waren die Menschen an der Vielzahl der dröhnenden Schreckensnachrichten abgestumpft und nicht mehr das Siegen war ihnen wichtig geworden, sondern der Wunsch nach Frieden. Das bestätigte Nepomuk in seiner Haltung. Seit seiner Zeit als Feldseelsorger stockte Nepomuks Herz bei dem Gedanken an die verheerenden Menschengemetzel solch vermeintlicher Siegesschlachten. Kein Sterben in menschlicher Würde und im Angesicht Gottes auf keiner Seite der Frontlinien. Und als die Siegesmeldungen über die späteren Kriegsjahre spärlich geworden waren, verweilten viele Menschen lieber in den Kirchen, ob bei Messen oder aus freien Stücken in freier Andacht für sich selbst und die Ihrigen.
„War des ned ein Akt der Hinterlist, de Sach mit dene Glock‘n? Es war bestimmt der eine da, dessen Namen i jetzt in Rücksichtnahme auf dich, mein Erlöser, keinesfalls in den Mund nehma werd“, polterte er ungewöhnlich ungehalten Richtung Herrgottswinkel.
Aber eigentlich konnte er nur mutmaßen, wer der Schreiber dieser mehrfachen Drohbotschaften war, hegte dabei jedoch einen ernsthaften Verdacht. Nepomuk glaubte in der Handschrift Josef Millner aus Hubenstein zu erkennen, der als Gemeinderatsmitglied der Gemeinde Hubenstein schon so manches Dokument zu behördlichen und kirchlichen Vorgängen zu signieren hatte. Dieser vermeintlich ehrenwerte Gemeinderat war ein fundamentaler Monarchist und ausgesprochen konservativ denkender Mensch, der gerne öffentlich seine illustre Meinung zum Besten gab. Nur ein Verdacht und eine kalligrafische Analogie zwischen Drohbriefen und Behördendokumenten ergaben noch keinen Beweis. Und bis dato hatte Josef Millner bei seinen populistischen Einlassungen auf öffentlicher Bühne keine weiteren Sympathisanten hinzugewinnen können, die außerdem an ihren Pfarrer herangetreten wären. Innerlich abgekühlt las er im Brief von Zeno Fischbacher in den Gebetszeilen von Pater Rupert Mayer:
„‘Deinen Willen…in alle Ewigkeit…Dein Eigen bin…mein Herz in deinen Händen ruht‘. Verzeih meine Tollheit, es is über mich komma. Ich bedaure, dir meine Zweifel aufz’last‘n, aber für mich als Mensch erscheinen de Zeit‘n so überaus erdrückend, dass i an mir selbst zweif'l und mir de Sicht auf deine unbedingte Liebe und Barmherzigkeit und Güte verstellt is. Dabei gehts mir ned um mich selbst, sondern um de Menschen in unserer Gemeinde. Sie sprechen von der Strafe Gottes, dem Gericht Gottes auf Erden und unsere Widersacher hätten Recht behalten und wir wären von Dir abgefallen. Dabei bist du ned der Strafende, der Gerechte mit dem Schwert. Wir müss‘n nur deine unvoreingenommene Liebe zu uns allen Mensch‘n wieder erkenna woll‘n. Morgen feiert der Heilige Johannes Nepomuk, mein Namensgeber, seinen Gedenktag und vielleicht kommt er zur recht‘n Zeit, ohne den Tag aus selbstsüchtig‘n Gründ‘n überhöhen zu woll‘n. Aber es werd‘n die Schafe ihren irdisch‘n Hirt‘n sucha und dank deiner werd i de richtige Ansprach find‘n, wenn sie hoffentlich zahlreich zur Messe komma.“
6 Gemeindename bis 1937 ohne den Zusatz (Vils)
7 Historische Ereignisse, Personen und Akteure rund um den 1. Mai 1919
8 Historische Figur der Bayerischen Armee
9 Originalworte höchster Kleriker zur Motivation geistlicher Berufe
10 Historischer Ort einer Schlacht im 1. Weltkrieg
11 Historische Begrifflichkeit
12 Historisches Ereignis: Zuwiderhandlungen zur Mobilmachung wurden hart bestraft.
13 Historische Funktionsträger und Persönlichkeiten
14 Kaiser Wilhelm II. gibt um 17 Uhr den Mobilmachungsbefehl.
15 Historisches Ereignis: ca. 1 Million Soldaten verloren ihr Leben in dieser Schlacht, die mehrere Wochen andauerte.
16 Der Anstieg um 50 % war gravierend. Geburten führten zu einer Verdoppelung der Müttersterblichkeit.
17 Tagelange blutige Kämpfe zwischen „Roten“ und „Weißen“ forderten unzählige Tote.
18 Historische Figur: Protagonist der Münchener Räterepublik
19 Historische Ereignisse um die Niederschlagung der Räterepublik in München
Bürgermeister Sepp Netter
10. Mai 1919
Schon in jungen Jahren hat sich der Netter Sepp für die Gemeindepolitik interessiert. Das Amt des Bürgermeisters von Moosen hatte Tradition im Hause Netter, denn bereits der Großvater und Vater hatten es innegehabt. Und so bekam er von Kindesbeinen an mit, was am Ort und in der Gemeinde vorging. Praktisch mit der Suppe löffelte er die Geschichten auf, die der Vater am Mittagstisch von sich gegeben hatte. Das Vilstal mit seinen Menschen, Geschöpfen und der Natur lagen dem Gemeindevorsteher am Herzen. Außerdem war er ein angesehener Landwirt, der über die Region hinaus bekannt war. Als solcher war er ein geachtetes Parteimitglied des in ganz Bayern populären Bauernbundes.
In der Zeit, als die jungen Männer und irgendwie eine ganze Nation in den Krieg zog, war er die zentrale Figur der Gemeinde Moosen. Zu unzähligen Vorgängen waren sein Rat und seine Tat gefragt. Es mussten die Anweisungen der Militärbehörden umsetzt werden, die in Umfang und Ausmaß für die Gemeinde an Bedeutung zunahmen. Der Schwerpunkt der Landwirtschaft wurde schrittweise auf die Versorgung des Militärs und der gesamten Kriegswirtschaft ausgerichtet. In Folge dessen wurden Nahrungsmittel per Wertmarken für die Bevölkerung rationiert und die Preise durch den Staat eingefroren. Der Hunger nach industriell gefertigten Kriegsgütern aller Art war unglaublich, sodass Betriebe, Gewerbe und Handwerk vielfach statt zivilen Gütern hauptsächlich kriegsrelevante Produkte erzeugten. Im Wochenmaßstab gab es neue Verordnungen und Anweisungen an die Bürgermeister der Gemeinden, vor allem wenn es um die Rekrutierung weiterer Soldaten ging. Die jahrgangsweise Einberufung der jungen Männer war für den Netter Sepp ein besonders heikles Thema. Gewalt, ja sogar Krieg als Mittel der Wahl, als letztes Argument von Zwistigkeiten zwischen Nationen – aber auch auf einzelne Menschen gemünzt - war ihm ein Gräuel. Als Bub war ihm das schreckliche Siechtum seines Onkels aufgrund einer schweren Verletzung im Deutsch-Französischem Krieg 1870/71 im Gedächtnis geblieben. Umso mehr versuchte er zwischen den Militärbehörden und den Familien zu vermitteln, wenn es um extreme Härtefälle ging, weil Familien bereits erhebliche Blutopfer erbracht hatten. Jedoch, für viele junge Männer war es ein Abenteuer und der Gewinn von Ruhm und Ansehen, in den Krieg zu ziehen. So war Sepps größte Sorge das plötzliche Verschwinden seines ältesten Sohnes Lukas. Niemand wusste, wo er sich aufhalten könnte, als bereits viele Tage der Suche nach ihm vergangen waren. Sepp Netter hatte eine Vermisstenanzeige aufgeben und die hiesige Polizei eingeschaltet. Die Beamten gingen der Sache nach, kamen aber nicht recht vorwärts. Ein Kapitalverbrechen wurde ausgeschlossen. Es gab dafür keinerlei Anhaltspunkte bei einem so beliebten jungen Mann. Eine Spur führte tatsächlich zum Einberufungsamt nach Taufkirchen, wo Lukas vorgesprochen haben soll.
„Jetz im Mai sind es drei Jahre, seit er verschwund‘n is“, klagte er dem Pfarrer Langkofler, der ihm in den schwierigen Phasen des Erinnerns ein wohlvertrauter Zuhörer geworden war. „Was hat mir der Bua für eine Freud g’macht. Geschichte wollt er studier‘n und Deutsch. Tagelang war er – neben der Feldarbeit – unterwegs und hat nach dem sagenumwobenen Geheimgang g‘sucht und g‘forscht. Direkt vernarrt war er in die alt‘n Erzählungen.“
„Ja, i weiß, der angebliche Tunnel zwisch‘n Hum’stoa und Kalling von anno dazumal“, brachte der Pfarrer Langkofler ein, der die Legende, die fest im Gedächtnis der Bevölkerung verankert war, kannte. Demnach hätten die einstigen Schlossbesitzer von Hubenstein und Moosen zum Zwecke der Sicherheit, der Verteidigung oder bei gebotener Flucht diesen unterirdischen Verbindungsweg angelegt.
„Der Erzählung nach soll er weg‘n der Türkenkriege baut word‘n sein. Und de Hum’stoaner Freiherrn von Preysing und de Herren von Kalling, de Starringer20 sollen daran großen Anteil g‘habt hab‘n“, führte Sepp Netter nahezu geistesabwesend aus, um seine tiefe Trauer zu überdecken. Pfarrer Langkofler nickte nur beiläufig, da er diese Phase der Trauerbewältigung kannte. „In de Archive is er damals desweg’n ganga. Hat den Archivar, den alt‘n Petzl Ferdinand um Rat g’fragt und war völlig verfang‘n in seinem Geheimgang-Spleen. Dann war er plötzlich weg, wie vom Erdboden verschluckt“, räusperte sich und erschrak für eine Sekunde über das, was er gerade gesagt hatte.
„I kann mich erinnern“, schaltete sich Pfarrer Langkofler ein. „De Leut hab‘n de erst‘n Tage nach dem Verschwinden gemeint, der Teufel hätt ihn g‘holt, weil er denen von Preysing und den Starringern keine Ruhe hätt lass’n“, entkam ihm ein Gedanke, den er am liebsten zurückgenommen hätte.
„Des war ein ziemlicher Schmarrn“, meinte der Netter Sepp ärgerlich im Unterton. „Und dann gab es auch noch des Gerücht, der Lukas sei in Taufkirchen bei der Musterungsstelle geseh‘n word‘n. I hab mit einem davon g’redt. Da war‘n schon junge Männer, de unbedingt dabei sein wollt’n, aber ned hab‘n dürf‘n weg‘n dem Alter. Die Polizei hat g’meint, der Lukas war da ned dabei. Aber der Mann hat mir g’sagt, dass manche sogar ihre Geburtsurkunde hätt‘n fälsch‘n wollen desweg‘n und noch schlimmer. Er hätt g’hört, ganz ausgepuffte hätt‘n versucht, in die Identität von gefallenen oder vermissten Soldaten zum schliefa. Aber ned in Taufkirchen. Is des ned verrückt?“, empörte sich der innerlich aufgebrachte Netter Sepp. Der Geistliche wollte ihm nicht widersprechen, denn solche Fälle, wenn auch nicht viele, soll es gegeben haben.
„Ach, am allerschlimmsten is dieser Traum, denn ich einfach ned loswerd“, seufzte der sonst so unerschrocken auftretende Bürgermeister. „Ich seh ihn dalieg‘n, den Lukas. So friedlich sieht er aus als würde er schlaf‘n. Aber dann, diese dunkelschwarze Erde ringsum ihn. Seine Hautfarbe verblasst und ein bleich gewordenes Gesicht starrt mich an.“ In seiner eigenen Gedankenwelt gefangen, verschwamm Nepomuk Langkoflers Wahrnehmung für die mit Tränen getränkten Augen ihm gegenüber. Nepomuk sah sich plötzlich zurückversetzt in die Schützengräben der Soldaten, als wäre er mitten drin. Erdiger Geschmack sammelte sich in seinem Mund, als würde es tatsächlich so sein. Wie frisch umgestochener Ackerboden roch es, doch der Geruch war keinesfalls der von gedeihlichem Erdreich, das im Frühjahr als Furchen über die Äcker gezogen wurde. Modriger Geruch stieg gefühlt in seiner Nase empor und eine unsichtbare eigenartige Fäulnisschicht schien seine Lippen zu benetzen. Je wärmer und abwechselnd regenreicher die Tage hintereinander gewesen waren, umso stärker krallte sich diese Atmosphäre der allgemeinen Verpestung in den Todesfurchen an der Front an der eigenen Sinneswahrnehmung fest. Frisches und altes, schwarz gewordenes Blut durchmengte das dunkel gewordene Erdreich und gab es dem Licht der Sonne preis. Die Mutter Erde dampfte hervor, was in den Schlachten zuvor als Tribut des Kampfes an zerfetzten Körperteilen und Blut von ihr aufgesogen wurde. „Erde zu Erde, Asche zur Asche, Staub zum Staube“ bekam eine absolute und tausendfache Bedeutung im Angesicht des Schlachtens“, dachte Nepomuk in seiner Lethargie, unfähig, auf die letzten Worte von Bürgermeister Sepp Netter einzugehen. Langsam und leise sog Pfarrer Langkofler tief Luft ein, um diese unhörbar wieder aus seinem lebendigen Leib zu pressen. Endlich kam er selbst wieder zu innerer Balance.