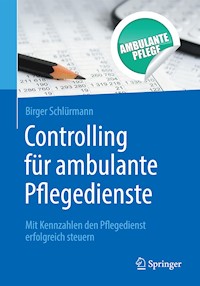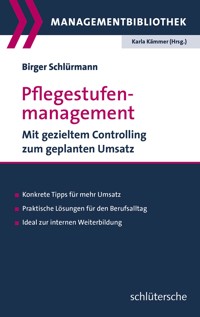Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Pflege Management
- Sprache: Deutsch
Wenn Pflegedienstleitungen aus ihrem Berufsalltag erzählen (und das tun sie in diesem Buch), dann öffnet sich die Büchse der Pandora: miese Arbeitsbedingungen, mangelnde Einarbeitung, Personalmangel, erdrückende Haftungsverantwortung, Angst und Stress... Was eigentlich eine Erfolgsgeschichte, gar ein Karrieresprung sein sollte, entpuppt sich im Alltag als Sackgasse. Die Folge: Immer mehr PDL'er verlassen ihren Job, werden krank oder sogar komplett erwerbsunfähig. Doch es geht auch anders: Mit Dienstplänen, bei denen die Mitarbeiter mitreden dürfen, mit modernen Arbeitszeitmodellen, Coaching, Training und einer PDL, die das richtige Rüstzeug für ihre berufliche Position hat. Der Autor Birger Schlürmann, seit Jahren als Unternehmensberater und Interimsleiter in der Altenpflege unterwegs, weiß, was PDL'er plagt – und er kennt Lösungen und Strategien, die wirken! Hier stellt er sie zusammen, interviewt PDL'er zu ihren Problemen, stellt Tipps und Trainings vor, die die PDL wirklich braucht. Richtig gute Arbeitsbedingungen sind möglich!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Birger Schlürmann arbeitet seit 20 Jahren im Management und in der Beratung für ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen.
» Die Ziele liegen immer jenseits der Angst!«
BIRGER SCHLÜRMANN
pflegebrief
– die schnelle Information zwischendurchAnmeldung zum Newsletter unter www.pflegen-online.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
ISBN 978-3-8426-0847-4 (Print)ISBN 978-3-8426-9086-8 (PDF)ISBN 978-3-8426-9087-5 (EPUB)
© 2021 Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Hans-Böckler-Allee 7, 30173 Hannover
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der gesetzlich geregelten Fälle muss vom Verlag schriftlich genehmigt werden. Alle Angaben erfolgen ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Autoren und des Verlages.
Für Änderungen und Fehler, die trotz der sorgfältigen Überprüfung aller Angaben nicht völlig auszuschließen sind, kann keinerlei Verantwortung oder Haftung übernommen werden.
Die im Folgenden verwendeten Personen- und Berufsbezeichnungen stehen immer gleichwertig für beide Geschlechter, auch wenn sie nur in einer Form benannt sind. Ein Markenzeichen kann warenrechtlich geschützt sein, ohne dass dieses besonders gekennzeichnet wurde.
Titelbild: jozefmicic – stock.adobe.com
Covergestaltung und Reihenlayout: Lichten, Hamburg
Inhalt
Vorwort
1Die grundlegenden Probleme
1.1Gestatten: Das ist Ihr Job!
1.2Gesellschaftliche Umwälzungen – nur eine Hypothese oder doch belegbar?
2Beruf »Pflegedienstleitung«
2.1»Noch liebe ich meinen Job«
2.2»Ich möchte ein Premium-Anbieter werden«
2.3»Zukünftig werde ich den Job verlassen«
2.4»Ich möchte beruflich durchstarten«
2.5»Ich musste mir ein dickes Fell zulegen«
2.6»Wir nutzen die Krise, um dazu zu lernen«
2.7Fazit: Es muss anders werden, wenn es gut werden soll
2.7.1Menschlich, agil, kundenorientiert – so könnte Pflege sein
2.7.2Es fehlen Budgetverantwortung und Gestaltungsspielräume
2.7.3Sind wirklich alle Trägerverbände noch auf der Seite der Einrichtungen?
2.7.4Die Politik bestimmt die Rahmenbedingungen, oder?
2.7.5Aktuelle Bedrohungen durch die Corona-Krise
3Und hier sind die Lösungen für Ihre drängendsten Probleme
3.1Die Dienstplanung: eine OP am offenen Herzen
3.1.1Dienstpläne eigenverantwortlich erstellen
3.1.2Wochenend-Dienste: nur alle 2,5–3 Wochen!
3.2Unbeliebte Dienste verteilen
3.2.1So kann eine Verteilungsgerechtigkeit bei unbeliebten Diensten aussehen
3.3Lange Freiphasen dank innovativer Arbeitszeitmodelle
3.3.1Modell 1: Der Klassiker »7 Tage Dienst, 7 Tage frei«
3.3.2Modell 2: Viele Überstunden anhäufen und lange frei haben
3.4Die Methode der »erweiterten Urlaubsbesprechung«
3.5Sehen Sie sich als Coach und Trainer
3.5.1Reagieren Sie noch, oder agieren Sie schon?
3.5.2Durchbrechen Sie verkrustete Denkmuster
3.5.3Kontern Sie mit Bedacht
3.5.4Verwandeln Sie Schwächen in Stärken
3.5.5Prioritätensetzung als Angstkiller
3.5.6Arbeiten Sie mit nachhaltigen Verhaltensänderungen
3.5.7Wenden Sie die Erfolgskommunikation an
3.5.8Gemeinsame Ziele von Mitarbeitern und Unternehmern
3.5.9Systemisches Fragen überwindet Gräben
3.5.10Der Mitarbeiter muss seine Grenzen kennenlernen
3.5.11Reflektieren Sie sich selbst
3.6Karriere und Entwicklung
3.6.1Fachliche Teamentwicklung
3.6.2Mitarbeitermotivation mit Kompetenzprofilen
3.6.3Leistung muss sich auf dem Konto sichtbar machen – ein Win-Win-Prämienmodell
3.6.4Budgetverantwortung für die PDL
3.6.5Vom Umgang mit Kranken- und Pflegekassen
3.7Die Mitarbeiterpflege
3.7.1Mitarbeitergespräche im Sinne von NLP
3.7.2So hebeln Sie Vermeidungsstrategien aus
3.7.3Das ABC-Formular zur Verhaltenssteuerung
3.7.4Fördern Sie leistungsschwache Mitarbeiter
3.8Fazit
3.8.1Gezielt handeln und große Effekte erzielen
3.8.2Machen Sie Ihre Situation öffentlich
4Forderungen an die Politik
4.1Gleiche Prüfregularien für alle
4.2Die Macht der Kassen brechen
4.3Entscheidung zwischen Planwirtschaft und Marktwirtschaft
4.4Unattraktive Arbeitszeiten entsprechend vergüten
4.5Schluss mit Aussitzen
4.6Das Rothgang-Gutachten zur Personalbemessung und Pflegefinanzierung
4.7Die Darstellung der Pflege in den Medien
5Fazit – oder: Der Blick in die Glaskugel
5.1Wer soll das alles bezahlen?
5.2Eine gewagte These – Es gibt ein schnelles Ende des Personalmangels in der Pflege!
Literatur
Register
Vorwort
Ich durfte im Jahr 2019 aktiv beim Projekt »Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege« mitwirken. Mein damaliger Kollege Dr. Jan Appel und ich konnten den Zuschlag bei der entsprechenden Ausschreibung für unseren ehemaligen Arbeitgeber gewinnen. Im Projektverlauf ist mir aber immer deutlicher geworden, wie sehr sich in den letzten Jahren der Branchenfokus auf die Mitarbeiterzufriedenheit und auf den Pflegepersonalmangel gelegt hat. Was aus meiner Sicht völlig hintenüber fällt, ist die Situation und die Arbeitszufriedenheit der Pflegedienstleitungen.
Oft geht es in der Literatur, in Diskussionen und Projekten immer um die Mitarbeiter in der Pflege sowie um die Patienten und Bewohner. Diese Themen sind aus meiner Sicht hinreichend auserzählt. Zumal sich vor allem bei der Bezahlung für Pflegekräfte endlich etwas in die richtige Richtung bewegt. Was hingegen endlich in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gehört, sind die Sorgen und Nöte der Pflegedienstleitungen.
Aus diesem Grunde befasst sich das vorliegende Buch ausschließlich mit der Sichtweise und der Situation von Pflegedienstleitungen. Mein Ziel ist es nicht weniger, als grundsätzlich deren Arbeit endlich einmal gebührend zu würdigen und ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, das eigene, problematische Arbeitsfeld so umzugestalten, sodass der Job wieder Freude macht. Denn das ist das Gute am Job der PDL: Wohl kaum eine andere Position in der Altenpflege kann so viel Handlungs- und Gestaltungsspielraum eröffnen wie die Position der Pflegedienstleitung im ambulanten Pflegedienst. Aber auch die PDL-Kollegen im stationären Bereich hätten bei besseren Rahmenbedingungen ebenfalls ein vielseitiges Tätigkeitsfeld, das u. a. Raum für Innovationen im Bereich Pflege und auch der Personalentwicklung gäbe.
Mein Buch richtet sich deshalb sowohl an ambulante als auch stationäre Pflegedienstleitungen, wenn auch einige Beispiele eher auf den ambulanten Bereich zugeschnitten sind. Das gilt v. a. für die Beispiele zur Entlohnung, die Prämienmodelle und manche Arbeitszeitmodelle. Das liegt einfach daran, dass der Handlungsspielraum in der ambulanten Pflege strukturell bedingt breiter ist und die betriebswirtschaftliche Steuerungsmöglichkeiten bzw. -erfordernisse für die ambulante PDL höher sind. Hingegen sind alle Beispiele und Anregungen im Bereich »Kommunikation und Coaching« sowohl ambulant als auch stationär anwendbar.
Für dieses Buch habe ich einige Pflegedienstleitungen aus verschiedenen beruflichen Umfeldern zu Wort kommen lassen. Aus den Interviews wird sehr deutlich, wo der Schuh drückt. Aber gleichzeitig wird auch viel Hoffnung geäußert und es schwingt sehr viel Eigenmotivation und Innovationskraft mit.
Um die Pflegedienstleitungen auch konkret im Gespräch mit budgetverantwortlichen Vorgesetzten zu unterstützen, führe ich immer wieder Rechenbeispiele und Methoden auf. Diese können als Vorlage genutzt werden, um heikle Budgetgespräche mit Vorgesetzten durchzuführen. Leider ist es oft so, dass Pflegedienstleitungen nicht befugt sind, über ein Budget zu verfügen. Im Gegenzug sollen sie aber vor allem mängelfreie MDK-Prüfungen liefern, einen überstundenfreien Dienstplan gewährleisten, die Krankheitsquote unter 5 Prozent drücken und natürlich den Pflegegradschnitt hoch halten bzw. im ambulanten Dienst zweistellige Renditen sicherstellen.
Im letzten Abschnitt habe ich Wünsche und auch Forderungen an die Politik und die Kostenträger zusammengetragen. Das ist dringend notwendig, wenn sich nachhaltig etwas an den allgemeinen Bedingungen in der Altenpflege ändern soll. Ein »weiter so« kann nicht die Antwort sein. Denn nicht nur der Verlust von Pflegefach- und hilfskräften, die aus dem Beruf fliehen, sondern auch die Flucht der Pflegedienstleitungen muss gestoppt werden. Aber solange Politik und Kostenträger Rahmenbedingungen dulden, in denen eine PDL weniger verdienst als im bundesweiten Durchschnitt (ca. 4.000 Euro brutto im Monat über alle Branchen) und gleichzeitig täglich verzweifeln, weil sie die Bewohner- bzw. Patientenversorgung nicht mehr sicherstellen können, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn es immer weniger gute und innovative Pflegedienstleitungen gibt.
Eine Pflegedienstleitung ist sowohl in einer stationären Einrichtung als auch in einem ambulanten Pflegedienst der Dreh- und Angelpunkt. Und die PDL ist vor allem das Aushängeschild nach außen. Da kommt es auch auf die Ausstrahlung an. Hierzu passen ein paar treffende Sätze, die von Sonja Hollerbach (Coach und Dozentin) stammen, die sie auf der Online-Plattform LinkedIn veröffentlicht hat: »Erkennt man einen Menschen nicht vielmehr an der Atmosphäre, die er durch seine Gegenwart erzeugt, statt an dem, was er sagt? Denn in dieser kleinen und umso feineren Frage versteckt sich so viel Wahrheit, deren Tiefe Du erst dann vollkommen zu verstehen magst, sobald Du Dich mit Dir selbst und anderen in Verbindung fühlst.
Atmosphäre ist etwas Magisches. Du bist die Atmosphäre. Schaffst Du eine Atmosphäre der Wertschätzung, der Achtung, des Wohlfühlens? Schaffst Du es, durch Deine bloße Anwesenheit, Andere größer zu machen oder hast Du Angst, dabei selbst kleiner zu werden?
Du bist der Ursprung für all das, was in Deinem Außen ist. Bist Du in Dir gefestigt und im Reinen, dann sind genau das auch die »Vibes«, die Du aussendest und die die Atmosphäre um Deine Person erschaffen.«
1 Die grundlegenden Probleme
Als klassische ambulante oder stationäre Pflegedienstleitung tragen Sie im Schnitt die Verantwortung für 109 Patienten1 bzw. 64 Heimbewohner2 bei durchschnittlich ca. 77 Pflegeplätzen3. Hierbei handelt es sich v. a. um pflegebedürftige Menschen mit zum Teil erheblicher Multimorbidität im körperlichen und/oder psychischen Bereich.
Als Pflegedienstleitung sind Sie gegenüber den Kostenträgern (Kranken- und Pflegeversicherung sowie Sozialhilfeträgern und Heimaufsichtsbehörden) als verantwortliche Pflegefachkraft gemeldet. Eine »verantwortliche Pflegefachkraft« ist Teil der Betriebsleitung. Zu Ihrem Aufgabenbereich gehören im ambulanten Bereich somit die Planung, die Organisation und Kontrolle – also konkret die komplette Steuerung des gesamten Pflegedienstes.
Neben der Zusammenarbeit mit den Hilfebedürftigen und Ihren Angehörigen gehört auch die Erstellung und Beurteilung von Mitarbeitern zu Ihren Tätigkeiten. Wenn Sie den Begriff der »Steuerung« genauer betrachten, zählt natürlich die Steuerung der pflegerischen Prozesse zu Ihren Kernaufgaben. Als »Durchschnitts«-PDL müssen Sie also im Schnitt die Pflegeverläufe von 109 Patienten/64 Heimbewohnern im Blick haben und notfalls schnelle und manchmal auch unpopuläre Maßnahmen treffen, um Schaden vom Patienten/Bewohner fernzuhalten.
Wenn Sie im ambulanten Bereich arbeiten, werden Sie festgestellt haben, dass Sie sich immer mehr auf den betriebswirtschaftlichen Erfolg und die Steuerung des Personals beschränken müssen, wobei Letzteres immer mehr zunimmt. Die gute Pflegequalität aber fällt dabei hintenüber. Aus haftungsrechtlicher Sicht ist das ein Ritt auf der Rasierklinge: Ein Urteil von 2009 des Bundessozialgerichts4 untermauert nämlich die Priorität für die Pflegedienstleitung, sich v. a. um die Steuerung der pflegerischen Prozesse zu kümmern.
Hintergrund des Urteils war ein Rechtsstreit zwischen einem Altenheimträger (Kläger) und einer Pflegekasse (Beklagte). Der Träger wollte für eine seiner Einrichtungen die Funktion der Einrichtungsleitung mit der Funktion der PDL in einer Stelle verschmelzen. Die zuständige Pflegekasse wollte dieses Vorgehen nicht akzeptieren. Im Endeffekt scheiterte die Klage.
Die gleichzeitige Wahrnehmung der Funktion als Heimleitung und Pflegedienstleitung ist von Gesetzes wegen nicht grundsätzlich untersagt. Die verantwortliche Pflegefachkraft muss ihren Aufgabenbereich aber im Wesentlichen in der verantwortlichen Tätigkeit im Pflegebereich haben. Interessant ist die Urteilsbegründung: »(...) Denn ihr [der PDL] obliegt nach den Vorstellungen des Gesetzgebers nicht nur die Verantwortung im Sinne einer Haftung für pflegerisches Missmanagement und etwaige Fehler, sondern darüber hinaus auch die fachlich-pflegerische Gesamtverantwortung und Leitung. Hierzu zählen in der Regel die Patientenaufnahme und Pflegeanamnese, die fachliche Planung der konkreten Pflegeprozesse, die Überwachung der Qualitätsmaßstäbe sowie die Aufstellung fallbezogener Dienstpläne, die Durchführung von Dienstbesprechungen u. ä.(...)«.
Dieses Urteil macht glasklar deutlich, was wirklich Ihre Aufgaben als Pflegedienstleitung sind. Leider sieht die Realität anders aus, wie die nachstehenden Beispiele ambulant und stationär zeigen:
BeispielDer normale PDL-Alltagswahnsinn (ambulant)
Es ist Freitag, 11:00 Uhr. Für die Region ist Bade-Wetter angesagt und der PDL gelingt es nur mühsam, den Wochenenddienst (insgesamt 22 Touren zu besetzen) abzudecken. In den nächsten zwei Stunden gehen jetzt auch noch fünf Krankmeldungen ein. Auf einen Schlag sind zehn Dienste für Samstag und Sonntag offen. Zwischen 13:00 und 16:00 Uhr ist die PDL damit beschäftigt, diese Dienste abzudecken. Die Widersprüche für zu Unrecht abgelehnte Verordnungen bleiben liegen. Auch die Pflegedokumentationen von einigen Patienten können nicht überprüft werden. Außerdem brennt der PDL das Problem unter den Nägeln, dass bei vielen Patienten die Risikoerfassungen nicht mehr aktuell sind. Auch die Geschäftsführung fragt schon »ob nicht bald der MDK wieder kommt«.
Zwischendurch ruft auch noch der Controller aus der Verwaltung an und mahnt die »überbordenden Überstunden« an. Wie gesagt: ganz normaler PDL-Alltag…
BeispielDer normale PDL-Alltagswahnsinn (stationär)
Auch die stationäre PDL einer Filiale einer Hedge-Fonds-finanzierten Altenheimkette ist in der gleichen Region tätig wie die ambulante Kollegin. Ebenso wie ihre ambulante Kollegin kann sie bereits um 11:00 Uhr am Freitag auf acht Krankmeldungen blicken.
Neben 16 offenen Diensten besteht das Problem, dass die beiden Nachtdienste nicht mit Fachkräften abgedeckt sind und auch für den Spätdienst am Sonntag bislang keine Fachkraftabdeckung gewährleistet ist.
Vorgestern war der Regionalleiter da und forderte den Abbau von 500 Überstunden in den nächsten drei Monaten. Zudem verwies er darauf, dass bei der nächsten MDK-Prüfung nichts schiefgehen dürfe, da mit den Investoren wichtige Gespräche anstünden. Außerdem hat die PDL die Kennzahl »Pflegegradschnitt 3,8« im Nacken, die unbedingt erreicht werden muss. Also, alles ganz normal…
Solche Arbeitssituationen sind mittlerweile weit verbreitet. Vermutlich haben Sie solche Tage schon mehr als genug erlebt. Als PDL stehen Sie unter immer stärkeren wirtschaftlichen Druck, der von Geschäftsführern und Inhabern ausgeübt wird.
Von unten kommt zudem ein ganz anderer Druck hinzu: Viele Mitarbeiter wissen genau, dass sie unersetzlich sind. Verlangen Sie nun als PDL eine Arbeitsleistung, die nicht weniger als der Stellenbeschreibung der (Fach-)kraft entspricht, droht man Ihnen sofort unverhohlen mit dem gelben Schein. Oder die Mitarbeiter sagen gar nichts, schicken Ihnen dafür aber am nächsten Morgen lapidar eine Krankmeldung per What’s App.
Sie sehen sich auch häufig sehr empfindsamen Mitarbeitern gegenüber. Schon die leiseste Kritik wird als schwere persönliche Beleidigung gewertet. Da haben Sie dann doch häufig das Gefühl, in einem Minenfeld der persönlichen Befindlichkeiten unterwegs zu sein. Und jederzeit kann eine Mine hochgehen. Ganz egal, wie behutsam Sie Ihre Schritte setzen. Die Marktmacht liegt klar auf der Seite Ihrer Mitarbeiter.
Vergessen wir auch nicht den ewigen Ärger mit Krankenkassen und den unsäglichen MDK-Prüfungen. Auch hier stehen Sie als PDL im Mittelpunkt: Immer häufiger werden Verordnungen zur häuslichen Krankenpflege zu Unrecht abgelehnt. Fragen Sie dann nach, müssen Sie sich oft mit dummdreisten und frechen Sachbearbeitern auseinandersetzen und für das Recht Ihrer Patienten kämpfen. War es das an Problemen? Ach nein, da ist ja noch der wirtschaftliche Druck, unter dem Sie stehen…
Ein unbedarfter, branchenfremder Leser würde jetzt vielleicht davon ausgehen, dass Sie für all diese Arbeit, für diesen Druck und die ständigen Probleme, auch fürstlich bezahlt werden. Naja, es gibt ja auch verarmte Fürsten… Tatsächlich verdient eine Pflegedienstleitung laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit im Schnitt 3.921 Euro brutto im Monat5. Zum Vergleich: Ein Teamleiter bei der AOK verdient 5.100 Euro pro Monat, im Jahr 61.200 Euro brutto6.
Fakt ist: Eine Position mit einer hohen Verantwortung zur Sicherstellung von Schlüsselprozessen ist deutlich schlechter entlohnt als ein Angestellter im Gesundheitssystem ohne persönliches Haftungsrisiko. Ich denke, wir alle können Kollegen verstehen, die zu den Kranken- und Pflegekassen abwandern. Dort locken eine 4,5-Tage-Woche, keine Verantwortung für das eigene Handeln, dafür aber ein hohes Gehalt sowie komplett freie Wochenenden und Feiertage.
Hier muss sich ganz schnell etwas ändern! Der Anreiz muss doch für eine Pflegefachkraft der sein, mit erster Priorität einen Job in ihrem erlernten Beruf ausüben zu wollen.
Deshalb zielen viele Abschnitte in diesem Buch darauf ab, Sie als PDL in allen Bereichen zu stärken, bei denen es bislang noch etwas fehlt:
Verhaltenssteuerung bei Mitarbeitern
Wie eben geschildert, ist der Umgang mit den Befindlichkeiten der Mitarbeiter ein großer Teil der PDL-Arbeit geworden. Es gibt aber Methoden, damit besser umgehen zu können. Wenn Sie solche Methoden kennen und anwenden, stärken Sie das und verschafft Ihnen selber wieder mehr Ruhe für die übrige Arbeit.
Stärkung des Zusammenhaltes im Team
Je stärker Ihr Team Ihnen den Rücken freihält, desto leichter wird Ihnen Ihre Arbeit fallen, weil es weniger Widrigkeiten in Bezug auf kurzfristige Personalausfälle und unerledigte Aufgaben gibt. Oft hilft eine kurzfristig zeitintensive Intervention, um dafür aber mittel- bis langfristig erhebliche Verbesserungen im Miteinander zu erleben.
Ausbau betriebswirtschaftlicher Kompetenzen
Gerade wenn es darum geht, nach »oben« eine Gehaltserhöhung für Mitarbeiter oder auch eine etwas kostspieligere Fortbildung argumentativ zu vertreten, endet das oft mit dem berühmten Biss auf Granit. Je besser Sie aber die betriebswirtschaftlichen Hintergründe und Wirkmechanismen des ambulanten Geschäftes verinnerlichen, desto gestärkter gehen Sie in solche Gespräche und erhöhen Ihre Erfolgsaussichten.
Erweiterung des Standes bei den Vorgesetzten
Je besser Sie in Bezug auf Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz bei den Vorgesetzten angesehen sind, desto eher wird man Ihnen zuhören und desto mehr Gewicht haben Ihre Worte. Das führt automatisch dazu, dass Sie z. B. in der Krise eher mit Unterstützung von »oben« rechnen können. Das gilt nicht zuletzt auch für Finanzmittel, die Sie einsetzen können, um Ihre und die Ziele Ihres Pflegeunternehmens zu erreichen.
FazitVerschaffen Sie sich Luft!
Momentan können Sie an den Rahmenbedingungen nichts ändern. Sie können sich aber innerhalb dieser Rahmenbedingungen Luft verschaffen und sich ein wesentlich besseres Arbeitsumfeld schaffen.
Das geht nicht von heute auf morgen, aber den ersten Schritt möchte ich Ihnen zeigen: Sie haben viele Stärken, derer Sie sich manchmal gar nicht bewusst sind. Der erste Schritt ist deshalb: Lernen Sie Ihre Stärken kennen (dafür gibt’s u. a. dieses Buch) und nutzen Sie sie!
1.1Gestatten: Das ist Ihr Job!
Wenn ich einem Branchenfremden versuche, in wenigen Worten die Funktion einer Pflegedienstleitung zu beschreiben, nutze ich gern den Begriff des Betriebsleiters. Das ist derjenige, der durch die Werkshallen geht, die Arbeitsprozesse überwacht und bei Bedarf auch einmal eingreift.
Diese klassische Tätigkeit sehe ich auch manchmal noch bei stationären Pflegedienstleitungen. Eine stationär tätige PDL sagte mir mal: »Eigentlich brauche ich kein Büro. Ich bin den ganzen Tag im Haus auf den Wohnbereichen unterwegs.« Es gibt nicht wenige Pflegedienstleitungen, die sich eine ähnliche Berufsausübung wünschen würden.
Doch seit auch in der Altenpflege seit etwa 25 Jahren die Bürokratie wie Krebs wuchert und es sogar noch eine Kontrollinstanz dafür gibt (MDK), hat sich auch der Job der PDL gewandelt: weg von der Praxis hin zum Papiermanager. Tabelle 1 zeigt Ihnen eine klassische Stellenbeschreibung einer ambulanten Pflegedienstleitung, wie sie heute allgemeingültig ist7:
Tab. 1: Stellenbeschreibung »PDL ambulant«
Einrichtung
Pflegedienst XY
Anschrift
Straße, Ort
Bereich
Ambulanter Pflegedienst
Stellenbezeichnung
Pflegedienstleitung
Stelleninhaber/in
Name Mitarbeiter/-in
Anschrift
Anschrift Mitarbeiter/-in
Vorgesetzte Stelle
Geschäftsführung
Weisungsbefugnisse
Dienst- und Fachaufsicht über alle Mitarbeiter im Pflege- und Hauswirtschaftsbereich, einschließlich der Auszubildenden und Praktikanten
Qualifikation
460 Stunden Weiterbildung Pflegedienstleitung gem. § 113 SGB XI mind. 2 Jahre Berufserfahrung, davon mindestens 1 Jahr im Bereich der ambulanten Kranken- und Altenpflege, Abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpfleger/-inAbgeschlossene dreijährige Ausbildung als Altenpfleger/-in
Stelleninhaber/-in wird vertreten von
stv. Pflegedienstleitung
Ziele der Stelle
• Kundenzufriedenheit sicherstellen
• Qualitätssicherung in der Pflege
• Sicherstellung des Pflegeprozesses
• Sicherstellung Informationsfluss
• Die Ausführung, fachlich qualifizierter Pflege durch eigenverantwortliche Planung, Koordination und Organisation des Pflegedienstes sicherzustellen
• Einsatzkoordination unter ökonomischen Gesichtspunkten
• Zeitgemäße und sachgerechte Personalpolitik
• Sicherung der Motivation und Arbeitszufriedenheit im Team
• Repräsentation der Einrichtung, Auszubildenden
• Entwicklung unseres Pflegedienstes positiv mitgestalten
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungsbereich
1. Kundenbezogene Aufgaben
1.1 Leitungsbezogene Aufgaben
1.2 Pflegeverlauf
1.3 Grundpflege
1.4 Behandlungspflege
1.5 Sterbebegleitung
1.6 Angehörigenarbeit
1.7 Zusätzliche Betreuungsangebote gemäß § 45 a SGB XI für Versicherte mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf
1.1 Leitungsbezogene Aufgaben
• Durchführung von Erstbesuchen (zu Hause oder im Krankenhaus)
• Erstellung der Pflegeanamnese/SIS®
• Kontrolle und Sicherstellung des Pflegeprozesses
• Durchführung von Pflegevisiten
• Verantwortung für die fachgerechte Führung, Einrichtung und Entwicklung der Pflegedokumentation (ggf. in Absprache mit dem Geschäftsinhaber)
• Verantwortung für die fachliche Planung der Pflegeprozesse
• Überprüfung der durchgeführten Maßnahmen
• Evaluation des Pflegeprozesses in Absprache mit den Mitarbeitern
• Entwicklung und Einführung von Pflegestandards
• Aufsicht und Kontrolle bei der Anwendung der Pflegestandards
• Individuelle und umfassende Beratung von Angehörigen
• Erfassen und Aktualisieren der Patientendaten über EDV
• Verantwortung für die wirtschaftliche Beschaffung notwendiger Pflegehilfsmittel
• Aufsicht, Anleitung und fachliche Beratung der Mitarbeiter
• Mitwirkung an und Weiterentwicklung von Qualitätssicherungsmaßnahmen
• Durchführung der Beratungsbesuche nach § 37.3 SGB XI
• Gespräche und Kontaktpflege mit den behandelnden Ärzten
• Einführung neuer Pflegesysteme, Pflegemethoden, Pflegehilfsmittel
• Anleitung der Pflege bei fachspezifischen Krankheitsbildern
• Entwicklung und Umsetzung eines Pflegekonzeptes
• Verantwortung für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben (SGB XI, SGB V)
• Entwicklung und Umsetzung neuer Erkenntnisse und Ideen
• Beantragung von Leistungen nach SGB XI, SGB V, SGB XII
• Verantwortung für die Einhaltung der Hygienevorschriften
• Entscheidung über den Einsatz von Sachmitteln in der Pflege
1.2 Pflegeverlauf
• Vervollständigung der Pflegeanamnese mit Problemauflistung
• Erstellung der individuellen Pflegeplanung unter Einbeziehung der Angehörigen und/oder andere Pflegepersonen sowie Berücksichtigung von Pflegestandards gemäß Pflegemodell
• Evaluation der erfolgten Pflegemaßnahmen und entsprechende Anpassung des Pflegeplans
• Kontinuierliche Führung der Pflegedokumentation, insbesondere unter Berücksichtigung der sofortigen, vollständigen, lückenlosen und richtigen Eintragung der Daten
• Nach erfolgtem Einsatz sind die Leistungen mit dem jeweiligen Handzeichen und der Angabe der Uhrzeit zu dokumentieren
• Zusätzlich erbrachte Leistungen bzw. nicht erbrachte Leistungen sind zu dokumentieren
1.3 Grundpflege
• Übernahme, Beaufsichtigung und/oder Unterstützung bei der Körperpflege unter Beachtung der Regeln der aktivierenden Pflege sowie medizinischer, aktueller pflegewissenschaftlicher, hygienischer und wirtschaftlicher Erkenntnisse
• An- und oder Auskleiden
• Kontinenztraining, Pflege bei Inkontinenz, Intimtoilette, allgemeine Hilfestellung
• Hilfe bei der Nahrungsaufnahme, mundgerechtes Zubereiten der Nahrung,
• Vorbereiten und Verabreichen von Sondennahrung über eine PEG
• Durchführung prophylaktischer Maßnahmen wie
– Dekubitusprophylaxe
– Pneumonieprophylaxe
– Thromboseprophylaxe
– Soor- und Parotitisprophylaxe
– Kontrakturprophylaxe
• Betten, Umbetten und Lagern unter Berücksichtigung aktueller pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der Regeln für aktivierende Pflege, Mobilisation
• Gebrauch zweckdienlicher und erforderlicher Lagerungshilfen und Pflegehilfsmittel
• Allgemeine Krankenbeobachtung
• Aktive und passive Bewegungsübungen
• Mobilisation der Kunden unter Beachtung aktivierender Pflege
• Hilfestellung bei der Verrichtung von Tätigkeiten wie z. B. Aufstehen und Zu-Bett-Gehen, Aufsetzen im Bett, Gehen, An-, Um- und Auskleiden
• Hilfestellung und Unterrichtung beim Gebrauch von Pflegehilfsmitteln u. Hilfsmitteln wie:
– Gehhilfen, Rollstuhl, Lifter, Badehilfen,
• Pflegemaßnahmen bei infektiösen Patienten unter Berücksichtigung hygienischer Erkenntnisse und Notwendigkeiten
1.4 Behandlungspflege
• Sachgemäße und fachgerechte Ausführung der ärztlichen Verordnung
• Absaugen der oberen Luftwege
• Bronchialtoilette
• Anleitung bei der Behandlungspflege
• Bedienung und Überwachung des Beatmungsgerätes
• Blasenspülung
• Blutdruckmessung
• Blutzuckermessung
• Dekubitusbehandlung
• Überprüfen und Versorgen von Drainagen
• Einlauf, Klistier, Klysma, digitale Enddarmausräumung
• Flüssigkeitsbilanzierung
• Überwachung der Infusionstherapie iv
• Inhalation
• Injektionen i.m. und s.c.
• Richten von Injektionen
• Instillation
• Auflegen von Kälteträgern
• Versorgung eines suprapubischen Katheters
• Einlegen, Entfernen und Wechseln eines transurethralen Dauerkatheters in die Harnblase
• Spezielle Krankenbeobachtung
• Legen und Wechseln einer Magensonde
• Richten von ärztlich verordneten Medikamenten
• Verabreichen von ärztlich verordneten Medikamenten, z. B. Tabletten, Augen-, Nasen- und Ohrentropfen, Salben, Tinkturen, Lösungen, Aerosole, Suppositorien
• Versorgung bei PEG
• Stomabehandlung, z. B. Urostoma, Anus praeter
• Wechsel und Pflege der Trachealkanüle
• Pflege des zentralen Venenkatheters
• Anlegen und Wechseln von Wundverbänden
• Anlegen eines Kompressionsverbandes, An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen
• Anlegen von stützenden und stabilisierenden Verbänden
• Kommunikation mit behandelndem Arzt über Behandlungsänderungen
1.5 Sterbebegleitung
• Pflege Sterbender unter Berücksichtigung der besonderen und individuellen Situation
• Betreuung und Begleitung Sterbender und deren Angehörige; Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit Sterben und Tod
• Überwachung einer symptomlindernden Behandlung und/oder Hilfestellung bei der Anwendung anderer Maßnahmen zur Symptomlinderung
• Versorgung Verstorbener
1.6 Angehörigenarbeit
• Einbeziehung der Angehörigen und Bezugspersonen in die Pflege
• Anleitung und Kontrolle pflegender Angehöriger
• Information und Beratung von Angehörigen und Bezugspersonen
1.7Zusätzliche Betreuungsangebote gemäß § 45a SGB XI für Versicherte mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf
• Organisation und Planung der zusätzlichen Betreuungsangebote gemäß § 45a SGB XI für Versicherte mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf
2. Mitarbeiterbezogene Aufgaben
• Einarbeitung neuer Mitarbeiter nach Einarbeitungskonzept
• Führen von Vorstellungsgesprächen im Bereich Pflege
• Beteiligung bei Entscheidungen über Einstellung, Entlassung oder anderer Förder- und Disziplinarverfahren der Mitarbeiter im Bereich Pflege
• Durchführung von Beurteilungsgesprächen sowie das Schreiben von Arbeitszeugnissen für die Mitarbeiter im Bereich der Pflege
• Erstellung von Dienstanweisungen und Arbeitsanordnungen in Absprache mit der Geschäftsleitung
• Aufsicht, Kontrolle und Anleitung bei der Erfüllung der zugeteilten Aufgaben der Mitarbeiter im Bereich Pflege
• Durchführung von Mitarbeitervisiten
• Beratung und Hilfestellung für Mitarbeiter in Konfliktsituationen mit Patienten und Angehörigen
• Förderung einer guten Arbeitsatmosphäre
• Motivation der Mitarbeiter fördern
• Kontrolle der Stundennachweise, Pflegetaschen, Autopflege
• Organisation der betriebsärztlichen Untersuchungen
• Verantwortung für die Kooperation mit Alten- und Krankenpflegeschulen sowie die praktische Ausbildung der Schüler innerhalb der Einrichtung
3. Betriebsbezogene Aufgaben
• Verantwortung für die Dienst- und Tourenpläne unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit, sowie der Kunden- und Mitarbeiterwünsche
• Erstellung des jährlichen Urlaubsplanes
• Genehmigung von Urlaubsanträgen
• Fachliche Leitung regelmäßiger Fall- und Dienstbesprechungen (1 x wöchentlich)
• Besprechung mit der Geschäftsleitung zum Austausch betriebsnotwendiger Informationen
• Planung der hauswirtschaftlichen Einsätze
• Planung von innerbetrieblicher und außerbetrieblicher Fortbildung unter Berücksichtigung der individuellen Bedarfe der Mitarbeiter
• Entscheidung über Teilnahme der Mitarbeiter an externen Fortbildungsmaßnahmen
• Durchführung innerbetrieblicher Fortbildungsmaßnahmen
• Organisation des Formularwesens, Patientenakten, Mitarbeiterakten
• Überprüfung der Verordnungen, Leistungsbescheide und Leistungsnachweise auf sachliche und fachliche Richtigkeit und ordnungsgemäße Ausführung
• Aktualisierung und Erweiterung der pflegediensteigenen Fachliteratur
• Verantwortung für die fachgerechte Durchführung von Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen sowie Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften
• Akquise neuer Kunden
• Kontaktpflege und Darstellung des Pflegedienstes und seiner Leistungen gegenüber Kooperationspartner, Ärzten, Sozialarbeitern, Kranken- und Pflegekassen, Behörden und Verwaltungen, Selbsthilfegruppen, andere Pflegeeinrichtungen
• Betreuung der Kooperationspartner (z. B. Ärzte, Kostenträger )
4. Persönliche Eigenschaften
• Einsatzbereitschaft und Flexibilität
• Außerordentliche Fähigkeit und Bereitschaft zur Kommunikation
• Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung
• Sicheres Auftreten und Durchsetzungsvermögen
• Organisationsfähigkeit
• Belastbarkeit
• Entscheidungsfreudigkeit
• Urteilsvermögen
• Verantwortungsbereitschaft
• Fähigkeit zur Teamarbeit und Organisation
Diese Stellenbeschreibung wurde mit mir besprochen und mir ausgehändigt. Sie ist Bestandteil des Arbeitsvertrages.
_____________Ort, Datum_____________Unterschrift Geschäftsinhaber_____________Unterschrift StelleninhaberAus dieser Stellenbeschreibung geht schon hervor, welche Ansprüche man heute an Sie als Pflegedienstleitung stellt. Vereinfacht gesagt, müssen Sie eine maximale berufliche Spannweite abbilden: vom kaufmännischen Leiter bis hin zum Seelsorger und vom Therapeuten bis hin zum halben Mediziner.
Wenn Sie all diese Aufgaben sämtlich zu 100 Prozent erfüllen möchten, werden Sie mit der gesetzlichen Wochenarbeitszeit kaum hinkommen. Was hinter den meist harmlosen Formulierungen steckt, erläutere ich Ihnen an drei Beispielen (Tab. 2):
Tab. 2: Drei Beispiele für die Übersetzung der Anforderungen aus einer PDL-Stellenbeschreibung
Formulierung in der Stellenbeschreibung
Übersetzung in den Arbeitsalltag
1.1. Leitungsbezogene Aufgaben
»Verantwortung für die fachliche Planung der Pflegeprozesse.«
Die PDL muss für alle Patienten Pflege- und Dokumentationsvisiten durchführen, auswerten und die entdeckten Mängel beheben bzw. beheben lassen. Pro Visite können durchaus 2–3 Arbeitsstunden auflaufen.
2. Mitarbeiterbezogene Aufgaben
»Aufsicht, Kontrolle und Anleitung bei der Erfüllung der zugeteilten Aufgaben der Mitarbeiter im Bereich Pflege.«
Die Pflegedienstleitung muss neben der Überwachung der Mängelbearbeitung aus Pflege- und Dokumentationsvisiten ständig dafür Sorge tragen, dass die Pflegeprozessdokumentation den haftungsrechtlichen und vertraglichen Anforderungen einander stets entsprechen.
3. Betriebsbezogene Aufgaben
»Verantwortung für die Dienst- und Tourenpläne unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit, sowie der Kunden- und Mitarbeiterwünsche.«
Die Pflegedienstleitung muss jeden einzelnen Einsatz so planen, dass dieser gewinnbringend ist. Die Touren müssen stets einsatz- und fahrtzeitoptimiert sein (Gewinnmaximierung) und zu den Qualifikationen der Mitarbeiter passen (SGB V-Vertragskonform!).
Allein diese Aufgaben kommen einem Vollzeit-Job schon recht nahe. Für die stationäre PDL entfallen zwar große Bereiche der betriebswirtschaftlichen Steuerung – dafür muss sie aber in diesem Zusammenhang meistens genau auf den Materialverbrauch achten, insbesondere auf den Verbrauch von Inkontinenzmaterial. Das Gleiche gilt für die Dienstplankennzahlen und den Pflegegradschnitt in der Einrichtung. Hier steht die stationäre PDL oft unter enormen Druck »von oben«.
1.2Gesellschaftliche Umwälzungen – nur eine Hypothese oder doch belegbar?
Der wohl schlimmste Stressfaktor für Pflegedienstleitungen ist heutzutage das Personalmanagement – v. a. die Einsatzplanung und die Personalentwicklung. Viele Führungskräfte aus meiner Generation (1972) und älter schildern einstimmig, dass es früher selbstverständlich war, Weisungen auszuführen. Auch ein Dienst- und Tourenplan war verbindlich. Die Diskussionen um Kleinkram und das Aufbauen von Vermeidungsstrategien haben erst in den letzten ca. 15 Jahren überhandgenommen.
Mittlerweile ist es für eine PDL unmöglich, sich auf die Einhaltung des Dienst- und Tourenplanes zu verlassen. Vor allem dann nicht, wenn Kirmes, Karneval, Brückentage und Badewetter anstehen. Oder der entfernte Onkel zum dritten Mal in den letzten acht Monaten beerdigt wird (um dem ungeliebten Spätdienst zu entrinnen). Auch die Forderungen der Mitarbeiter (»nur 1x im Monat Wochenenddienst« – »Ich kann nur Frühdienst arbeiten«) werden immer dreister.
BeispielDiabetes oder nicht?
Vor kurzem hat mir eine Inhaberin eines ambulanten Pflegedienstes in einer eher strukturschwachen Region Folgendes geschildert: »Meine Mitarbeiterin Frau X. kann nach eigener Aussage keine Spätdienste mehr machen. Sie hat angeblich Diabetes und Asthma und will nun vom Arzt ein Attest erwirken, das ihr die Ausübung des Spätdienstes unmöglich macht.
Nun muss man wissen, dass die Kollegin Kette raucht und ich sie noch nie mit Lungenschmerzen und Atemnot erlebt habe. Auch ihre Ernährungsgewohnheiten (Cola, Schokoriegel) lassen nicht gerade auf einen Diabetes schließen. Ich weiß langsam nicht mehr weiter. Ich brauche diese Mitarbeiterin im Wechselschichtsystem, weil wir sonst die Fachkrafttouren nicht mehr abdecken können. Neues Fachpersonal ist hier nicht zu finden.«