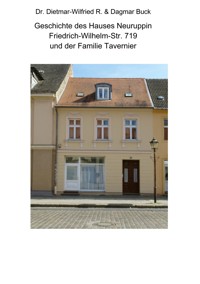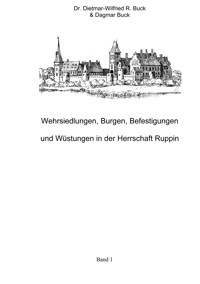
Wehrsiedlungen, Burgen, Befestigungen und Wüstungen in der Herrschaft Ruppin E-Book
Dietmar-Wilfried R. Buck
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ur- und Frühgeschichte des Ruppiner Landes
- Sprache: Deutsch
Das Land Brandenburg hat eine spannende Historie. Aus der Ur- und Frühgeschichte sind in etwa 35. 000 Bodendenkmale bekannt. Deren wissenschaftliche Auswertung gibt uns einen umfassenden Einblick in die Lebensumstände der ersten Menschen, die seit der mittleren Steinzeit (seit 12.000 Jahre v. u. Z.) bis zum Ende des Mittelalters (15. Jh. u. Z.) in Brandenburg lebten. Im vorliegenden Band werden bronzezeitliche Wehrsiedlungen (1100 bis 900 v. u. Z.), die Geschichte der slawischen Besiedlung, slawische Burgen und Kultstätten (6.-12. Jh. u. Z.), die mittelalterlichen Städte mit ihren Befestigungen, die mittelalterliche Wüstungsperiode, mittelalterliche Landwehren in der Herrschaft Ruppin sowie das letzte Ritterturnier in Norddeutschland beschrieben. Dem Buch ist ein umfangreiches Literaturverzeichnis beigefügt, aus dem der interessierte Leser weitere Informationen einholen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Die bronzezeitliche Wehrsiedlung auf dem Weilickenberg
2.1. Die slawischen Burgen im Ruppiner Land
2.2. Die Fürstenburg auf dem Poggenwerder und der Tempel von Altfriesack
2.3. Die Adelsburg bei Wildberg und die Fluchtburg bei Bertikow
2.4. Weitere slawische Burgwälle im Ruppiner Land
3.1. Die Burg Arnstein
3.2. Die Planenburg
3.3. Die Burg Goldbeck
3.4. Die Burgen der Ritter
4.1. Stadt Neuruppin
4.2. Stadt Gransee
4.3. Stadt und Kloster Lindow
4.4. Stadt und Burg Rheinsberg
4.5. Stadt Wildberg
4.6. Stadt und Burg Wusterhausen
4.7. Stadt und Burgen Freyenstein
5. Die Landwehren
6. Ortswüstungen
7. Das Neuruppiner Turnier von 1512
8. Fundlisten
9. Literaturverzeichnis
1. Die bronzezeitliche Wehrsiedlung auf dem Weilickenberg
Am Nordufer des Tornowsees erhebt sich eine 43 m hohe Anhöhe, die den Namen „Weilickenberg“ trägt (Abb. 1). Hier befand sich in der jüngsten Bronzezeit (1100 bis 900 v. u. Z.) die befestigte Siedlung einer indoeuropäischen Bevölkerung. Das 510 m lange und 310 m breite Plateau besitzt im Nordosten, Osten und Südosten steil abfallende Hänge. Die Nord- und Westhänge waren mit dreifachen Wällen befestigt (Abb. 4). Zusätzlich verlief hier der Binenbach, der erst beim Bau der Boltenmühle seinen jetzigen Verlauf erhielt. Noch heute ist dieser alte Bachverlauf im Gelände deutlich zu erkennen (Abb. 3). Die West- und Südseite waren durch den Steilabfall und den See geschützt, sodass hier wohl eine einfache Palisade ausreichte. Der Eingang in die Siedlung lag im Norden (Abb. 5, Tor 1). Im Westen befand sich ein zweites Tor, von dem man zum Bach gelangte und Wasser holen konnte (Abb. 5, Tor 2). Der Bach wurde durch einen noch heute sichtbaren Damm aufgestaut (Abb. 5).
In der Siedlung standen Pfostenhäuser, von denen sich noch die Pfostengruben und der Lehmbewurf der Wände erhalten haben. Die Wände der Häuser waren innen mit verzierten Wandtellern geschmückt (nach einem Fundort als Köpenicker Teller bezeichnet). Davon wurden mehrere Fragmente gefunden.
Aus den zahlreichen Abfallgruben wurden als Speiseabfälle Knochen von Rindern geborgen. Daneben liegen auch Knochen von Schwein, Schaf/Ziege, Pferd und Hund vor. Zur Ergänzung wurden, wie wir aus anderen Siedlungen dieser Zeit wissen, Wildtiere gejagt. Der See bot auch die Möglichkeit des Fischens. Steine mit Rillen dürften als Netzsenker Verwendung gefunden haben. Sicherlich wurden auch Muscheln gesammelt, wie dies für eine Siedlung in Altruppin belegt ist. In den Abfallgruben befanden sich auch zahlreiche Scherben von zerbrochenem Haushaltsgeschirr, u. a. von Töpfen, Wannengefäßen und Schalen. Ein großer Teil der heute vorliegenden Funde wurde 1960 bei einer Sondierungsgrabung durch die Akademie der Wissenschaften geborgen und befindet sich heute im Museum Neuruppin.
Ein Sichelfragment (Abb. 8) weist auf den Ackerbau hin. Die Felder wurden durch Brandrodung gewonnen. Bestellt wurde der Acker mit einem hölzernen Hakenpflug. Leider haben sich Pflanzenreste nicht erhalten. Von anderen Siedlungen dieser Zeit wissen wir, dass Hirse, Gerste, Weizen, Linsen, Bohnen, Erbsen und Leindotter angebaut wurden. Außerdem beginnt in dieser Zeit der Anbau von Roggen, Hafer und Buchweizen. Weiterhin wurden Wildpflanzen, Wurzeln und Pilze gesammelt.
Die Wehrsiedlung war das wirtschaftliche Zentrum eines Siedlungsgebietes. Ihre Errichtung war Ausdruck eines bestimmten sozialökonomischen Entwicklungstandes und einer Gefahrenlage. Sie entstand zum Schutze des ökonomischen, strategischen, politischen und religiösen Zentrums einer Siedlungsgemeinschaft. Zu ihr gehörten viele kleinere Siedlungen, Weiler und Einzelgehöfte. In der Wehrsiedlung dürften Märkte und Versammlungen abgehalten worden sein. Zum Schutz dieses Zentrums wurden die sehr arbeitsaufwendigen Wehranlagen errichtet und unterhalten. Dazu bedurfte es einer zentralen Organisation. Wir können davon ausgehen, dass hier die gesellschaftliche Elite saß. Zu dieser Gentilaristokratie gehörten der Stammeshäuptling sowie Priester/Schamanen und Heilkundige. Eine weitere Aufgabe dieser Elite dürfte in der Organisation des Handels bestanden haben.
Abb. 1. Der Weilickenberg vom Tornowsee ausgesehen.
Abb. 2. Die Innenfläche der Wehrsiedlung.
Abb. 3. Ursprünglicher Verlauf des Binenbaches westlich des Weilickenberges.
Abb. 4. Weilickenberg. Wälle und Tor.
Eine Sonderstellung nahmen handwerkliche Spezialisten wie Metallurgen ein. In der Wehrsiedlung Weilickenberg war ein Bronzegießer ansässig. Hier fand er Schutz vor Überfällen und konnte von seinen Abnehmern leicht erreicht werden. Von der Tätigkeit des Bronzegießers zeugt die Gussform für eine Fibel (Abb. 7) und das Fragment eines Gusstiegels. Kannelurensteine, wie sie an der Neuen Mühle bei Altruppin gefunden wurden, sind ebenfalls Handwerkzeug des Bronzegießers. Fibeln und Nadeln dienten zum Verschließen des Gewandes. Der
Abb. 5. Die Wehrsiedlung mit Befestigung, Toren und Staudamm.
Abb. 6. Getreidemahlstein mit Reibstein.
Abb. 7. Steingussform für eine Fibelnadel.
Abb. 8. Lanzenspitze, Beil, Punzen, Armring, Sichel, Messer aus Bronze
Abb. 9. Obere Reihe. Steinäxte vom Weilckenberg. Daneben zum Vergleich Steinaxt und Bohrkern von Klein Lieskow. Untere Reihe. Spielsteine aus Stein und Keramik.
Metallurge hat u. a. Bronzelanzenspitzen, Bronzebeile, Bronzesicheln, Bronzepunzen, Bronzemesser, Bronzearmringe und Bronzenadeln gefertigt (Abb. 8). Bronze (eine Legierung von 90 % Kupfer und 10 % Zinn) musste von weither eingetauscht werden (wahrscheinlich aus dem Alpenraum). Sie war also sehr wertvoll. Ein Hort eines Bronzegießers wurde 2016 in Sonnenberg entdeckt. Er enthielt zehn Bronzebarren, einen Gußkuchen und ein Tüllenbeil der jüngsten Bronzezeit (1000 – 700 v. u. Z.). Der Bronzegießer hatte zwar eine Sonderstellung inne, dürfte aber kaum von der der landwirtschaftlichen Produktion freigestellt gewesen sein. Dazu war der Umfang der Metallurgie zu gering. Weitere handwerkliche Spezialisten könnten sich in der Keramikproduktion und bei den Knochenschnitzern herausgebildet haben.
Zur Verteidigung der Wehrsiedlung war die Produktion von Waffen wichtig. Dafür war der Bronzegießer zuständig. Hauptwaffe waren Pfeil und Bogen sowie Lanzen. Auch Tüllenbeile und Holzkeulen dienten als Waffen. Schwerter besaßen wohl nur die Angehörigen der Stammeselite. Sie wurden im Ruppiner Land in mehreren Hügelgräber und als Opferfunde in Mooren (Altruppin) gefunden. Insgesamt sind zehn Bronzeschwerter aus dem Umkreis bekannt.
Neben der Bronze bzw. von Kupfer und Zinn war der Import von Salz sehr wichtig. Salz ist für Mensch und Tier lebensnotwendig und wurde in großer Menge für die Konservierung von Fleisch und Fischen verwendet. Neue Untersuchungen haben ergeben, dass das Salz aus dem Raum Halle importiert wurde. Im Havelgebiet gibt es allerdings auch Salzsolequellen.
Da Bronze nicht genügend vorhanden war, wurde auch wieder auf Stein zurückgegriffen, wie zwei zerbrochene Äxte belegen (Abb. 9). Eine der Steinäxte weist eine begonnene Hohlbohrung auf. Vermutlich zerbrach sie bei der Bohrung des Axtloches. Auch die andere Axt ist am Bohrloch zerbrochen. Ein Mahlstein mit Reibstein weist auf die mühevolle Tätigkeit der Mehlgewinnung hin (Abb. 6), die zur Tätigkeit der Frauen gehörte. Aus dem Mehl wurden Brotfladen hergestellt und auf erhitzten Steinen oder in Backöfen gebacken. Hauptnahrungsmittel war ein mit Bienenhonig gesüßter Hirsebrei.
Die Bewohner nutzten in ihrer Freizeit aus Scherben zersprungener Gefäße und Steinen gefertigte Spielsteine, von denen einige an- oder durchbohrt waren (Abb. 9). Es ist leider unbekannt, wie dieses Spiel aussah.
Auf die Glaubensvorstellungen weisen Fragmente von Tiergefäßen hin, die wohl bei kultischen Trinkgelagen oder Trankopfern Verwendung fanden.
Eine kleine Siedlung befand sich unweit an der Mündung der Kunster am Ufer des Tornowsees (Abb. 10 und Fundplatzliste 1). Mit Sicherheit lagen im Umkreis der Wehrsiedlung zahlreiche kleine Siedlungen und Einzelgehöfte. Da das Gebiet heute dicht bewaldet ist, dürften viele Siedlungen bisher unentdeckt geblieben sein. Im Ruppiner Land gibt es jedoch zahlreiche Belege für eine bronzezeitliche Besiedlung. Ein Kilometer östlich der Wehrsiedlung befindet sich ein Hügelgräberfeld. Ein weiteres liegt drei Kilometer westlich davon nahe Steinberge. In derartigen großen Grabhügeln wurde die Elite bestattet.
Beachtlich ist die hohe Zahl von Horten. Bei den Horten handelt es sich um wertvolle Bronzen, die häufig an abgelegenen markanten Stellen niedergelegt wurden. Sie enthalten Waffen (Schwerter, Lanzenspitzen und Pfeilspitzen) so wie Schmuck- und Trachtbestandteile (Nadeln und Fibeln [zum Verschließen des Gewandes], Hals-, Arm- und Fußringe). Die Gründe für ihre Niederlegung sind vielfältig. Einige wurden in moorigen Gebieten, z. B. in Sieversdorf, oder Furten, z. B. am „Großen Wummsee“, niedergelegt und dürften Opfergaben an chtonische (unterirdische) Mächte gewesen sein. Dazu gehört ein 2015 in der Ruppiner Mesche gefundenes Randleistenbeil. Beile waren sowohl Werkzeug als auch Waffe. Andere Horte waren Verstecke in Kriegszeiten. Wenn der Besitzer verstarb und ihn daher nicht mehr bergen konnte, blieb er bis zu seiner meist zufälligen Entdeckung im Boden. Dagegen sind Brucherzfunde wie in der Lausitz, also zerbrochene oder unmoderne Objekte, die zum Wiedereinschmelzen gesammelt wurden, bei uns selten.
Abb. 10. Die Besiedlung in der Bronzezeit. 1 Wehrsiedlung 2 unbefestigte Siedlung 3 Flachgräberfeld 4 Hügelgräber 5 Hortfund 6 Einzelfund
Abb. 11. Biskupin. Straße in der rekonstruierten Wehrsiedlung.
Wie eine Wehrsiedlung aussah, vermittelt uns die Rekonstruktion der ausgegrabenen Wehrsiedlung von Biskupin in Polen (Abb. 11).
Die Bevölkerung gehörte zu einer indoeuropäisch sprechenden Gruppe, die sehr enge Kontakte zu den nördlich wohnenden Stämmen besaß. Darauf deuten das Hörnerknaufmesser und die Fibelnadel hin. Sie besaßen aber auch enge Kontakte zu den südlich wohnenden Stämmen. Dazu gehörten die im Havelgebiet lebenden Stämme und die noch südlicher siedelnden Stämme der sog. „Lausitzer Kultur“. Beide Gruppen gehören ebenfalls zu einer indoeuropäisch sprechenden Bevölkerung.
Zwischen 1480 und 1360 v. u. Z. führten mehrere Vulkanausbrüche mit starken Ascheeruptionen und Ausstoß von Schwefeldioxyd zu einer Klimaschwankung. Gleichzeitig sank der Grundwasserspiegel stark ab. Eine um 1060 v. u. Z. beginnende Warmphase verstärkte das Absinken des Grundwassers. In dieser Warmperiode entstand die Wehrsiedlung auf dem Weilickenberg. Das günstige Klima ermöglichte den Anbau von Hirse und Bohnen. Wasser für Mensch und Tier hatten die Bewohner durch die Aufstauung des Binenbaches in ausreichender Menge zur Verfügung. Warum sie die Wehrsiedlung im Verlauf des 10. Jahrhunderts v. u. Z. verließen ist unbekannt. Möglicherweise hatte sich die Gefahrenlage verändert. Auch könnte der Wald durch Klimawandel, Waldweidewirtschaft und Holzentnahme weitgehend vernichtet worden sein. Die Trockenphase dauerte bis in das 7. Jahrhundert v. u. Z. Danach begann eine Kaltphase mit Vernässung der Niederungen. Dies hatte zur Folge, dass sich die Wirtschaftsform änderte. Große präurbane Siedlungen wie die auf dem Weilickenberg wurden durch kleine weilerartige Siedlungen und Einzelgehöfte ersetzt. Die Handelsverbindungen in den Alpenraum brachen ab. Damit kam es zu einem deutlichen Mangel an Bronze. Im norddeutschen Tiefland wurde statt dessen Eisen aus dem heimischen Raseneisenstein in den Niederungen gewonnen. Gleichzeitig änderte sich auch die materielle Kultur der Bevölkerung. Aus der indoeuropäischen Bevölkerung entstanden die Germanen, die bei uns keine Wehrsiedlungen errichteten.
Abb. 12. Tongefäß aus der Wehrsiedlung.
2.1. Slawische Burgen im Ruppiner Land
Im Verlauf des 3. und 4. Jahrhunderts unserer Zeit wanderte der u. a. im Ruppiner Gebiet lebende germanische Stamm der Semnonen nach Südwestdeutschland aus. Hier wurde in erbitterten Kämpfen gegen die Römer die römische Grenzbefestigung Limes durchbrochen und die Germanen siedelten sich in dem eroberten Gebiet an. Nur geringe Bevölkerungsreste blieben bei uns zurück.
Seit dem 6. Jh. unserer Zeit wanderten von Osten und Süden her in kleinen Gruppen slawische Siedler ein. Ein slawisches Kultbild aus einer Kultstätte von Altfriesack wurde im 5./6. Jahrhundert unserer Zeit gefertigt. Aus der ersten Hälfte des 7. Jahrhundert unserer Zeit stammt die Riemenzunge von Michaelisbruch. Die eingewanderten slawischen Stämme vermischten sich mit der restlichen germanischen Bevölkerung. Diese wurde assimiliert. Indoeuropäische und germanische Namen von Flüssen (z. B. Dosse und Rhin) wurden von den Einwanderern übernommen bzw. slawisiert. Im 9. Jh. setzte schlagartig eine dichte Besiedlung ein. Zur gleichen Zeit entstanden eine große Anzahl von Burgen und befestigten Siedlungen.