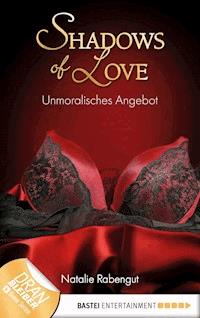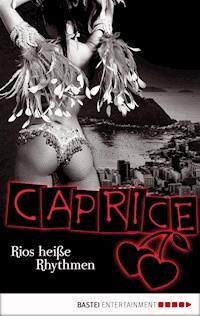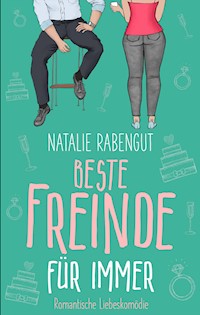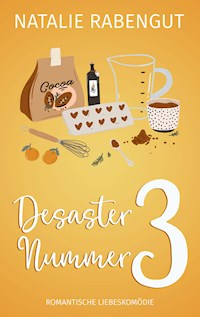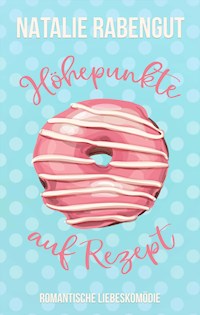Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Black Umbrella Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Weihnachten in Neuhnfelde
- Sprache: Deutsch
Weihnachten im September? Nicht mit mir! Als ich erfahre, dass mein kranker Vater Hilfe braucht, komme ich sofort zurück nach Neuhnfelde. Zum Glück hat er eine neugierige Nachbarin, die sich um ihn sorgt, denn mir hat er nichts davon erzählt. Allerdings hatte ich bestimmt nicht vor, sofort zum neuen Bürgermeister ernannt zu werden, weil ich jung bin und mich »mit diesem Internetdings« auskenne. Die Gesundheit meines Vaters mag angeschlagen sein, aber Neuhnfelde ist schon seit Jahren tot. Außer unangenehmen Erinnerungen und brachliegenden Feldern gibt es hier nichts – erst recht keine Möglichkeit, irgendwie Geld aufzutreiben, um den Ort wiederzubeleben. Ich bin kurz davor, das Handtuch zu werfen, als Bea mit der vermeintlich rettenden Idee auftaucht. Beas Ideen waren schon früher grenzwertig, nur konnte sie sich damals noch darauf verlassen, dass ihre niedlichen Zöpfe und die Zahnspange mit den rosafarbenen Gummis sie vor dem größten Unheil bewahrten. Die Zöpfe und die Zahnspange sind verschwunden, die blöden Ideen sind geblieben. Aber niemand will auf mich hören. Der Stadtrat liebt Beas Idee und will, dass wir gemeinsam an der Umsetzung arbeiten. Das letzte Mal, als ich allein mit Bea war, hatte ich danach eine Platzwunde. Doch dieses Mal sorge ich mich nicht um meinen Kopf, sondern um mein Herz … Romantische Liebeskomödie. In sich abgeschlossen. Gefühlvolle Handlung. Ein Schuss Humor. Explizite Szenen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WEIHNACHTSBAUM GESUCHT
WEIHNACHTEN IN NEUHNFELDE
BUCH EINS
NATALIE RABENGUT
ROMANTISCHE LIEBESKOMÖDIE
Copyright: Natalie Rabengut, 2022, Deutschland.
Korrektorat: http://www.korrekturservice-bingel.de
Covergestaltung: Natalie Rabengut
ISBN: 978-3-910412-13-2
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung ist nachdrücklich nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin gestattet.
Sämtliche Personen in diesem Text sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig.
www.blackumbrellapublishing.com
INHALT
Weihnachtsbaum gesucht
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Nächster Band der Reihe: Weihnachtslied gesucht
Über Natalie Rabengut
WEIHNACHTSBAUM GESUCHT
Weihnachten im September? Nicht mit mir!
Als ich erfahre, dass mein kranker Vater Hilfe braucht, komme ich sofort zurück nach Neuhnfelde. Zum Glück hat er eine neugierige Nachbarin, die sich um ihn sorgt, denn mir hat er nichts davon erzählt.
Allerdings hatte ich bestimmt nicht vor, sofort zum neuen Bürgermeister ernannt zu werden, weil ich jung bin und mich »mit diesem Internetdings« auskenne. Die Gesundheit meines Vaters mag angeschlagen sein, aber Neuhnfelde ist schon seit Jahren tot. Außer unangenehmen Erinnerungen und brachliegenden Feldern gibt es hier nichts – erst recht keine Möglichkeit, irgendwie Geld aufzutreiben, um den Ort wiederzubeleben.
Ich bin kurz davor, das Handtuch zu werfen, als Bea mit der vermeintlich rettenden Idee auftaucht. Beas Ideen waren schon früher grenzwertig, nur konnte sie sich damals noch darauf verlassen, dass ihre niedlichen Zöpfe und die Zahnspange mit den rosafarbenen Gummis sie vor dem größten Unheil bewahrten. Die Zöpfe und die Zahnspange sind verschwunden, die blöden Ideen sind geblieben. Aber niemand will auf mich hören. Der Stadtrat liebt Beas Idee und will, dass wir gemeinsam an der Umsetzung arbeiten.
Das letzte Mal, als ich allein mit Bea war, hatte ich danach eine Platzwunde. Doch dieses Mal sorge ich mich nicht um meinen Kopf, sondern um mein Herz …
Romantische Liebeskomödie. In sich abgeschlossen. Gefühlvolle Handlung. Ein Schuss Humor. Explizite Szenen.
PROLOG
SAMUEL
Siebzehn Jahre zuvor
Mein Herz klopfte schneller und schneller, als Bea näher in meine Richtung rutschte. Sie roch so gut und dann waren da natürlich noch ihre Brüste, die unter dem engen T-Shirt heute irgendwie besonders gut aussahen.
Beas Lächeln funkelte, weil nur Teelichter das Innere das Baumhauses erhellten und ihre Zahnspange das Licht reflektierte. Sie biss sich auf die Unterlippe. »Du hast das schon mal gemacht, richtig?«
Da war so ein hoffnungsvoller Ton in ihrer Stimme, dass ich mich nicht traute, ihr zu gestehen, dass ich nicht die geringste Ahnung hatte, was ich hier überhaupt tat.
»Klar«, behauptete ich einfach mit einem Achselzucken, als wäre es keine große Sache. Dabei war es eine große Sache. Eine sehr große Sache.
Mein Blick fiel auf Beas Mund, auf die hübschen Lippen, von denen ich endlich wissen wollte, wie sie sich auf meinen anfühlen würden. Sollte ich ihr die Wahrheit sagen? Dass ich noch nie ein Mädchen geküsst hatte? Geschweige denn so ein hübsches wie Bea?
»Oh, okay.« Sie sah kurz zur Seite, ehe sie den Rücken durchdrückte und eine wegwerfende Bewegung mit der Hand machte. »Ich meine, ich natürlich auch. Schon total oft.«
Mit wem? Eifersucht flammte in mir auf. Wen bitte hatte Bea geküsst? Ich ging die Jungs in unserer Stufe durch, dann die darüber. Ben vielleicht? Armin? Oder Elmo? Antonio, den alle Mädchen süß fanden, weil sein Vater Italiener war und Antonio die dunklen Haare geerbt hatte?
Bevor ich mich entschieden hatte, wem ich die Nase brechen wollte, weil er meine Bea angefasst hatte, beugte sie sich vor und presste die Lippen auf meine. Irgendwo in meinem Gehirn gab es einen Kurzschluss, weil sie nicht nur die Lippen an mich presste. Ich spürte ihre Brüste. Der Moment fräste sich in mein Gedächtnis. Ich wusste, dass ich mich für immer an den Augenblick erinnern würde, in dem Beatrix Weitz mich geküsst und ich ihren Körper an meinem gefühlt hatte.
Bea richtete sich auf und berührte zaghaft ihre Lippen. »War … war das okay?«
Ich konnte bloß nicken. Es gab so viele Dinge, die ich sagen wollte, aber ich war schlicht nicht in der Lage dazu. Stattdessen beugte ich mich dieses Mal vor und küsste sie. Ich wusste, dass irgendwann unsere Zungen zum Einsatz kommen würden, aber ich hatte keine Ahnung, wie und wann.
Bea war – wie immer – mutiger als ich und strich mit der Zunge über meine Lippen. Als ich den Mund mit einem andächtigen Seufzen öffnete und betete, dass sie meine harte Latte nicht bemerkte, kicherte sie und lehnte sich zurück. »Ist das komisch?«
»Nein.« Meine Stimme klang rau und es juckte mir in den Fingern, Bea an mich zu ziehen und sie zu küssen, bis sie aufhörte, so viel zu reden. Ich hatte keine Konzentration übrig, um mich zu unterhalten.
»Soll ich mein T-Shirt ausziehen?«, schlug sie vor.
Okay, meinetwegen konnte sie doch weiterreden.
»Wenn du willst. Soll ich meins ausziehen?«
Sie legte den Kopf schräg und dachte lange nach. »Ich glaube schon. Aber ich lasse den BH an.«
»Klar.« Ich nickte eifrig, weil ich nehmen würde, was ich kriegen konnte.
»Also willst du mich nicht ohne BH sehen?« Sie schob die Unterlippe vor.
»Doch, aber …«
»Aber was?«
»Deine Eltern.« Ich warf einen Blick aus der Türöffnung des Baumhauses.
»Die kommen abends nie hier raus.« Bea packte den Saum ihres T-Shirts, hielt dann allerdings inne. »Gleichzeitig?«
»Okay.« Ich wartete gar nicht erst auf sie, sondern zerrte mein Shirt über meinen Kopf.
Gebannt musterte ich Bea. Sie war so schön. So, so schön.
»Samuel«, sagte sie und schaute nach unten. »Hör auf, mich so anzustarren.«
»Ich kann nicht.«
»Kannst du mich denn wenigstens noch mal küssen?«
Wieder nickte ich eifrig, bis mir geistesgegenwärtig einfiel, sie zu fragen, was sie wollte. Immerhin hatte sie mehr Erfahrung als ich. »Mit Zunge?«
»Ich … glaub schon.«
Ein paar Minuten später hatte ich den Bogen raus. Oder möglicherweise auch nicht. Die Hauptsache war, dass sich Bea nicht beklagte. Sie hatte die Hand auf meine Brust gelegt und erschauerte sanft, als unsere Zungen sich erneut berührten.
Das hier war das Beste, was ich je erlebt hatte.
Ich strich mit den Fingerspitzen über ihre Rippen, weil ich mich nicht traute, mehr zu machen.
»Samuel«, seufzte sie leise und ließ sich nach hinten sinken.
Ich war halb über ihr, als ich die Schritte hörte.
»Bea? Bea, liest du schon wieder im Baumhaus?«, fragte ihr Vater.
In meiner Panik griff ich nach meinem Shirt und sah mich hektisch um, wo ich mich verstecken konnte.
»Ich bin hier, Papa.« Bea klang ebenso erschrocken, wie ich mich fühlte. »Ich komm schon.«
»Hast du da oben etwa Kerzen angemacht?«
Mein Herz raste, weil ich mir sicher war, dass Herr Weitz mich umbringen würde, wenn er mich hier oben fand. Ohne T-Shirt. Mit seiner Tochter, die zwar panisch nach ihrem Shirt griff, aber bestimmt nicht angezogen war, ehe ihr Vater die Leiter hochgeklettert war.
Ich rutschte zu der hinteren Öffnung und wollte rausspringen, um über den Gartenzaun zu flüchten, doch ich rutschte aus, fiel mit dem Gesicht zuerst nach unten und erwischte unterwegs einen ziemlich stabilen Baumstamm, bevor ich hart auf dem Boden aufschlug.
»Samuel?«, schrie Bea panisch und sprang mir hinterher. Sie war wesentlich eleganter als ich und landete auf den Füßen neben mir.
»Was ist hier eigentlich los?«, fragte ihr Vater und umrundete den Baum.
Ich sah ihn direkt zweimal, während er von mir zu seiner Tochter schaute. Bea hatte kein Shirt an, ich auch nicht. Ich war so gut wie tot.
»Er blutet. Papa, er blutet.«
Bea berührte mich an der Stirn und der Schmerz sorgte dafür, dass mir einen Moment lang schwummerig wurde.
»Ich würde sagen, das geschieht ihm recht.« Herr Weitz beugte sich mit einem Seufzen vor. »Kannst du aufstehen, Samuel?«
»Ja.« Ich rappelte mich hoch, nur um mich direkt vor Herrn Weitz’ Füßen zu übergeben.
»Wir bringen ihn besser zu Dr. Wendlinger«, sagte Herr Weitz, ehe er sich zu Bea drehte. »Und wir unterhalten uns später.«
»Sie kann nichts dafür«, behauptete ich.
»Oh, davon gehe ich aus. Du bist bestimmt von allein auf die Idee gekommen, nach Einbruch der Dunkelheit in unser Baumhaus zu klettern, und Bea ist zufällig über dich gestolpert.«
Bea starrte den Boden unter ihren Füßen an und Tränen tropften von ihren Wangen. Ich hätte sie gern getröstet, aber mir war irgendwie überhaupt nicht gut. Abgesehen davon hätte ich auch nicht gewusst, welche der beiden Beas meinen Trost brauchte.
»Falco? Was ist hier los?« Das war Beas Mutter, die da angelaufen kam. Entweder mit ihrer Zwillingsschwester oder ich sah wirklich doppelt.
»Ach herrje«, sagte Frau Weitz. »Ich rufe mal besser bei den Ritschels an. Fährst du Samuel zu Dr. Wendlinger? Das blutet ziemlich schlimm.«
»Ich will mitfahren.« Bea trat näher zu mir.
»Du gehst in dein Zimmer, junge Dame. Und da bleibst du, bis du achtzehn bist. Du hast Hausarrest«, verkündete ihr Vater. Dann schob er mich vorwärts. »Komm mit. Das muss auf jeden Fall genäht werden.«
Mit hängenden Schultern trottete ich neben ihm her und fragte mich, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, dass Frau Weitz nicht bei meinen Eltern anrief. Mein Vater würde mich einen Kopf kürzer machen, wenn er hiervon erfuhr.
Ich hatte keine Zeit mehr, darüber nachzudenken, weil mein Magen erneut rebellierte und ich ihn in Frau Weitz’ gepflegtes Rosenbeet entleerte.
KAPITEL1
SAMUEL
Ich drehte den Wasserhahn zu und hörte prompt das leise Tropfen, das mich daran erinnerte, dass ich mir den Abfluss hatte anschauen wollen.
Nachdem ich einen Blick auf die Uhr geworfen hatte, entschied ich, dass es jetzt oder nie war. Ich öffnete den Schrank unter der Spüle, räumte das Sammelsurium halb leerer Flaschen Putzmittel aus und holte nicht weniger als vier Packungen Schwämme hervor, aus denen jeweils nur ein Schwamm genommen worden war.
So wie es aussah, würde ich die Rohrzange brauchen, um das Gewinde festzuziehen und das Tropfen zu stoppen. Ich stand auf, ging in den Keller und begann, durch Papas Werkzeugschrank zu wühlen.
Leider fand ich nicht nur die Rohrzange, sondern auch eine Plastiktüte voller Tabletten. Um ehrlich zu sein, wäre ich froh gewesen, wenn sich mein Vater als Dealer entpuppte, der die Kleinstadt, in der wir lebten, mit Drogen versorgte, doch ich wusste, dass dieser sture Mann schlicht schon wieder aufgehört hatte, seine Medikamente zu nehmen.
Ich wog die Rohrzange in meiner Hand und überlegte, ob ich mit ihm diskutieren oder dem Elend direkt ein Ende bereiten sollte. Mit seinen inzwischen dreiundsechzig sollte ich eigentlich in der Lage sein, meinen Vater zu überwältigen. Der Garten war groß genug für ein Grab und …
Ich seufzte, nahm die Tüte und die Rohrzange und stieg die Treppe wieder nach oben. Nachdem ich das lose Gewinde festgezogen hatte und mich sehr männlich fühlte, räumte ich den Schrank wieder ein und schloss die Tür.
Ich hatte mir gerade erst die Hände gewaschen und mein Handy aus der Hosentasche geholt, als mein Vater in die Küche schlurfte.
»Kaffee?«, fragte er und presste seinen rechten Arm fester gegen den Körper, damit ich das leichte Zittern nicht sah.
Ich goss ihm einen Becher ein, während er auf mein Handydisplay schielte.
»Was machst du da? Pornos gucken?«
»Ja«, gab ich trocken zurück. »Das mache ich grundsätzlich im Stehen in der Küche, wo ich jederzeit überrascht werden kann.«
»Hätte ja sein können.« Er trank einen Schluck und ließ mich nicht aus den blauen Augen, die ich von ihm geerbt hatte.
»Ich suche gerade nach Tricks, wie man störrische Haustiere dazu bekommt, Medikamente zu nehmen. Rein aus Interesse – würdest du Leberwurst von meinem Finger lecken?«
»Was? Hast du Fieber?« Mein Vater sah mich an, als hätte ich endgültig den Verstand verloren.
Wortlos nahm ich den Beutel Tabletten von der Anrichte und warf ihn auf den Küchentisch.
Papa presste die Lippen aufeinander, bevor er mir einen säuerlichen Blick zuwarf. »Mir geht es gut.«
»Zum tausendsten Mal: Dir geht es gut, weil die Effekte der Medikamente anhalten. Sobald sie nachlassen, geht es dir wieder scheiße. Und wir sitzen wieder beim Arzt.« Ich rieb mir mit der Hand durchs Gesicht, obwohl ich viel lieber gegen irgendeine Wand geschlagen hätte.
»Mir geht es gut.«
»Noch. Warum musst du so stur sein? Vier Tabletten am Tag, und du stellst dich an wie ein Kleinkind.«
Sein Gesicht wurde feuerrot – ungünstig, wenn ich bedachte, dass er die Blutdruckmedikamente gerade wahrscheinlich auch nicht nahm. »Pass auf, wie du mit mir redest. Solange du unter meinem Dach –«
»Es ist inzwischen mein Dach«, fuhr ich dazwischen. »Ich habe das Haus abbezahlt, falls du dich noch daran erinnerst. Damit du nicht mehr arbeiten gehen musst.« Ich erwähnte den Schlaganfall nicht, aber wir wussten beide, dass ich mich darauf bezog. Es wäre mir im Traum nicht eingefallen, seine Gesundheit gegen ihn zu verwenden, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass ihm überhaupt etwas daran lag, weiterhin gesund zu bleiben. Er musste doch nur die blöden Tabletten nehmen.
Papas Fingerknöchel traten weiß hervor, weil er die Kaffeetasse viel zu fest umklammerte. »Mir geht es gut. Ende der Diskussionen.«
»Nein.«
»Was?« Er sah mich verblüfft an.
»Papa, ich bin über dreißig und zurückgekommen, weil nichts in Ordnung ist. Ich werde erst zur Stadtratssitzung gehen, wenn du deine Tabletten für heute genommen hast.« Ich griff nach der Medikamentenbox, die ich jeden Sonntag pflichtbewusst befüllte. Arbeit, die ich mir offensichtlich hätte sparen können. Ich ließ die Pillen in meine Hand fallen und hielt sie ihm hin. »Du kannst sie freiwillig nehmen oder ich muss gemein werden.«
Er rümpfte die Nase. »Gemein?«
»Glaub mir einfach, dass du das nicht willst.«
Mein Vater schüttelte den Kopf, einen trotzigen Zug um den Mund, den ich in den vergangenen anderthalb Jahren viel zu oft gesehen hatte. »Mir geht es gut«, wiederholte er jetzt schon wieder, als müsste er es nur oft genug sagen, damit es wahr wurde.
»Du lässt mir keine andere Wahl.« Ich legte die Pillen auf den Tisch und füllte ein Glas mit Wasser. »Was denkst du, was Mama sagen würde, wenn sie dich jetzt sehen könnte?«
Zorn flammte in seinen Augen auf, doch er wurde schnell durch Trauer ersetzt. Meine Mutter war jetzt schon elf Jahre tot, aber keiner von uns beiden konnte über sie reden, ohne dass die Stimmung sofort den Tiefpunkt erreichte. Selbst jetzt schnürte sich mir die Kehle zu.
Mit einem Schnauben warf mein Vater die Tabletten ein und spülte mit dem Wasser hinterher, als wäre es hochprozentiger Schnaps.
»Mund auf«, verlangte ich. Wir hatten den Punkt, an dem ich ihm noch in Bezug auf seine Medikamente vertraute, längst hinter uns gelassen.
Und ich hatte recht. Mit angepisster Miene schlurfte mein Vater zur Spüle, füllte das Wasserglas erneut und trank langsamer. Da er überdeutlich schluckte, nahm ich an, dass er die Pillen tatsächlich jetzt erst hinunterwürgte.
Ich verharrte mit gehobener Augenbraue, bis er mich in seinen Mund blicken ließ. »Besser«, sagte ich.
Mein Vater zeigte mir den Mittelfinger.
»Ich liebe dich auch. Das machen wir jetzt übrigens jeden Morgen.« Ich lächelte ihn an. »Bis später. Ich muss zur Stadtratssitzung.«
»Hm.«
»Wehe, du steckst dir den Finger in den Hals«, warnte ich ihn.
»Jetzt übertreib mal nicht.« Er winkte ab und warf mir dann einen Blick zu. »Sei vorsichtig.«
»Werde ich sein.« Ich verzichtete darauf, ihm zu erklären, dass es vom Haus bloß sieben Minuten zu Fuß zum Rathaus waren, weil er das selbst wusste. Die Botschaft war klar.
Auf der Neuen Allee flackerte die einzige einsame Straßenlaterne, die noch funktionierte – wobei »funktionieren« auch übertrieben war, denn sie ging nicht mehr aus. Wir würden warten müssen, bis das Leuchtmittel aufgab, weil eine Reparatur finanziell nicht infrage kam. Da die Laterne seit März rund um die Uhr flackerte, hofften wir alle, dass es bald so weit war.
Ich machte einen großen Bogen um das Loch im Bürgersteig und ging aus reiner Gewohnheit an der abgeschalteten Ampel über die Straße, obwohl kein einziges Auto fuhr.
Enni Meidner wartete schon vor der Tür des Rathauses und hatte die verbleibende Hand in die Seite gestemmt, während sie ihr Gesicht in die Sonne hielt. »Warm für September, oder?«
Ich trug selbst nur Shorts und nickte, während ich aufschloss. Als ich das Licht anschaltete, gab es ein leises Zischen, ehe die Neonröhre im Flur aufgab.
Enni warf mir ein schwaches Lächeln zu, als ich ihr den Vortritt in den dritten Stock ließ, denn am Aufzug hing nach wie vor das Außer-Betrieb-Schild.
Ich öffnete die Fenster, um zu lüften, und auch, um Licht hereinzulassen, weil wir die Stromrechnung kaum bezahlen konnten. Enni hatte sich gerade auf ihren üblichen Platz gesetzt, als das Kaffeekränzchen kam. Die Damen waren alle – mit Ausnahme von Hella, die erst neunundsiebzig war – über achtzig und verbrachten ihre Zeit ausschließlich miteinander. Obwohl nur Daria und Hella zum Stadtrat gehörten, hielt das ihre Freundinnen Nini, Karla und Rena nicht davon ab, zu jeder Sitzung zu kommen und ungefragt ihre Meinungen mitzuteilen.
»Samuel.« Karla nickte mir knapp zu und reichte mir einen To-go-Becher aus der letzten Bäckerei in Neuhnfelde, die sich hier gerade eben noch halten konnte.
Rayko, Armin und Adrian kamen kurze Zeit später und damit waren wir auch schon vollzählig.
»Morgen«, dröhnte Rayko durch den Raum.
Ich sah mich um. »Wo ist sie?«
Rayko strich sich über den voluminösen Schnurrbart. »Wer?«
»Gloria Estefan. Als ob du sie zu Hause gelassen hättest. Das brauchst du mir gar nicht erst zu erzählen.«
»Doch, doch«, versicherte er mir. »Ich lasse sie nicht mehr frei herumlaufen.«
Sicherheitshalber funkelte ich ihn weiterhin an, aber der Mann war zu abgebrüht, um so leicht einzuknicken. Es würde sich zeigen, ob er seine Ziege wirklich zu Hause gelassen hatte. Ich war mir sicher, dass sie wahrscheinlich draußen auf dem Gang stand und das letzte Telefonbuch, das wir hier noch hatten, anknabberte.
»Gut.« Ich zog meinen Stuhl zurück. »Erster Punkt auf der Programmordnung?«
Adrian räusperte sich und klappte sein Notizbuch auf. »Der Kontostand.«
»Richtig.« Ich presste die Lippen aufeinander und ein gequältes Raunen ging durch den Raum.
Adrian war früher der Filialleiter einer Bankzweigstelle gewesen, bevor die Bank ihren Standort hier geschlossen hatte. Nun verbrachte er seinen Ruhestand als unser Schatzmeister. Er warf mir einen entschuldigenden Blick zu. »Minus 237,86 Euro«, las er vor.
»Wem schulden wir Geld?«
Rayko schnaubte. »Wem schulden wir kein Geld, Bürgermeister?«
Ich sträubte mich innerlich immer noch gegen den Titel. Als ich nach Neuhnfelde zurückgekommen war, um meinem Vater zu helfen, hatte ich mich keineswegs zur Wahl aufstellen lassen. Das Kaffeekränzchen war zusammen mit Adrian und Rayko bei mir aufgeschlagen, bevor sie mir die Schlüssel zum Rathaus in die Hand gedrückt hatten.
Wochenlang hatte ich mich gewehrt, gesträubt und geweigert, doch letztlich hatten sie gewonnen. Ich hatte wenigstens Armin überzeugen können, mit in den Stadtrat zu kommen, damit zumindest zwei Leute unter siebzig hier vertreten waren. Kein leichtes Unterfangen, weil in der ganzen Stadt vielleicht insgesamt noch zwanzig Leute unter sechzig lebten. Und nur zwei von ihnen waren unter dreißig.
Wir wussten alle, dass Neuhnfelde das Ende der Fahnenstange erreicht hatte. Schon seit Monaten hielten wir die Stadt künstlich am Leben und suchten nach einer Möglichkeit, den Tod so schmerzlos wie möglich zu gestalten.
»Oh.« Enni stand auf und ging zum Fenster. »Die Straßenlaterne. Sie ist … ausgegangen.«
Alle erhoben sich. Ich stand direkt neben Rayko und schluckte schwer. Die letzte Straßenlaterne war durchgebrannt. Warum fühlte es sich wie ein Omen an?
KAPITEL2
BEA
Ich schluchzte gequält auf und meine Stimme brach mitten im Refrain von How far I’ll go zu einem Jaulen, während Auli’i Cravalho sich mit ihrer hübschen Stimme wunderte, wie weit sie wohl kommen würde.
Für mich hingegen war klar, dass ich das Ende meiner Reise erreicht hatte. Ich japste wie ein asthmatischer Mops und tastete auf dem Beifahrersitz nach meiner Handtasche. Weil ich durch die Tränen nichts sah, dauerte es eine Weile, bis ich die Taschentücher gefunden hatte. Als ich mir lautstark die Nase putzte, schmetterte bereits die nächste Disney-Prinzessin ihre Lebensweisheiten durch das Auto.
Mein Handy klingelte und »Nils« stand im Display. Ich heulte lauter, drückte dann »Ablehnen« und bemitleidete mich selbst.
Es dauerte bestimmt eine Viertelstunde, bis ich mich so weit beruhigt hatte, dass die Tränen nicht mehr so schlimm waren wie der Schluckauf. Immer wenn ich so heftig weinte, bekam ich Schluckauf. Das war der Preis dafür, dass ich eine hübsche Heulerin war. Melanie Gressmann hatte das in der achten Klasse zu mir gesagt, weil meine Nase nicht feuerrot wurde, wenn ich weinte. Mir liefen bloß Tränen aus den leicht geröteten Augen und ich bekam eben Schluckauf. Melanie hatte versucht, mir weiszumachen, dass ich Schauspielerin werden sollte, weil hübsche Heulerinnen total gefragt waren. Ich hatte ihr schon damals nicht geglaubt und heute glaubte ich es noch weniger.
Müde ließ ich den Kopf sinken und lehnte die Stirn gegen das Lenkrad. Es half alles nichts. Ich würde meine Eltern anrufen müssen, sobald ich vollgetankt hatte. In Köln war so ein Smart ja praktisch, aber hier draußen in der Pampa? Das war schon mein zweiter Tankstopp und ich hatte noch knapp fünfzig Kilometer vor mir.
Da meine Eltern mich sonst in Köln besuchten, war es bestimmt acht oder neun Jahre her, dass ich zum letzten Mal in Neuhnfelde gewesen war. Mein Magen verkrampfte sich, wenn ich daran dachte, die Stadtgrenze zu überqueren.
Ich mochte die Stadt, so war das nicht, aber es fühlte sich irgendwie nach Aufgeben an. Als würde ich mit eingekniffenem Schwanz zurückkehren, weil ich es in der großen weiten Welt nicht geschafft hatte und mich nun bei meinen Eltern verkroch.
Wahrscheinlich übertrieb ich gnadenlos, doch ich war gerade emotional nicht unbedingt stabil.
Obwohl ich allein im Auto saß, sah ich mich einmal anstandshalber um, bevor ich die Nase auf eine Art und Weise hochzog, die mir aufgrund der Lautstärke wahrscheinlich einen Eintrag im Buch der Weltrekorde eingebracht hätte.
Ich drehte die Musik leiser und wählte die Nummer meiner Eltern.
»Hallo, Bea«, flötete meine Mutter. Im Hintergrund hörte ich prompt meinen Vater fragen, ob ich es war, die da anrief, als würde meine Mutter wahllos sämtliche Leute, die sie kannte, mit dem Namen ihrer Tochter ansprechen.
»Natürlich«, zischte meine Mutter ihm zu und flötete dann: »Wie geht es meinem Schatz?«
»Gut.« Die Lüge kam mir noch einigermaßen glatt über die Lippen, was mich selbst erstaunte. »Kann ich vielleicht für ein paar Tage vorbeikommen? Ich habe … Urlaub.«
»Aber selbstverständlich. Da freuen wir uns. Ich kann direkt das Bett im Gästezimmer neu beziehen. Wann werdet ihr denn da sein? Heute Abend? Morgen? Am Wochenende?«
»Ich bin schon kurz vor Varel an der Tankstelle.«
Mama zögerte einen Moment. »Oh, okay. Ich kann noch schnell einen Kuchen backen – ihr seid ja praktisch pünktlich zum Kaffee hier. Oder ich schick Papa zur Bäckerei. Hm. Nils ist doch dabei, oder?«
Es kostete mich immens viel Kraft, das »Nein« ohne Schluchzer über die Lippen zu bringen.
Meine Mutter schaltete sofort. »Na, das macht ja nichts. Dann haben Papa und ich dich ja ganz für uns allein.« Sie lachte auf.
Ich fühlte mich prompt besser. »Okay. Ich fahr gleich weiter. Ich muss noch … tanken.«
»Fahr vorsichtig, Schatz.«
»Mach ich. Tschüss.« Ich legte auf, lehnte meine Stirn wieder ans Lenkrad und heulte erleichtert weiter, während der nächste Track auf meiner Playlist anfing. Es war ja schön, dass Aladdin seiner Angebeteten eine ganz neue Welt zeigen wollte, aber momentan hielt ich alle Männer für Lügner – egal, ob sie fiktiv oder real waren.
Ich brauchte eine weitere ganze Viertelstunde, ehe ich mich in der Lage sah, den Zündschlüssel zu drehen. Wie oft ich mit meinem Fifi, so nannte ich den Smart nur, wenn sonst keiner dabei war, schon über die A29 gegurkt war, konnte ich nicht mehr zählen. Ich hatte ihn bereits als Rostlaube gekauft, als ich gerade meinen Führerschein gemacht hatte, und es war ein Wunder, dass der TÜV mich beim bloßen Anblick des Wagens nicht jedes Mal auslachte. Heute fühlte sich die Fahrt irgendwie anders an. Vor allem als der strahlend blaue Himmel sich urplötzlich zuzog, kurz bevor ich die Stadtgrenze von Neuhnfelde erreichte. Heftiger Platzregen prasselte auf Fifi und übertönte sogar die Musik.
Genauso schnell, wie der Schauer gekommen war, verschwand er auch wieder und als ich den einzigen Kreisverkehr der Stadt verließ und auf die Neue Allee einbog, war es beinahe, als hätte es gar nicht geregnet. Bloß die große Pfütze auf dem Bürgersteig direkt hinter der Bäckerei zeugte noch von dem plötzlichen Schauer, die Sonne brannte bereits wieder vom Himmel.
Irgendwie hatte sich meine Heimatstadt stark verändert. Drei Viertel aller Geschäfte standen leer. Das Hallenbad war geschlossen. Vor dem Rathaus stand eine Ziege.
Ich trat auf die Bremse und ließ Fifi ausrollen. Ja, das war ohne Zweifel eine Ziege.
Obwohl ich es mit achtzehn kaum hatte erwarten können, aus Neuhnfelde wegzukommen, war die Stadt mir nicht ganz so trostlos vorgekommen. Ich ließ meinen Blick schweifen. Was war hier passiert? Und wo waren die ganzen Leute?
Ich stand praktisch mitten auf der Fahrbahn der größten Straße der Stadt und hier war … niemand.
Fifi röchelte leise, als ich das Gaspedal betätigte und im Schneckentempo weiterfuhr. Zu meiner Schulzeit hatte Neuhnfelde mehr als zwanzigtausend Einwohner gehabt, doch ich fühlte mich wie in einer Geisterstadt.
In der Bäckerei stand Armin hinter dem Tresen, der mich natürlich sah und winkte. Kein Wunder, er schien nämlich nichts zu tun zu haben.
Drei Häuser weiter, im Friseursalon, sah es nicht anders aus. Cornelia Brug, die schon meiner Oma immer die Haare geschnitten hatte, damals noch als Auszubildende, ehe sie den Laden übernommen hatte, saß in einem der Stühle und blätterte durch eine Zeitschrift.
Ich bog in die Straße, in der meine Eltern wohnten, und staunte nicht schlecht, weil nur ihr Vorgarten gepflegt war. Die anderen Häuser wirkten … verlassen.
Die Haustür ging schon auf, da hatte ich es noch nicht in die Einfahrt geschafft.
Mama strahlte mich an und Papa rückte seine Hose zurecht, während er mir zunickte. Der Anblick hätte die Schleusen beinahe wieder geöffnet, aber ich hatte mich im Griff und blinzelte die aufsteigenden Tränen weg.
Ich stieg aus, ging kurz zu meinen Eltern, um mir die Umarmungen abzuholen, die ich zur Begrüßung immer bekam, und nahm dann meine Reisetasche aus Fifis schmalem Kofferraum.
Ich hatte die Klappe gerade zugeworfen, da hörte ich eine Art Gurren hinter mir. Irritiert drehte ich mich um, doch da war niemand. Erst als ich nach unten sah, bemerkte ich den Hahn. »Huch, wo kommst du denn her?«
Er gurrte lauter, kam näher und betrachtete mich, als wäre ich eine schöne große Portion Futter für Hähne.
Gurrten Hähne überhaupt? Sollte er nicht eher krähen?
Weil er geradewegs auf meine Füße zusteuerte, machte ich erschrocken ein paar Schritte nach hinten.
»Falco«, sagte meine Mutter zu meinem Vater, »Falco, bring den Besen, der Kapitän ist hier.«