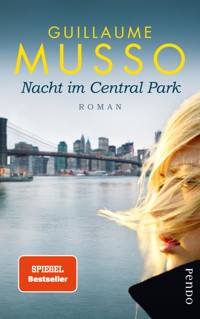8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bei einem Flug von Los Angeles nach London treffen die 15-jährige Evie, die frisch getrennte Nicole und die exzentrische Milliardärstochter Alyson aufeinander. Sie kennen sich nicht und erzählen sich doch ihre Lebensgeschichten, als wären sie alte Bekannte. Im Laufe der Gespräche tun sich Abgründe auf, die allen dreien die Tragik des Lebens vorführen. Sie sind auf dramatische Weise miteinander verbunden und müssen erkennen, dass das Schicksal sie auf die Probe stellen will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Französischen von Claudia Puls
ISBN 978-3-492-97349-6 Juni 2016 © XO Éditions, Paris 2007 Titel der französischen Originalausgabe: »Parce que je t’aime« © der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2016 © für die deutsche Übersetzung von Claudia Puls: Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2009 Die Übersetzung erschien erstmals 2009 bei Gustav Kiepenheuer; Gustav Kiepenheuer ist eine Marke der Aufbau GmbH & Co. KG. Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München Covermotiv: Cultura/plainpicture (Frau); LPETTET/getty images (Hintergrund) Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
1
Die Nacht, in der alles begann
Dezember 2006Am Weihnachtsabend im Herzen von Manhattan
Schon seit dem Morgen hatte es unaufhörlich geschneit. Die verschwenderische Fülle von Lichtern an diesem Weihnachtsabend trog – das Leben in der »Stadt, die niemals schläft« schien allmählich in einer Art Zeitlupe zu gefrieren.
Für einen Heiligabend war erstaunlich wenig Verkehr, nur wenige wagten sich auf die schneeverwehten Straßen hinaus, wo jedes Vorwärtswollen zum kühnen Unterfangen geriet.
Nur an der Ecke Madison Avenue/36.Straße fuhren pausenlos Limousinen vor, aus denen Menschen auf den Vorplatz eines wunderschönen Renaissancebaus entlassen wurden. Es war der Sitz der Morgan Library, einer der glanzvollsten kulturellen Einrichtungen New Yorks, die an diesem Abend ihr hundertjähriges Bestehen feierte.
Auf der großen Freitreppe wirbelten Smokings und prächtige Abendkleider durcheinander, überall schimmerten Pelze und glitzerte Schmuck. Die Menge steuerte auf einen Pavillon aus Glas und Stahl zu, einen Anbau, der das Gebäude auf harmonische Art im 21.Jahrhundert verankerte. Im obersten Stockwerk führte ein langer Korridor zu einem weitläufigen Saal, wo in Vitrinen einige Schätze der Bibliothek ausgestellt waren: eine Gutenberg-Bibel, kolorierte Manuskripte aus dem Mittelalter, Zeichnungen von Rembrandt, Leonardo da Vinci und van Gogh, Briefe von Voltaire und Einstein, und nicht zuletzt der Fetzen einer Papiertischdecke, auf den Bob Dylan einst den Text von Blowin’ in the Wind gekritzelt hatte.
Nachdem auch die letzten verspäteten Besucher ihre Plätze eingenommen hatten, erfüllte eine angespannte Stille den Raum. Ein Teil des Lesesaals war eigens für diesen Abend umgebaut worden – damit ein paar Privilegierte in den Genuss der Brahms- und Mozart-Interpretationen der Violinistin Nicole Hathaway kamen.
Unter großem Applaus betrat die Musikerin die Bühne: eine junge Frau um die dreißig, sie bestach durch schlichte Eleganz. Mit ihrem strengen Haarknoten à la Grace Kelly sah sie aus wie die perfekte Hitchcock-Heldin. Auf internationalem Parkett jubelte man ihr zu, sie war mit den größten Orchestern weltweit aufgetreten und wurde, seit sie im zarten Alter von sechzehn Jahren ihre erste Platte aufgenommen hatte, mit Preisen und Auszeichnungen überhäuft. Ein Bilderbuchleben – bis plötzlich, fünf Jahre zuvor, ein furchtbares Drama über ihr Dasein hereingebrochen war. Ein Drama, auf das sich die Medien gierig gestürzt hatten und das ihr über den Kreis der Musikliebhaber hinaus zu trauriger Berühmtheit verholfen hatte.
Mit unaufdringlicher Freundlichkeit begrüßte Nicole das Publikum, bevor sie ihr Instrument ansetzte. Ihre klassische Schönheit fügte sich bestens in das elegante Ambiente des aristokratischen Anwesens, als wäre ihr Platz schon immer hier zwischen den antiken Stichen und Renaissance-Manuskripten gewesen. Der Einsatz war lupenrein, er ging unter die Haut. Vom ersten Takt an fanden Bogen und Saiten zu einem meisterhaften Dialog, der bis zum Ende der Vorstellung anhielt.
Während man sich hier drinnen genussvoll dem Wohlklang der feinen Kunst hingab, fielen draußen immer noch dicke Schneeflocken durch die kalte Nacht.
Unweit von diesem erlesenen Ort, nahe der U-Bahn-Station Grand Central, hob sich lautlos ein Kanaldeckel. Ein zerzaustes Etwas kam zum Vorschein – ein Mann, dessen Gesicht durch Schläge entstellt war. Scheu und mit leerem Blick schaute er sich um, bevor er seinen schwarzen Labrador in die Dunkelheit entließ. Schwerfällig hievte er sich auf den verschneiten Bürgersteig. Als er schließlich, wacklig zwar, aber immerhin auf beiden Beinen stand, lief er auf die Straße und taumelte im Zickzackkurs über die Fahrbahn. Um ein Haar wäre er überfahren worden, ein ohrenbetäubendes Hupkonzert von aufgebrachten Autofahrern scheuchte ihn zurück auf das Trottoir.
Er war abgemagert und schwach, hatte kein Dach über dem Kopf und besaß, was er am Leib trug: einen schmutzstarrenden, abgewetzten Mantel. Sobald er sich näherte, beschleunigten die Passanten ihren Schritt und wichen instinktiv aus. Er verstand das, er wusste, dass er den Leuten Angst einjagte, dass er nach Urin, Schweiß und Dreck stank.
Er war erst fünfunddreißig, sah jedoch aus wie fünfzig. Früher hatte er einen Job, eine Frau, ein Kind und ein Haus gehabt. Aber das war lange her. Heute war er nur noch ein herumirrender Schatten seiner selbst, ein in Lumpen gehülltes Gespenst, das unzusammenhängendes Zeug vor sich hin murmelte.
Nur mühsam konnte er sich aufrecht halten, schlurfend schleppte er sich durch die Straßen.
Welchen Tag wir wohl heute haben? In welchem Monat? Wie viel Uhr mag es sein?
In seinem Kopf schwirrte alles durcheinander. Vor seinen Augen verschwammen die Lichter der Stadt. Eisige Schneeflocken schnitten ihm unbarmherzig ins Gesicht. Seine Füße waren eiskalt, sein Magen schmerzte vor Hunger, es fehlte nicht viel, und er wäre am Ende.
Bald zwei Jahre war es her, dass er sich aus der Gesellschaft der Menschen verabschiedet hatte, um in die Eingeweide der Großstadt abzutauchen. Wie so viele andere Obdachlose hauste er in U-Bahn-Schächten, streifte durch die unterirdischen Gänge der Bahnhöfe und suchte Unterschlupf in den Tiefen der städtischen Kanalisation. Die unbescholtenen Bürger und arglose Touristen brauchten sich indes nicht zu fürchten: Die von der Verwaltung ausgerufene Null-Toleranz-Politik trug Früchte, an der Oberfläche blinkte und blitzte Manhattan. Doch unter den strahlenden Wolkenkratzern bebte die Erde vom Treiben eines Paralleluniversums, in dem menschliche Wracks ein unüberschaubares Netz aus Tunneln und Löchern überfluteten. Wie die Maulwürfe suchten Tausende von der Politik Ausgegrenzte zwischen Ratten und Exkrementen Zuflucht in den dunkelsten Winkeln dieser Unterwelt.
Der Mann wühlte in seiner Tasche und förderte eine Flasche billigen Fusels zutage. Natürlich trank er, wer würde das in seiner Situation nicht tun?
Einen Schluck, und noch einen.
Gegen die Kälte, gegen die Angst und all den Dreck.
Um zu vergessen, was sein Leben einmal ausgemacht hatte.
Nicole Hathaway setzte zum letzen Bogenstrich an. Zwei Takte, und dann – Stille. Die berühmte Stille nach jedem Mozartstück, eine Stille, die von Mozart mitkomponiert zu sein schien, bevor sie von tosendem Applaus verjagt wurde.
Die Violinistin verbeugte sich, nahm einen Blumenstrauß und nicht enden wollende Gratulationen entgegen. Trotz der euphorischen Beifallsbekundungen wusste Nicole, dass ihre Darbietung alles andere als grandios gewesen war. Sie hatte die Sonaten mit technischer Perfektion bewältigt, ihr Spiel war sauber und dynamisch gewesen.
Doch ohne Seele und Herzblut.
Mechanisch schüttelte sie die Hände, die sich ihr entgegenstreckten, nippte abwesend an ihrem Champagnerkelch und versuchte, eine günstige Gelegenheit abzupassen, um bloß zu verschwinden.
»Möchtest du los, Chérie?«
Die vertraute Stimme hinter ihr gehörte Eriq. Langsam drehte sie sich um. Mit einem Glas Martini stand er vor ihr, der Mann, mit dem sie seit einigen Monaten mehr oder weniger ihr Leben teilte. Ein äußerst zuvorkommender Business-Anwalt, der zur Stelle gewesen war, als sie ihn gebraucht hatte.
»Ja, mir platzt gleich der Schädel. Bringst du mich nach Hause?«
Anstelle einer Antwort stürzte er zur Garderobe und stand kurz darauf mit einem grauen Flanellmantel wieder vor ihr, in den sie rasch hineinschlüpfte. Eilig verabschiedeten sie sich von den Gastgebern und verließen den feierlichen Empfang, noch bevor er richtig angefangen hatte.
»Ich rufe dir ein Taxi«, schlug Eriq vor, während sie die imposante Marmortreppe hinunterstiegen. »Mein Auto steht an der Kanzlei, ich komme nach.«
»Lass nur, ich begleite dich die paar Schritte dorthin.«
»Bei dem Sauwetter? Das ist doch Quatsch.«
»Ich glaube, ein bisschen Bewegung und die frische Luft werden mir guttun.«
»Das ist viel zu gefährlich!«
»Seit wann ist es gefährlich, dreihundert Meter zu Fuß zu gehen? Außerdem bist du doch bei mir.«
Eriq seufzte. »Wie du meinst.«
Schweigend durchquerten sie das Foyer. Als sie auf die Fifth Avenue hinaustraten, schnitt ihnen ein eisiger Wind ins Gesicht. Sie beschleunigten ihren Schritt. Immer noch schien alles wie ausgestorben, dicke Schneeflocken senkten sich auf die nächtliche Stadt und erstickten allmählich jedes Geräusch.
Keine hundert Meter trennten sie mehr von Eriqs Wagen, es stand gleich hinter dem Bryant Park, einer wohltuenden grünen Insel inmitten des Häusermeers, die bei schönem Wetter zum Sonnenbaden und Picknicken oder zu einer Partie Schach am Brunnen einlud. An diesem Abend jedoch lag der Park verlassen und finster da …
»Deine Kohle!« Eine Klinge blitzte im Dunkeln auf.
Nicole stieß einen spitzen Schrei aus.
»Deine Kohle, sagte ich!«, herrschte der massige Kerl sie an. Er erschien ihr merkwürdig alterslos und äußerst robust. Sein rasierter Schädel ragte aus einer unförmigen Windjacke hervor, die ihm bis an die Knie reichte. In seinem Gesicht, das der Länge nach von einer angeschwollenen Narbe gespalten war, klafften seine Augen wie zwei kleine, dunkle Krater, aus denen ein flackernder Blick sprühte.
»Na los, schneller, mach schon!«
»Okay, okay.« Nervös zückte Eriq sein Portemonnaie und überließ dem Fremden in vorauseilendem Gehorsam auch noch seine Breitling und sein Handy.
Hastig steckte der Mann die Beute ein und machte einen Schritt auf Nicole zu. Mit ein paar groben Handgriffen brachte er ihre Tasche und den Violinkoffer an sich.
Die Musikerin versuchte ihre Furcht zu verbergen, doch es gelang ihr nicht, dem irren Blick des Kerls standzuhalten. Sie schloss die Augen. Während der Räuber ihr die Perlenkette vom Hals riss, sagte sie sich in Gedanken das Alphabet rückwärts auf. So wie sie es als Kind immer getan hatte, wenn Angst ihr die Kehle zuschnürte.
Z, Y, X, W, V, U …
Es war das einzige Mittel, das ihr half, sich auf etwas anderes zu konzentrieren, bis der Augenblick nur noch böse Erinnerung war.
T, S, R, Q, P, O …
Er würde verschwinden, er hatte bekommen, was er wollte: Geld, Schmuck, ein Handy …
N, M, L, K, J, I, H …
Er würde verschwinden. Eriq und sie zu töten, brächte ihm nichts.
G, F, E, D, C, B, A …
Doch als sie die Augen wieder aufschlug, war der Mann immer noch da. Langsam hob er den Arm und wollte mit dem Messer auf sie losgehen.
Eriq stand wie gelähmt neben ihr und machte keinerlei Anstalten, sie zu verteidigen.
Warum war sie nicht einmal überrascht über seine Feigheit?
Ihr blieb keine Zeit, dem Angreifer auszuweichen. Wie eine ohnmächtige Zuschauerin sah sie die Hand mit der Klinge auf sich zukommen, die Klinge, die ihr in wenigen Sekunden die Kehle durchtrennen würde.
Sollte das alles gewesen sein? Ihr Leben hatte vielversprechend begonnen, auf den glanzvollen Aufstieg allerdings war schnell der Abstieg in die Hölle gefolgt. Und nun dieses schäbige Ende, ohne die geringste Vorwarnung. Als wäre sie die Heldin einer nur halbfertigen Geschichte.
Seltsam. Hieß es nicht, dass im Moment des Todes die wichtigen Augenblicke des Lebens noch einmal im Zeitraffer vor dem inneren Auge vorbeizogen? Nicole sah eine einzige Szene vor sich: Ein weiter Strand liegt vor ihr. Nur zwei Menschen befinden sich außer ihr an diesem einsamen Ort und winken ihr fröhlich zu. Sie erkennt ihre Gesichter. Das eine gehört dem einzigen Mann, den sie je geliebt hat und den sie nicht halten konnte. Das andere ihrer Tochter, die sie nicht zu beschützen wusste.
Ich bin tot.
Nein.
Plötzlich tauchte wie aus dem Nichts jemand auf.
Ein Obdachloser.
Nicole fürchtete eine weitere Attacke, ehe sie begriff, dass dieser Jemand ihr zu Hilfe eilte. Im allerletzten Augenblick trat er zwischen sie und den Straßenräuber, das Messer traf ihn und nicht sie, es traf ihn an der Schulter. Doch trotz der Verletzung rappelte sich der fremde Samariter erstaunlich schnell wieder auf die Beine und stürzte sich verbissen auf ihren Angreifer. Es gelang ihm, den Kerl zu entwaffnen und ihn zu zwingen, seine Beute fallen zu lassen. Es folgte eine heftige Schlägerei, nackte Fäuste wirbelten durch die Luft. Der Retter, obschon er schmächtiger als sein Gegner war, gewann die Oberhand, und mit Unterstützung eines schwarzen Labradors schlug er den Übeltäter in die Flucht.
Der Triumph hatte indes seinen Preis. Kraftlos brach Nicoles Schutzengel auf dem Gehweg zusammen und vergrub sein Gesicht im Schnee.
Sie hastete zu dem Mann hin, wobei sie einen ihrer Lackpumps verlor. Erst als sie vor ihm kniete, bemerkte sie die rote Blutspur im Schnee. Warum war dieser Fremde so ein Risiko eingegangen, um ihr das Leben zu retten?
»Wir werden ihm zwanzig Dollar in die Hand drücken, als Dank für seinen Einsatz.« Geschäftig sammelte Eriq sein Portemonnaie und das Handy wieder ein – die Gefahr war vorüber, der Anwalt hatte zu seiner gewohnten Arroganz zurückgefunden.
Nicole blickte ihn voller Verachtung an. »Siehst du nicht, dass er verletzt ist?«
»Ich rufe die Polizei.«
»Du solltest nicht die Polizei rufen, sondern lieber einen Krankenwagen organisieren!« Mit einiger Mühe drehte sie ihren Retter auf den Rücken. Seine Schulterverletzung blutete und blutete. Sie presste ihre Hand auf die Wunde und betrachtete das bärtige Gesicht des Mannes.
Sie erkannte ihn nicht gleich. Erst als sie seinem fiebrigen, ungläubigen Blick begegnete, fuhr sie erschrocken zusammen.
Etwas in ihr zersprang. Ein heißer Strom erfüllte ihr ganzes Wesen. Sie wusste nicht, ob es Schmerz war, oder Erleichterung. Eine Brandwunde, oder eine Hoffnung, die plötzlich in dieser Nacht aufleuchtete.
Sie beugte sich über ihn, näherte ihr Gesicht dem seinen, wie um ihn gegen das Schneegestöber abzuschirmen.
»Was machst du da?«, erkundigte sich Eriq verwirrt, während er eine Nummer in sein Handy eingab.
»Leg auf und hol deinen Wagen«, sagte Nicole bestimmt und richtete sich auf.
»Darf man fragen, was du vorhast?«
»Ich … ich kenne diesen Mann.«
»Was soll das heißen, du kennst diesen Mann?«
»Hilf mir lieber, wir bringen ihn zu mir«, gab sie zurück, ohne seine Frage zu beantworten.
Eriq schüttelte den Kopf. »Würdest du mir bitte erklären, wer dieser Typ ist?«
Nicole richtete den Blick in die Ferne. Nach einer Weile sagte sie leise: »Es ist Mark, mein Mann.«
2
Die Verschollene
Brooklyn, auf der anderen Seite des East River, in einem idyllischen viktorianischen Haus, das mit Türmchen und Wasserspeiern verziert ist
Das Feuer knisterte behaglich im Kamin. Mark Hathaway lag immer noch bewusstlos auf der Wohnzimmercouch, seine Beine waren in eine warme Decke eingewickelt. Dr.Susan Kingston stand gebeugt über der Schulter des Verletzten und vernähte die Wunde mit geübter Hand.
»Die Verletzung ist nur oberflächlich«, erklärte sie Nicole, als sie fertig war und sich die sterilen Latexhandschuhe abstreifte. »Ich mache mir mehr Sorgen wegen seines Allgemeinzustandes: Er hat eine schlimme Bronchitis, und sein Körper ist übersät mit Blutergüssen und Frostbeulen.«
Susan war gerade dabei gewesen, ihrer Familie den traditionellen Christmas Pudding zu servieren, als das Telefon klingelte. Es war Nicole Hathaway, ihre Nachbarin, die völlig aufgelöst schien und sie anflehte, ihren verletzten Mann zu verarzten. Susan hatte nicht eine Sekunde gezögert.
Ihr Mann und sie kannten Mark und Nicole sehr gut. Bevor die Katastrophe – sie lag inzwischen fünf Jahre zurück – über ihre Nachbarn hereingebrochen war, hatten sich die beiden Paare angefreundet und gingen oft zusammen aus. Gemeinsam testeten sie der Reihe nach alle italienischen Restaurants von Park Slope, stöberten in den Läden der Antiquitätenhändler von Brooklyn Height und spazierten am Wochenende über die riesigen Grünflächen des Prospect Park.
Heute schien diese Zeit einer weit zurückliegenden Vergangenheit anzugehören, sie kam Susan beinahe unwirklich vor. Sie sah Mark an, ein Gefühl von Trostlosigkeit überkam sie.
»Wusstest du, dass er auf der Straße lebt?«
Nicole schüttelte stumm den Kopf, sie war nicht in der Lage, auch nur ein Wort hervorzubringen.
Es war zwei Jahre her, dass Mark ihr eines Morgens mitgeteilt hatte, er würde jetzt gehen. Er könne es nicht ertragen, »so« zu leben, er habe einfach keine Kraft mehr. Sie hatte alles versucht, um ihn aufzuhalten, doch manchmal ist auch alles nicht genug. Seither hatte sie nie wieder etwas von ihm gehört.
»Ich habe ihm ein Schmerzmittel und Antibiotika gegeben«, sagte Susan und packte ihre Sachen zusammen.
Nicole begleitete sie zur Haustür.
»Ich komme morgen wieder vorbei«, versprach Susan. »Es wäre gut …« Sie hielt inne und musste schlucken. »Nicole, es wäre gut, wenn du ihn in diesem Zustand nicht gehen ließest. Er würde es nicht überleben.«
»Und jetzt?«
»Und jetzt, was?«
»Was machen wir jetzt mit ihm? Mit deinem Mann?« Ein Glas Whisky in der Hand, lief Eriq unruhig in der Küche auf und ab.
Nicole sah ihm mit einer Mischung aus Überdruss und Widerwillen dabei zu. Was zum Teufel hatte sie mit so einem Typen zu schaffen, und das seit fast einem Jahr? Wie hatte sie ihn nur in ihr Leben eindringen lassen können? Was hatte sie bei ihm gesucht?
»Geh einfach. Bitte«, sagte sie leise.
Eriq schüttelte den Kopf. »Nein. Es ist ausgeschlossen, dass ich dich in so einem Augenblick alleinlasse.«
»Als der Kerl mir das Messer an die Kehle gedrückt hat, war das doch auch kein Problem für dich.«
Die Miene des Anwalts erstarrte, und es dauerte einen Moment, bis er sich wieder gefasst hatte und zu einer Rechtfertigung ansetzte: »Aber ich hatte doch keine Zeit, um …«, stammelte er und ließ den Satz unvollendet im Raum stehen.
»Geh«, wiederholte Nicole müde.
»Wenn es das ist, was du willst, bitte schön … Aber ich werde dich morgen anrufen«, fügte er hinzu, bevor er sich davonstahl.
Erleichtert, Eriq endlich losgeworden zu sein, kehrte Nicole ins Wohnzimmer zurück, knipste alle Lampen aus und ließ sich neben dem Sofa nieder, auf dem Mark immer noch reglos lag. Sie wollte in seiner Nähe sein.
Der Raum war nur mehr erleuchtet von dem spärlichen Licht der rotorangefarbenen Glut, mit einem Mal erfüllte eine friedvolle Atmosphäre das Haus.
Erschöpft und verwirrt legte Nicole ihre Hand auf die ihres Mannes und schloss die Augen. Wie glücklich sie in diesem Haus gewesen waren! Wie sehr hatten sie sich gefreut, als sie es damals entdeckt hatten. Es war eines der berühmten Brownstone-Häuser, erbaut am Ende des 19.Jahrhunderts, mit einer dunklen Steinfassade und einem hübschen Garten. Vor zehn Jahren hatten sie es erworben, kurz vor der Geburt ihrer Tochter, die sie abseits des wilden Treibens von Manhattan großziehen wollten.
Auf den Bücherregalen erinnerten ein paar eingerahmte Fotos an die glückliche Zeit von damals: ein Mann und eine Frau, Hand in Hand, die sich mit innigen Blicken und Gesten verständigen; romantische Ferien auf Hawaii und eine abenteuerliche Motorradtour durch den Grand Canyon. Daneben eine Ultraschallaufnahme, dann das Bild eines pausbäckigen Babys bei seinem ersten Weihnachtsfest. Und schließlich ein paar Fotos, auf denen aus dem Baby ein kleines Mädchen geworden ist, das seine Milchzähne verloren hat. Stolz posiert es vor den Giraffen im Zoo der Bronx, rückt sein Mützchen vor einer Schneelandschaft in Montana zurecht und präsentiert seine beiden Clownfische Ernesto und Cappuccino.
Fotos, die ein ungetrübtes Glück atmen, das für immer verloren schien.
Mark hustete im Schlaf, Nicole erschauerte. Der Mann, der sich dort auf dem Sofa ausruhte, hatte nichts mehr mit dem Mann zu tun, den sie geheiratet hatte. Lediglich seine Diplome und Auszeichnungen, die wie Trophäen die Wohnzimmerwände schmückten, erinnerten daran, dass Mark ein renommierter Psychologe gewesen war. Schon in jungen Jahren hatte er sich einen Namen als Spezialist für Traumatherapien gemacht und war häufig von der FAA und dem FBI bei Flugzeugabstürzen und Geiselnahmen zu Rate gezogen worden. Nach dem 11.September hatte man ihn in das Team der Psychologen berufen, das sich um die Familien der Opfer und die Angestellten im World Trade Center kümmerte, die das Inferno überlebt hatten. Tief waren die Spuren, die die Katastrophe bei den Hinterbliebenen hinterlassen hatte. Ein Teil ihrer selbst würde für immer gefangen bleiben in den Schreien, den Flammen, all dem Blut. Sie waren zwar nicht tot, fühlten sich jedoch schmutzig, aufgezehrt von Schuldgefühlen, zerfressen von einer stummen Angst, die ihnen immer wieder unbarmherzig eine Frage aufdrängte, auf die sie niemals eine Antwort finden würden: Warum habe ich überlebt, und nicht die anderen? Ich, und nicht mein Kind, mein Partner, meine Eltern …
Die Erfahrungen, die Mark als Psychologe in der Praxis sammelte, schrieb er regelmäßig für die großen Boulevardblätter nieder – ein Forum, das ihm erlaubte, neue Therapieformen ins Gespräch zu bringen. Auf dem Gebiet der Hypnose und Aufstellung etwa galten er und Connor McCoy, sein Praxispartner und Freund aus Kindertagen, als absolute Vorreiter. Im Laufe der Zeit war Mark zu einem der populärsten Psychologen des Landes aufgestiegen, ständig konnte man ihn auf irgendwelchen Podien im Fernsehen bewundern, und seine Prominenz ließ Nicole und ihn zunehmend zu Stars der Medienszene werden. So hatte Vanity Fair ihnen einen vierseitigen Artikel mit einer Glamour-Fotostrecke gewidmet, als es um »Die angesagtesten Paare New Yorks« ging.
Und dann war das Hochglanzmärchen plötzlich in tausend Fetzen zerrissen. Eines Nachmittags war ihre fünfjährige Tochter Layla in der riesigen Shopping Mall von Orange County, im Süden von Los Angeles, verschwunden. Zum letzten Mal hatte man sie gesehen, als sie die Spielsachen im Schaufenster des Disney Store bestaunte. Ihr Kindermädchen, ein australisches Au-pair, hatte sie ein paar Minuten unbeaufsichtigt gelassen, um ganz schnell eine heruntergesetzte Jeans im benachbarten Diesel-Shop anzuprobieren.
Wie viel Zeit war vergangen, bis sie gemerkt hatte, dass die Kleine nicht mehr da war?
»Höchstens fünf Minuten«, hatte das Kindermädchen gegenüber der Polizei beteuert. Eine Ewigkeit also – was kann nicht alles in fünf Minuten geschehen!
Es hatte in Strömen geregnet an jenem 23.März. Obwohl die Kleine am helllichten Tag und an einem belebten Ort verschwunden war, hatten die Polizisten Schwierigkeiten, verlässliche Zeugenaussagen zusammenzutragen. Auch die Auswertung der Überwachungsvideos hatte nichts ergeben, nicht mehr jedenfalls als die Befragung des Kindermädchens, dem zwar die Verletzung seiner Aufsichtspflicht vorgeworfen werden konnte, nicht jedoch eine Kindesentführung.
So verging Tag um Tag …
Mehrere Wochen lang durchkämmten Hunderte Polizisten mit Spürhunden und in Helikoptern die gesamte Umgebung. Doch trotz dieses enormen Aufgebots und der Anstrengungen des FBI fand sich kein Hinweis auf den Verbleib des Kindes.
Monat um Monat …
Das Fehlen jeglicher Indizien brachte die Beamten völlig aus dem Konzept. Es gab keine Lösegeldforderung, keine Spur, einfach nichts.
Jahr um Jahr.
Seit fünf Jahren hing nun schon, in einer Reihe mit den vielen anderen verschollenen Kindern, ein Foto von Layla in allen Bahnhöfen, Flughäfen und Postämtern aus.
Doch die Kleine blieb unauffindbar.
Als hätte sie sich in Luft aufgelöst.
Für Mark war das Leben an jenem 23.März 2002 stehengeblieben.
Das Verschwinden seiner Tochter hatte ihn in einen Zustand absoluten Elends gestürzt. Die von Schmerz und Schuldgefühlen ausgelöste Erschütterung war derart verheerend, dass er sich von allem abkapselte: seinem Beruf, seiner Frau, seinem besten Freund.
In den ersten Monaten hatte er die renommiertesten Privatdetektive beschäftigt, damit sie die polizeiliche Untersuchung bis ins kleinste Detail nachrecherchierten.
Ohne Resultat.
Dann hatte er sich selbst in ergebnislose Nachforschungen gestürzt – eine zum Scheitern verurteilte Suche, die drei Jahre in Anspruch nahm. Danach war Mark seinerseits verschwunden, ohne je wieder etwas von sich hören zu lassen, weder bei seiner Frau noch bei Connor.
Nicole war nicht in der gleichen Weise abgerutscht. Am Anfang hatte sich ihre hoffnungslose Verzweiflung durch ein besonderes Empfinden von Schuld noch verdoppelt: Sie war es gewesen, die darauf bestanden hatte, dass Layla sie nach Los Angeles begleitete, wo sie eine Reihe von Konzerten geben sollte. Und sie hatte das Kindermädchen engagiert, das schließlich das Drama herbeigeführt hatte. Als sie sich dem Schlimmsten stellen musste, war ihr als einzige Abwehr die Hyperaktivität geblieben, mit der sie seither Auftritte und Plattenaufnahmen aneinanderreihte und sich sogar dafür hergab, ihre persönliche Tragödie in den Gazetten des Landes auszubreiten oder im Fernsehen, als williges Opfer eines hässlichen Voyeurismus.
An manchen Tagen jedoch wurde der Schmerz unerträglich. Wenn sie dann ihrer morbiden Gedanken gar nicht mehr Herr wurde, mietete sich Nicole in irgendwelchen Hotelzimmern ein und rollte sich unter der Bettdecke zusammen, als sei sie in eine Art Winterstarre gefallen.
Jeder überlebt, wie er eben kann.
Plötzlich knackte ein Holzscheit im Kamin. Mark riss die Augen auf und fuhr hoch. Einige Sekunden lang schien er zu rätseln, wo er sich befand, was geschehen war.
Als er Nicole erblickte, kam seine Erinnerung langsam zurück.
»Bist du verletzt?«, fragte er seine Frau.
»Nein, und das habe ich dir zu verdanken.«
Für einen kurzen Moment sah es so aus, als wollte er wieder in seine Starre verfallen, doch dann stand er abrupt auf.
»Bleib liegen, bitte, du musst dich ausruhen!«
Als hätte er sie nicht gehört, machte er ein paar unsichere Schritte auf das große Glasfenster zu. Dahinter glitzerte die Straße, weiß und still.
»Wo sind meine Sachen?«
»Ich habe sie weggetan, Mark, sie waren völlig verdreckt.«
»Und mein Hund?«
»Den habe ich mit dir hierher gebracht, aber … er hat sich aus dem Staub gemacht.«
»Ich gehe auch.« Er schwankte zur Tür.
Nicole stellte sich ihm in den Weg. »Hör zu, es ist mitten in der Nacht, du bist verletzt und völlig erschöpft … Außerdem haben wir uns seit zwei Jahren nicht gesehen. Wir müssen reden.«
Sie streckte den Arm nach ihm aus, doch er stieß sie von sich. Sie hielt sich an ihm fest, er schlug rudernd um sich und traf dabei das Regal. Ein Bilderrahmen fiel geräuschvoll zu Boden, das Glas zersplitterte.
Mark sammelte die Scherben auf und stellte den Rahmen zurück auf das Bord. Sein Blick streifte das Foto seiner Tochter. Sie lachte ihm aus grünen Augen glücklich und voller Lebensfreude entgegen. Er spürte, wie es ihm das Herz zerriss. Schluchzend ließ er sich an der Wand zu Boden gleiten. Nicole kauerte sich neben ihn und verbarg ihr Gesicht an seiner Brust. Lange verharrten sie so ineinander verschlungen, dieselbe Verzweiflung teilend, weiche Haut gegen raue Haut, und allmählich mischte sich der feine Guerlain-Duft mit dem Gestank der Gosse.
Nach einer Weile nahm Nicole ihren Mann an die Hand und führte ihn ins Badezimmer, zur Dusche. Wortlos drehte sie das Wasser auf und ging. Völlig berauscht von dem schweren Duft des Shampoos, überließ sich Mark eine halbe Stunde lang dem warmen, wohltuenden Strahl. Tropfnass und in ein großes, weiches Handtuch gehüllt, trat er dann in den Flur hinaus und hinterließ überall auf dem gebohnerten Parkett kleine Pfützen. Er öffnete eine Schranktür und betrachtete prüfend, was einmal seine Garderobe gewesen war – unberührt hing dort alles genau so, wie er es hinterlassen hatte. Achtlos kramte er zwischen lauter feinem Tuch von Armani, Boss und Zegna – Kleidung, die aus einem Leben stammte, das nicht mehr seins war –, zog schließlich eine Jeans, ein langärmliges Shirt und einen warmen Pulli hervor und schlüpfte hinein.
Angekleidet und wohlriechend ging er hinunter in die Küche, wo Nicole bereits auf ihn wartete.
Der Raum war geschmackvoll ausgestattet, die Mischung aus Holz, Glas und Chrom gab ihm eine gewisse Leichtigkeit und Transparenz. Eine sehr edle Arbeitsplatte verlief die ganze Wand entlang, in der Mitte lud ein freistehender Herd zum Kochen ein. Bis vor wenigen Jahren war diese Küche erfüllt gewesen von fröhlichen Familienfrühstücken, ausgelassenen Pfannkuchenmahlzeiten und romantischen Candle-Light-Dinnern. Aber das schien lange her, inzwischen ließ sich hier niemand mehr zum Kochen und Essen nieder.
»Ich habe dir ein Omelette mit Toast gemacht«, sagte Nicole und schenkte dampfenden Kaffee in eine Tasse.
Mark nahm an dem für ihn gedeckten Tisch Platz, erhob sich jedoch gleich wieder. Seine Hände begannen zu zittern. Ehe er auch nur einen Bissen hinunterbekam, musste er trinken. Er brauchte Alkohol.
Fassungslos beobachtete Nicole, wie er sich fiebrig daranmachte, die erstbeste Weinflasche zu entkorken, um sie dann mit zwei Schlucken halb zu leeren. Seine Angespanntheit löste sich, er setzte sich zurück an den Tisch und aß schweigend.
»Wo warst du, Mark?«, fragte Nicole in die Stille hinein.
»Im Badezimmer«, antwortete er, ohne aufzuschauen.
»Mark, sieh mich an! Wo warst du die letzten zwei Jahre?«
»Unten.«
»Unten?«
»In U-Bahn-Schächten, Abwasserkanälen, Schlammgräben … mit all den anderen Obdachlosen.«
Nicole schüttelte verständnislos den Kopf, sie war den Tränen nahe. »Warum?«
»Du weißt genau, warum«, fuhr er seine Frau an.
Sie ging einen Schritt auf ihn zu und nahm seine Hand. »Aber du hast doch eine Frau, einen Beruf, Freunde …«
Er zog seine Hand zurück und stand auf. »Lass mich bitte in Ruhe!«
»Erklär es mir«, schrie Nicole hilflos, »erklär mir, was es dir bringt, wie ein Penner zu leben!«
Er blickte sie an. »Ich kann nicht anders. Ich kann kein normales Leben führen. Du magst das schaffen, ich kriege es einfach nicht hin.«
»Jetzt fang nicht an, mir Schuldgefühle einzureden, Mark.«
»Ich werfe dir nichts vor. Fang ein neues Leben an, wenn es dir gefällt. Bei mir sitzt der Schmerz zu tief, ich komme nicht darüber hinweg.«
»Du bist Psychologe und Therapeut, Mark. Du hast so vielen Menschen geholfen, furchtbare Katastrophen zu bewältigen.«
»Weißt du, vielleicht will ich diesen Schmerz auch gar nicht überwinden, denn er ist das Einzige, was mich noch am Leben hält. Er ist alles, was mir von ihr bleibt, verstehst du? Es vergeht nicht eine Minute, ohne dass ich an sie denke, ohne dass ich mich frage, was der Entführer ihr wohl angetan hat, ohne dass ich mir den Kopf darüber zerbreche, wo sie in diesem Augenblick sein mag.«
»Sie ist tot, Mark«, entgegnete Nicole kühl.
Er hob drohend den Arm, fasste sie am Hals und drückte zu, als wollte er sie erwürgen.
»Wie kannst du so etwas sagen!«
»Mark, es ist fünf Jahre her!«, rief sie schluchzend und befreite sich aus seinem Griff. »Fünf Jahre, ohne die geringste Spur, ohne eine Lösegeldforderung!«
»Es gibt immer noch die Möglichkeit, dass …«
»Nein, Mark, es ist vorbei. Es gibt keinen Grund zur Hoffnung mehr. Sie wird nicht plötzlich wieder auftauchen. Das wird nicht passieren, niemals, hörst du, NIEMALS!«
»Sei still!«
»Wenn man irgendwann irgendetwas findet, wird es ihre Leiche sein, nichts weiter.«
»NEIN!«
»Doch! Und glaub ja nicht, dass du der Einzige bist, der leidet. Was soll ich denn sagen? Ich habe nicht nur meine Tochter, sondern auch meinen Mann verloren.«
Anstelle einer Antwort stürzte Mark aus der Küche. Nicole folgte ihm, sie war fest entschlossen, ihn diesmal nicht davonkommen zu lassen.
»Hast du je darüber nachgedacht, dass wir andere Kinder haben könnten? Hast du dir nie überlegt, dass mit der Zeit wieder Leben in dieses Haus kommen könnte?«
»Bevor ich über andere Kinder nachdenke, möchte ich meine Tochter wiederhaben.«
»Lass mich Connor Bescheid sagen. Er sucht dich seit zwei Jahren überall. Er könnte dir helfen, aus diesem tiefen Tal herauszufinden.«
»Ich brauche keine Hilfe, um aus diesem tiefen Tal herauszufinden. Meine Tochter leidet, und ich will mit ihr leiden.«
»Da draußen wirst du krepieren! Ist es das, was du willst? Dann geh. Oder jag dir eine Kugel in den Kopf!«
»Nein, ich will nicht sterben. Ich will den Tag erleben, an dem man sie findet.«
Nicole griff nach ihrem Handy und wählte Connors Nummer. Sie benötigte dringend seine Hilfe.
Nun mach schon, Connor, geh endlich ran!
Sie ließ es lange klingeln, bis sie einsehen musste, dass es zwecklos war. Connor würde nicht abheben. Sie musste sich geschlagen geben. Allein würde es ihr nicht gelingen, ihren Mann aufzuhalten.
Inzwischen hatte sich Mark wieder auf der Wohnzimmercouch ausgestreckt. Er war eingeschlafen.
Am nächsten Morgen wachte er früh auf, nahm eine Sporttasche aus dem Kleiderschrank und packte eine Decke, eine Windjacke, eine Schachtel Kekse und mehrere Flaschen Alkohol ein.
Nicole ergänzte dieses Sammelsurium um ein Handy, inklusive Akku und Ladegerät.
»Falls du dich doch entscheiden solltest, Connor anzurufen, oder wenn ich dich dringend sprechen muss …«
Mark öffnete die Haustür. Es hatte aufgehört zu schneien, und das erste Tageslicht legte sich über die Stadt wie ein bläulicher Schleier.
Kaum hatte Mark einen Fuß auf die glitzernde Schneedecke gesetzt, tauchte der schwarze Labrador aus dem Nichts wieder auf. Er bellte aufgeregt und wedelte mit dem Schwanz, als er hinter einer Mülltonne hervorgeschossen kam.
Mark streichelte dem Tier liebevoll den Kopf. Dann blies er in seine Hände, um sie aufzuwärmen, schwang sich die Tasche über die Schulter und ging fort in Richtung Brooklyn Bridge.
Nicole stand auf der Türschwelle und blickte dem Mann ihres Lebens nach, wie er sich im Morgengrauen allmählich entfernte. Hastig lief sie auf die Straße und rief ihm hinterher: »Ich brauche dich!«
Wie ein angeschlagener Boxer drehte sich Mark langsam um und hob die Arme. Als wollte er sagen, wie leid es ihm tue.
Am Ende der Straße bog er um die Ecke – und verschwand.
3
Jemand, der mir ähnlich ist
Die Praxis von Dr. Connor McCoy befand sich in einem der Glastürme des imposanten Time Warner Center, im äußersten Westen des Central Park.
Es erfüllte Connor mit Stolz, einen Raum geschaffen zu haben, in dem seine Patienten sich wohl fühlten und bestmöglich betreut wurden. Seine Klientel war durch persönliche Empfehlungen stetig angewachsen, obwohl seine zuweilen etwas unorthodoxen Methoden nicht von allen Kollegen gleichermaßen geschätzt wurden.
Bis tief in die Nacht saß Connor an diesem Weihnachtstag am Schreibtisch und grübelte über einer Patientenakte. Er unterdrückte ein Gähnen und blickte auf seine Armbanduhr.
»Schon halb zwei!«, entfuhr es ihm. Aber wen kümmerte es, niemand wartete zu Hause auf ihn.
Connor lebte ausschließlich für seinen Beruf, er hatte weder eine Lebensgefährtin noch eine Familie. Die erste Praxis hatte er vor Jahren mit seinem Kindergartenfreund Mark Hathaway eröffnet, der seine Leidenschaft für die Psychologie uneingeschränkt teilte. Beide waren sie in einem sozial schwierigen Viertel in Chicago groß geworden. Beide hatten sie Leid und Elend hautnah miterlebt, bevor sie beschlossen, sich beruflich und mit ganzem Herzen der Entwicklung verschiedenster Therapieformen zu verschreiben. Ihr Erfolg war überwältigend gewesen – bis eines Tages der Himmel über Mark zusammenbrach. Connor hatte alles getan, um seinem Freund zu helfen, hatte mit ihm die Suche nach Layla Tag und Nacht fortgesetzt, als die Polizei längst aufgegeben hatte. Doch Mark war an seinem Kummer zerbrochen und schließlich selbst von der Bildfläche verschwunden. Connor war untröstlich gewesen, er hatte seinen besten Freund verloren. Und damit nicht genug: Es war zugleich seine schmerzlichste Niederlage als Psychologe.
Um die trübsinnigen Gedanken zu verscheuchen, stand Connor auf und schenkte sich einen Tropfen seines edelsten Malt-Whiskys ein.
»Frohe Weihnachten!« Er prostete seinem Spiegelbild in der Fensterscheibe aufmunternd zu.
Der Raum öffnete sich auf allen Seiten zu einer Glasfront hin, er badete im irrealen Lichtschein der nächtlichen Stadt und bot einen schwindelerregenden Blick über den Central Park. Zwei Skulpturen in der Art Giacomettis, die auf einem Metallregal standen, schienen himmelwärts zu streben; ein weiteres Kunstwerk, eine monochrome Malerei von Robert Ryman, verwirrte viele Betrachter, die darauf lediglich ein weißes Quadrat erkannten – Connor hingegen faszinierte das in seinem Variationsreichtum kaum wahrnehmbare Spiel mit Licht auf der Leinwand.
Das Unsichtbare erraten, den Blick hinter die Erscheinung lenken – bestand nicht genau darin auch sein Beruf?
Mit dem Glas in der Hand studierte Connor ein paar Computertomographien auf dem Bildschirm seines Laptops. Sie zeigten eine bestimmte Hirnregion eines seiner Patienten. Wie jedes Mal war Connor vollkommen gefesselt von dem, was er sah.
Lieben, Leiden, Glück, Unglück: All das geschah dort, in den geheimen Kammern unseres Hirns, inmitten der Milliarden von Neuronen. Alles Begehren und Denken, Erinnerung, Angst, Wut oder auch der Schlaf hingen von verschiedenen biochemischen Stoffen ab, die der Organismus ausschüttete: den sogenannten Neurotransmittern, deren Aufgabe es ist, die Information einer Nervenzelle an eine andere weiterzugeben. Schon immer hatte Connor mit großer Aufmerksamkeit und Begeisterung die neuesten Entdeckungen auf dem Gebiet der Neurowissenschaften verfolgt. Er war sogar einer der Pioniere gewesen, die als Erste die biochemischen Ursachen, die während einer Depression stattfinden, analysierten. Die Studie, an der er mitgewirkt hatte, zeigte beispielsweise, dass bestimmte Mutationen eines Gens eine höhere Disposition zu Depression und Selbstmord bedingen als seine ursprüngliche Form. Es war also ganz und gar nicht so, dass alle Menschen mit denselben Voraussetzungen dafür geboren wurden, die Prüfungen des Lebens zu meistern.
Dennoch wollte Connor nicht vor diesem vermeintlichen genetischen Determinismus kapitulieren. Er war der Überzeugung, dass die seelische Struktur eines Menschen kaum von seinen biologischen Gegebenheiten zu trennen war, und so hatte er als junger Arzt immer sorgsam darauf geachtet, sich auf beiden Gebieten – der Psychologie und der Neurologie – fortzubilden. Selbstverständlich werden wir von unserem genetischen Erbgut geprägt, doch im Laufe eines Lebens kann es durch affektive Beziehungen umprogrammiert werden. So jedenfalls lautete Connors Credo: Nichts ist definitiv entschieden.
Der Arzt leerte das Whiskyglas in einem Zug, zog seinen Mantel über und verließ die Praxis.
In dem gigantischen Gebäude waren unter anderem ein Fünf-Sterne-Hotel, mehrere Restaurants und ein Jazzclub untergebracht. Der ausgelassene, fröhliche Lärm drang über mehrere Etagen und unterstrich einmal mehr die Einsamkeit des Psychologen.