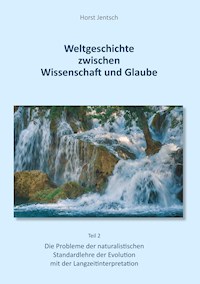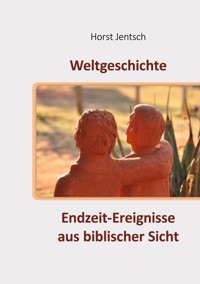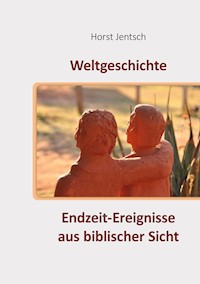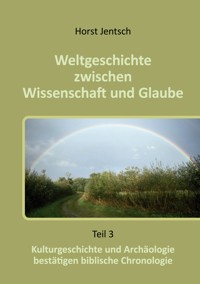
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im nun vorliegenden Buch Teil 3, erfolgt unter kulturgeschichtlichen Aspekten die kritische Auseinandersetzung mit der traditionellen Geschichtsschreibung, der maßgeblich die ägyptische Chronologie zu Grunde liegt. Gegenüber der etablierten ägyptischen Chronologie erlauben archäologische, geologische und historisch relevante Forschungsergebnisse bedeutender wissenschaftlicher Persönlichkeiten inzwischen eine ganz andere zeitliche Zuordnung. Auf Grund dieser Forschungsarbeit gelingt in Teilen der Aufbau einer neuen ägyptischen Chronologie. Auf diese Weise war es möglich, ein dem tatsächlichen geschichtlichen Ablauf entsprechendes aussagefähiges chronologisches Gesamtbild dieser speziellen Zeitepoche zu erstellen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Kapitel 8 ´
Kulturgeschichtliche Erscheinungsformen auf dem Wege zu Hochkulturen
8.1 Das Phänomen der Bibel und ihre kulturgeschichtliche Bedeutung
Die Bedeutung der Bibel für die Menschheitsgeschichte
Nur die kanonischen Bücher sind anerkannte heilige Schriften
Irrtumslosigkeit und Widerspruchslosigkeit - nur „fundamentalistische“ Begriffe?
Wann und von wem wurde die Thora geschrieben?
Die Erfindung der Schrift - wann?
Biblische Sippenchronik authentisch überliefert
Die Chronologie biblischer Patriarchen
Die Weltchroniken zur Schöpfungsgeschichte
8.2 Das kulturgeschichtliche Phänomen der Hochkulturen
Unsicherheiten im Rückblick auf die Weltgeschichte?
Die Lebensformen zur Hochkultur entstehen schlagartig
Exkurs zur Möglichkeit der Entstehung von Leben in einem Evolutionsprozess
Kann die traditionelle Chronologie der Hochkulturen als abgesichert gelten?
Kapitel 9
Ermittlung von Eckdaten für eine Alternative zur etablierten ägyptischen Chronologie
9.1 Einstiege in die Thematik
9.2 Möglichkeiten des Umdatierens der ägyptischen Chronologie nach Schirrmacher
9.3 Die Eroberung Jerichos bereits um 1400 vor Christus?
9.4 War das Volk Israel überhaupt in Ägypten?
Israels Exodus und der Durchzug durchs Schilfmeer
9.5 Die Möglichkeiten des Umdatierens der ägyptischen Chronologie nach Rohl
9.5.0 Auf der Suche nach der historischen Wahrheit
9.5.1 Bestätigen die Amarnabiefe die Regierungszeit der Könige Saul und David?
9.5.2 Die Rolle des ägyptischen Pharaos Ramses II. in der Geschichte Israels
War Ramses II. der biblische Pharao des Auszugs Israels aus Ägypten?
Welche Schlüsselrolle spielte der bibl. Schischak und wer also war dieser König?
9.5.3 Die Bedeutung der Pharaonen der 13. Dynastie für Mose und das Volk Israel
Wer war der Pharao des Moses?
Wer war der Pharao des Exodus?
9.5.4 Wie lange war das Volk Israel wirklich in Ägypten?
9.5.5 Wer war der Pharao des Großwesirs Josef?
9.5.6 Gibt es archäologische Belege für die Hungersnot unter Josef?
Kapitel 10
Die israelische Chronologie als Alternative zur etablierten ägyptischen auf Basis neuen ägyptischen Chronologie
10.1 Die Probleme mit der zeitlichen Zuordnung zu den geschichtl. Ereignissen
10.2 Die chronologische Geschichte Israels nach der Bibel
10.3 Schnittpunkte der israelischen Chronologie mit der neuen ägyptischen im Vergleich
Vorwort
Die etablierte Kultur- und Geschichtswissenschaft ist ebenfalls von der Standardlehre der naturalistischen Evolution alternativlos geprägt. Ausgehend von dieser Lehre werden geschichtlich lange Zeiten für die rein zufällige Entwicklung des Lebens aus einfachen Anfängen - auch ebenso für die des Menschen und seiner Kultur - vorausgesetzt. Erst vor höchstens ca. 2,5 Millionen Jahren sollen dann die Urahnen des Menschen in Erscheinung getreten sein. Kulturelle und fossile Spuren dafür aufzufinden, gestaltete sich aber als äußerst schwierig.
So ist bis heute nicht bekannt, wie alt die älteste Kultur in Wirklichkeit ist. Sicher belegt sind nicht einmal die Ereignisse, die sich vor ca. 5000 Jahren abgespielt haben. Ein sicherer chronologischer Nachweis für die Ereignisse der 1. und 2. ägyptischen Dynastie und ihrer Herrscher - bis etwa zum Jahr 2600 v. Chr. - ist auch nicht möglich. Ähnliches gilt für das alte Indien und China. Erst recht trifft dies für den eigentlichen Beginn der allerorts plötzlich entstehenden Hochkulturen zu. Für etwas älter hält man die Kulturgeschichte der Sumerer in Mesopotamien. Schriftliche Zeugnisse ihrer Geschichte sind in einer Fülle von ausgegrabenen Tontafeln vorzufinden. Klar ersichtlich ist, dass man bezüglich des eigentlichen Beginns der Menschheitsgeschichte nur auf ein paar tausend Jahre zurückblicken kann.
Eine Unterstellung stellt dar, dass sich der Mensch aus ganz primitiven Vorstufen über viele Zwischenstufen entwickelt habe. Beweise für diese Vorgänge existieren nicht!
Als Vorstufen werden vor allem Funde von Knochenfragmenten und Artefakte menschlicher Tätigkeit ins Feld geführt, deren Alter man an dem sehr hoch angesetzten der Gesteins- und Sedimentschichten festmacht, in denen diese menschlichen Lebenszeichen gefunden wurden.
In Buch Teil 2 kann in Kapitel 7 anhand menschlicher Artefakte und Fossilien ganz im Gegenteil dazu nachgewiesen werden, dass die menschliche Geschichte ein junge ist, und der Mensch von Anfang an - über alle in den Geologischen Zeittafeln festgelegten Zeitalter hinweg - stets anwesend war. Dabei befand er sich geistig auf hohem Niveau, wie es viele Bodenfunde belegen, die allerdings in diesen Tafeln gänzlich unterdrückt werden.
Die Aussage dieser unterdrückten Funde ist, dass es viele Spuren schöpferischer menschlicher Existenz gibt, die dem Intelligenzgrad des heutigen Menschen völlig entsprechen. Allein die Zeittafeln konnten um hunderte Funde menschlicher Artefakte, die in den etablierten Tafeln nicht aufgeführt sind, ergänzt werden. Diese Funde lassen sich interessanterweise nach ihren Fundstellen altersmäßig vom Holozän bis hin zum Präkambrium zuordnen. Sie wurden offenbar deshalb unterdrückt, weil sie nicht zu dem vom wissenschaftlichen Establishment akzeptierten naturalistisch geprägten Schema passen, wonach Menschen nicht beispielsweise schon vor 500 Millionen Jahren (nach offizieller Zeitrechnung) gelebt haben können.
Wie aber aus meinem Buch „Weltgeschichte zwischen Wissenschaft und Glaube Teil 2 Die Probleme der naturalistischen Standardlehre der Evolution mit der Langzeitinterpretation“ hervorgeht, stellt der Nachweis des Alters der geologischen Schichten vom Präkambrium bis zur Eiszeit in Millionen und Milliarden von Jahren eine riesige Problematik dar.
Der Geologe und Biologe Joachim Scheven sagt in seinem Buch „Der Schatz im Acker“ dazu:
„Die stratigraphische Abfolge der einzelnen Systeme auf der Zeittafel hat nichts mit Jahrmillionen zu tun. Sie ist durch Beobachtungen im Gelände ermittelt worden und existiert ganz unabhängig von >>Jahrmillionen<< und Evolution.
Das relative Alter der Schichten zueinander ist korrekt dargestellt.Ein beliebiges Argument gegen die unverrückbare Abfolge der geologischen Systeme auf der stratigraphischen Tabelle ist die Existenz von >>verkehrt herum<< liegenden Gesteinsschichten. Wenn eine aus mehreren Ablagerungseinheiten bestehende Gebirgsfalte bei einer horizontalen Bewegung umkippt, kommen die Schichten des einen Schenkels tatsächlich in umgekehrter Reihenfolge zu liegen“1
Entsprechend der Vorstellung der Evolutionslehre geht man davon aus, dass für die Bildung der Sediment- und Gesteinsschichten Millionen und Milliarden von Jahren erforderlich waren.
Die stratigraphische Ablagerung der einzelnen geologischen Schichten erfolgte aber unter kataklysmischen Bedingungen (vor allem durch Wasser) und vollzog sich deshalb stets innerhalb kürzester Zeit, so dass das relative Alter der Schichten zwar schon korrekt dargestellt ist, aber die Angabe in Jahrmillionen nicht ihrem tatsächlichen Alter entspricht.
Wie sich auch in nachfolgenden Ausführungen noch zeigen wird, ist in Wirklichkeit die Geschichte der Menschheit auf der Erde eine außerordentlich junge. Der Mensch dürfte nach der biblischen Aussage des griechischen Grundtextes der Septuaginta wahrscheinlich erst seit ca. 7300 Jahren (siehe Punkt 8.1, Unterpunkte „Die Chronologie biblischer Patriarchen“ und „Weltchroniken zur Schöpfungsgeschichte“) die Erde bevölkern. Angenommen wird, dass das im Genesisbericht geschilderte Geschehen zur Erschaffung von Leben auf der Erdkruste dann vor höchsten 10000 Jahren stattgefunden haben kann. Wie auf allen anderen Gebieten der Wissenschaft bemüht man sich aber auf dogmatische Weise im Gegensatz dazu- auch in der Kultur- und Geschichtswissenschaft - dem Anspruch der naturalistischen Standardlehre der Evolution zu entsprechen.
Die rasante und geradezu explosionsartige Entwicklung der Hochkulturen aber, die sich nach der Sintflut erst ab ca. 3000 v. Chr. vollzog, ist ein nicht zu übersehender Hinweis darauf, dass das dafür erforderliche notwendige Wissen vorhanden war. Alles weist darauf hin, dass das erforderliche Know-how zur Verfügung stand und bereits von der vorsintflutlichen Menschheit entwickelt und genutzt wurde. Es gibt keinerlei Informationen und Anzeichen dafür, dass in den angeblichen Millionen von Jahren irgendetwas an Wissen entstanden wäre, das das plötzliche Hervorbringen z. B der Hochkulturen erklärbar macht.
Ziel und Schwerpunkt dieses Buches ist deshalb eine kritische Auseinandersetzung mit den unzureichenden Erklärungen für das Entstehen der menschlichen Kulturgeschichte und ihrer Erscheinungsformen, davon besonders betroffen ist ihre Chronologie. Es kann einfach nicht hingenommen werden, dass man so gut wie überhaupt nicht dazu bereit ist, alternativ zu denken. Vor allem dann nicht, wenn die Quelle (z. B. die Bibel) verdächtig erscheint, weil sie nicht zum Paradigma der naturalistischen Standardtheorie passt, das einer ideologischen Sichtweise entspricht
So macht Kapitel 8 auf der Basis kulturgeschichtlicher Erscheinungsformen auf dem Wege zu den Hochkulturen den Leser mit dem Phänomen ihrer spontanen Entstehung bekannt. Zuerst wird dabei allerdings in Punkt 8.1 auf das Phänomen der Bibel und ihre kulturgeschichtliche Bedeutung für die Menschheit hingewiesen.
Der traditionellen Geschichtswissenschaft liegt maßgeblich die ägyptische Chronologie zugrunde, die als allgemein anerkannte vertreten wird, an der sich dann im Laufe der Zeit weitgehend auch alle anderen Weltchroniken orientiert haben. Sie wird zurückgeführt auf den Priester Manetho, der ein ägyptischer Geschichtsschreiber um 300 v. Chr. war und baut nur auf dessen Fragmenten auf, die stets stark überarbeitungsbedürftig waren. Die Originale wurden nämlich bei dem großen Brand in der Bibliothek von Alexandria sogar zerstört, wodurch nur Fragmente übrigblieben. Diese wurden dann z. B. von dem jüdischen Geschichtsschreiber Josephus Flavius und anderen aufbereitet und liegen seit ca. dem ersten Jh. n. Chr. - verschiedentlich auch publiziert- vor.
In Kapitel 9 werden dann auf der Suche nach einer Alternative zur etablierten ägyptischen Chronologie wichtige Eckdaten zusammengetragen, die im Zuge einer neu entwickelten ägyptischen schließlich eine andere weltgeschichtliche Sicht ermöglichen. Diese neue Sicht stützt sich dabei auch auf naturwissenschaftliche, archäologische, geologische und geschichtliche Forschungsergebnisse.
Schließlich kann in Kapitel 10 eine Alternative zur ägyptischen Chronologie aufgrund der israelischen und einer neuen ägyptischen dargestellt werden. Dabei gelingt es an den Schnittstellen, die Wirkzeiten biblischer Patriarchen denen der zu gleicher Zeit regierenden ägyptischen Königen gegenüberzustellen. Gefunden wird so z. B. der Pharao des Großwesirs Joseph, der des zum ägyptischen Prinzen erhobenen Mose, der des Exodus, d. h. der des Auszugs Israels aus Ägypten.
Um mir auch auf diesen Fachgebieten einen Durchblick zu verschaffen, ist in mehr als drei Jahrzehnten vor allem archäologisches und geschichtliches Schriftgut unterschiedlichster Autoren gesammelt und ausgewertet worden.
Als Ingenieur und Betriebswirt und somit in Bezug auch auf diese Fachsparten als Autodidakt war die Bewältigung dieses Vorhabens für mich mit hohen Anforderungen verbunden. Schließlich führte dies - wie bei den anderen beiden Büchern auch - zu der Idee, die erarbeiteten Erkenntnisse ebenfalls in einem Buch festzuhalten.
Auch dieses hätte nicht ohne die vielfältigen Dienste von Jürgen Schmid und Günter Karrenberg vervollständigt werden können. Ihre Hinweise führten zu vielfachen Korrekturen und auch textlichen Veränderungen Sehr dankbar bin ich für die besondere Betreuung und die Korrekturen von Fritz Blacha und Dieter Zemann, die zu diesem Zweck jeweils das ganze Buch gelesen haben. Besondere Hilfe wurde mir zusätzlich von Jürgen Schmid noch bei Satz und Sichtung zu Teil. Mein besonderer Dank gilt auch Dr.-Ing. Frank Jenne für Coverbild und -entwurf und auch meiner Frau für ihre große Geduld.
Troisdorf, 2023
Horst Jentsch
1 Joachim Scheven, „Der Schatz im Acker“, Kuratorium Lebendige Vorwelt e. V., Seiten 277-278).
Kapitel 8
Kulturgeschichtliche Erscheinungsformen auf dem Wege zu Hochkulturen
Das Phänomen der Bibel und ihre kulturgeschichtliche Bedeutung
Die Bedeutung der Bibel für die Menschheitsgeschichte
Die Heilige Schrift trägt sehr zum Verständnis der menschlichen Kulturgeschichte bei und hat in der Menschheitsgeschichte eine große Bedeutung erlangt. Nach dem Genesisbericht 1. Mose 1,1-31 erhalten wir eine Sicht für das Zustandekommen des Lebens auf unserer Erde vor höchstens 10000 Jahren. Zu verstehen ist die explosionsartige Entwicklung der Hochkulturen nur auf der Basis dieses Geschehens, weil danach die Menschheit - von Anfang an und geistig hochentwickelt - über alle geologischen Zeitalter hinweg (vom Kambrium bis zum Holozän) anwesend gewesen sein muss.
Dabei bestätigen eine ganze Reihe von historischen, geologischen und archäologischen Gegebenheiten, wie gezeigt werden kann, die Aussagen der Bibel. Ihre prophetischen Aussagen stimmen mit den historisch eingetretenen Ereignissen überein, wie sich dies immer wieder als tatsächliche Gegebenheit erweist. Außerdem lässt sich zeigen, dass auf der Basis der biblischen Geschlechtsregister ab Adam über Abraham, bis Salomo, eine Chronologie für das Volk Israel und ihre Patriarchen erstellt werden kann. Es gibt kein ähnliches literarisches Werk in der Weltgeschichte, das eine Chronologie bis zum Anfang der Menschheitsgeschichte darstellen kann.
Gezeigt wird im Kapitel 10, dass mit Hilfe der von Mose detailliert überlieferten Geschlechtsregister eine Chronologie für die Patriarchen Israels zeitgleich zu den ägyptischen Herrschern abzuleiten möglich ist. Diese baut auf dem Schlüsselereignis des Auszugs des Volkes Israel aus Ägypten (Exodus) auf. Dies darzustellen, gelingt nicht mit der traditionellen ägyptischen Geschichtsschreibung und auch ansonsten mit keiner anderen.
Dies aufzuzeigen, ist schwerpunktmäßig das Hauptanliegen dieses Buches.
Mit der Bibel ist uns also ein schriftliches Wunderwerk überliefert, das aus zwei Textsammlungen, dem Alten Testament (A T) und dem Neuen Testament (N T), im Sinne von Heiliger Schrift, besteht. Oft wird eingewandt, dass die schriftliche Überlieferung der Bibel nicht schon vor ca. 3500 Jahren mit Mose habe beginnen können. Das Gegenteil beweisen antike Aufzeichnungen (siehe nachfolgende Unterpunkte „Wann und von wem wurde die Thora geschrieben?“ und „Die Erfindung der Schrift - wann?“.
Gott hat durch seine Heiligen Geist und durch Menschen zu Menschen gesprochen. In der Bibel bezeugen diese zum einen Gott und sein Wirken, zum anderen ist sie das Zeugnis Gottes über sich selbst. Als Heilige Schrift enthält sie darüber hinaus Gottes Weisungen für ein gedeihliches Zusammenleben in unserer Welt. Insbesondere trifft dies auf die Zehn Gebote zu. Diese und viele andere Weisungen fanden zum Zwecke eines geordneten Zusammenlebens von uns Menschen ihre Entsprechung in vielen unserer Gesetze. Ein sinnvolles Miteinander in der Gesellschaft von Menschen ist nur unter Beachtung dieser Maßgaben bzw. Weisungen möglich. So stellt die Bibel eine unfehlbare Weisung für Glauben und Leben dar, weil sie von dem Heiligen Geist inspiriert ist, der ihr Autor ist und so irrtumslos Gottes wahres Wort darstellt.
Die Heilige Schrift bezeugt dies in 2. Timotheus 3, 16 (Luther 84) unmissverständlich wie folgt:
„Denn alle Schrift von Gott eingegeben (also inspiriert), ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit.“
Ebenso betrifft dies das ganze prophetische Wort, wenn in 2. Petrus 1,20-21(Luther 84) dazu steht:
„Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet.“
Nachstehend wird dargestellt, wie es zum Ursprung und zur Entstehung deutscher Bibeln kam:
Ursprung und Entstehung deutscher Bibeln
Literaturhinweise:Internet Attachment - Anzeige „Entstehung und Aufbau deutscher Bibeln“
Thompsons Studienbibel, Hänssler-Verlag, rev. Fassung 1984, „Ursprung u. Entstehung deutscher Bibeln“, Seite 4171
A, Schick und U. Gießner, „Auf der Suche nach der Urbibel“, Onken-Verlag 2000
„Die erstaunliche Geschichte der Bibel“, Verbreitung der Heiligen Schrift, Zürich, 7. Auflage 2002
In der Heiligen Schrift von entscheidender Bedeutung ist dabei ein zentrales Thema, das die ganze Bibel des A T und des N T wie ein roter Faden durchzieht. Es geht um den Glauben an den Herrn Jesus Christus, wobei sich darin die Geister scheiden. Dabei geht es für alle Menschen um drei Ereignisse von heilgeschichtlicher Bedeutung und zwar um
Jesu Christi erstes Kommen auf unsere Erde,
seinen Opfertod am Kreuz von Golgatha zur Vergebung unserer Schuld vor Gott dem Vater, weil niemand mit dieser - wegen der Heiligkeit Gottes - Zugang zum Reich Gottes hätte,
seine Auferstehung von den Toten
und um seine Wiederkunft und dem was damit verbunden ist.
Im Glauben daran werden die einen - nach ihrem Tode - zum Leben im Gottes Reich auferstehen. Dagegen geschieht die Auferstehung der anderen nur noch zum Gericht. Verbunden ist dies schließlich - fern von Gott - mit einer schrecklichen Zukunft für die Ungerechten.
So halten viele Menschen leider ihr Leben lang - bis zum Ende desselben - unbeirrt den Glauben für eine Torheit. Der Heilige Geist - als der Autor der Schrift - hat Paulus in 1. Korinther 1,18 sogar folgendes dazu sagen lassen:
„Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist‘s eine Gotteskraft.“
Gott gefiel es, z. B. „durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben“ (Vers 22). Und der Apostel sagt dazu außerdem: „ … und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft“ (2. Korinther 2,4-5). So ist diese Kraft also als ein Geschenk des Heiligen Geistes, welches - als das Wunder des Glaubens - inzwischen schon Millionen Menschen erhalten haben.
Im nächsten Unterpunkt sind als Nächstes die kanonischen Bücher der Bibel Gegenstand der Betrachtung, die, als unaufhebbares Wort Gottes, für uns Christen verbindliche Richtschnur für ein Leben nach göttlichem Maßstab sind.
Nur die kanonischen Bücher sind anerkannte heilige Schriften
In seinem Buch „Hermeneutik der Bibel“ sagt der Rektor der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel Jacob Thiessen, dass das Wort „kanon“ vom hebräischen Wort kaneh „Rohr“ abgeleitet ist und die Regel, nach der man misst, bezeichnet, aber auch das, was gemessen wird. Das Wort „Kanon“ hat im weitesten Sinne die Bedeutung von „Richtschnur, Maßstab, Regel, Norm“. Es geht bei diesem Begriff einfach um den unaufhebbaren Kern der Wahrheit des Evangeliums, für deren Bewahrung der Kanon die maßgebliche Richtschnur und Norm ist. Wobei offensichtlich die Bibel schon normative Schriftsammlung war, bevor sie als „Kanon“ bezeichnet wurde. So ging das Judentum schon in vorchristlicher Zeit von einem geschlossenen alttestamentlichen Kanon aus. Auch wurden Listen mit Schriften aufgestellt, die zum Kanon gehören, während andere von diesen Listen ausgeschlossen waren. Wesentliches Kriterium ist, dass der Kanon als göttlicher Maßstab und göttliche Autorität dem Gottesvolk durch göttliche Fügung gegeben wurde. Sehr interessant ist Thiessens Aussage, dass das Alte Testament bereits ca. 435 v. Chr. mit der Zeit des Propheten Maleachi zum Abschluss gekommen ist.
Zum Ursprung des Kanons weist er in dieser Beziehung darauf hin, dass möglicherweise die Erzväter selbst schon ihre eigenen Geschichten auf Tontafeln aufgeschrieben haben. Thiessen hält es deshalb sogar für möglich bzw. für wahrscheinlich, dass der Inhalt des Buches Genesis (Mose 1) so bereits als Ganzes dem Mose vorlag. 2
Wenn in 2. Sam 11,14 steht, dass David einen Brief an seinen Feldherrn Joab schrieb, muss er lange vor Mose des Schreibens kundig gewesen sein. Das Mose dann auch schreiben konnte, weil dies die Bibel sogar mehrfach bezeugt, kann deshalb als sicher angenommen werden. Dazu später mehr.
Ohne die Lenkung durch den Geist Gottes bliebe es aber einfach unerklärlich, wie eine so überragende Übereinstimmung der Texte bei so vielen Abschriften, die über viele Jahrhunderte gemacht wurden, erreicht werden konnte. Dies ist weitgehend fehlerfrei geschehen. Die Bibel wirkt wie aus einem Guss gefertigt. Entstanden sind dabei 66 Bücher (bzw. 70 Bücher, wenn die Psalmen als 5 Einzelbücher gezählt werden), an denen ungefähr 40 Personen beteiligt waren. Es handelte sich um Personen aus den verschiedensten Zeiten, Kulturen, sozialen Schichten und Berufen. Es gibt, wie schon gesagt, nichts Vergleichbares in der antiken Literatur.
Von den jüdischen Gemeinden übernahm die christliche Urgemeinde die Septuaginta als griechische Übersetzung des A T aus dem Hebräischen. So war es beispielsweise diese Bibel, die in den Synagogen und auch in den Versammlungen der Christen in ihren Gottesdiensten gelesen wurde. In der Orthodoxen Kirche werden heute noch große Teile der Septuaginta in den Gottesdiensten gelesen. Die Septuaginta enthält neben den kanonischen Büchern auch eine Reihe von so genannten deuterokanonischen Schriften (Apokryphen). Einige davon gehören auch zum Anhang heutiger Bibelübersetzungen.
Zu den Apokryphen vermerkt der Brockhaus, dass es bei diesen Büchern um, im hellenistischen Sprachgebrauch, geheim gehaltene heilige Bücher geht, die im jüdischen und christlichen Gemeindeleben nicht vollwertige, doch den anerkannten biblischen Büchern (den kanonischen) gegenüber, nach Anlage und Inhalt, allenfalls nur ähnliche Schriften sind. In der alten Kirche waren sie nämlich vom öffentlichen Gebrauch ausgeschlossen. 3
Bei den kanonischen Büchern geht es also um solche, die als verbindliche Lehre Bestandteil der Bibel sind. Sie sind nicht von irgendeiner Instanz dazu erklärt worden. Unter der Leitung des Heiligen Geistes haben Menschen aufgeschrieben, was über die Jahrhunderte in einzigartiger Weise entstanden ist.
Der Brockhaus vermerkt, dass der jüdische Kanon des A T von pharisäischen Kreisen auf der Synode von Jamnia (um 100 n. Chr.) schließlich so festgelegt worden ist. Dabei sind - auch zu diesem Zeitpunkt - alle in der griechischen Übersetzung der Septuaginta enthaltenen apokryphischen Bücher als nicht kanonisch abgelehnt worden. So wurde von der Synode wieder nur nachvollzogen, was in den jüdischen Gemeinden längst gebräuchliche Praxis war.
Der Anlass für die Herausbildung des neutestamentlichen Kanons war die Abgrenzung der Christen in den urchristlichen Gemeinden gegenüber den Anhängern häretischer (ketzerischer) Bewegungen. Es ging dabei darum, aus der Vielzahl Schriften, die seit dem 2. Jh. n. Chr. - meist unter dem Namen eines Apostels - im Umlauf waren, jene auszuscheiden, die nicht vollwertige biblische Wahrheit darstellten. Kriterium für die Auswahl war die Frage, inwieweit eine Schrift bereits in Liturgie und Predigt Verwendung fand und zur Erbauung der Gemeinde beitrug. Die endgültige Fixierung des neutestamentlichen Kanons ist wohl erst im 4. Jh. n. Chr. erfolgt. Z. B stammt das älteste Exemplar der Septuaginta aus dieser Zeit. Die 27 Schriften des N T werden nämlich erstmals im Osterfestbrief des Athanasios von 367 n. Chr. aufgezählt. Luther nahm aber auch die deuterokanonischen Bücher als Apokryphen in den Anhang seiner Bibelübersetzung auf. 4
Was aber haben die kanonischen Bücher des A T mit denen des N T zu tun? Es wird häufig sogar auch von „Christen“ behauptet, dass sie wenig oder nichts miteinander zu tun hätten.
In akribischer Arbeit habe ich versucht herauszufinden, welche Verbindungen zwischen dem AT und dem NT bestehen. Meine Auswertung erbrachte ein erstaunliches Ergebnis! Mehr als ca. Achthundertmal wird im NT direkt oder indirekt auf das A T Bezug genommen. Als direkt zitiert und damit absolut sicher, habe ich 169 Stellen gezählt. Im NT nicht erwähnt fand ich die Bücher des AT Esther, das Hohelied Salomos, Obadja und Nahum.
Ich fand außerdem heraus, dass in der Thomson Studienbibel von den nicht kanonischen Schriften nur in Apostelgeschichte 12,23 und dabei nur einmal indirekt ein Hinweis auf 2. Makk. 9,9 gegeben wird. In der Makkabäer-Textstelle wird auf das Ende von Herodes Agrippa hingewiesen, der von Würmern zerfressen starb. Hier wird aber nur ein Ereignis beschrieben, das ja als Glaubensaussage keinerlei heilsgeschichtliche Bedeutung hat. Für uns Christen bedeutet dies, dass die nichtkanonischen Bücher nützlich zu lesen sein mögen, wie Martin Luther dies betonte, aber keinerlei heilsgeschichtliche Bedeutung besitzen.
Wegen der Wichtigkeit der kanonischen Bücher werden an dieser Stelle die so genannten Chicago-Erklärungen, die ein Bekenntnistext für bibeltreue Organisationen und Christen sind, eingebracht. Die Erklärungen wurden im Rahmen der Veranstaltungen dieser Vereinigung erarbeitet. Einige der nachstehend zum Zuge kommenden Informationen wurden diesen Veröffentlichungen entnommen. Dem Vorstand und dem Beirat dieser Vereinigung gehörten mindesten 50 international bekannte Theologen aus der ganzen Welt an. Diese Artikel des Bekennens und Verwerfens stellen den Konsens von etwa 100 Teilnehmern und Beobachtern dar, die bei der Konferenz beisammen waren. Insgesamt fanden drei Treffen des Internationalen Rats für biblische Irrtumslosigkeit (ICBI) statt und zwar 1978, 1982 und 1986. Die Arbeiten waren 1988 abgeschlossen und die Vereinigung wurde wieder aufgelöst.
Der Schrift des Herausgeber der deutschen Abfassung, Thomas Schirrmacher wird entnommen, worauf es bei dem biblischen Text im Wesentlichen ankommt:
„Die Heilige Schrift ist die Selbstoffenbarung Gottes in und durch die Worte der Menschheit. Sie ist sowohl deren Zeugnis von Gott, als auch Gottes Zeugnis über sich selbst. Sie ist so völlig göttlich, wie sie menschlich ist. Es ist zu erkennen, dass der alttestamentliche Kanon zur Zeit Jesu feststand. Der neutestamentliche Kanon ist heute gleichermaßen abgeschlossen, und zwar deswegen, weil heute kein neues apostolisches Zeugnis vom historischen Jesus mehr abgelegt werden kann.“5
Schirrmacher führt weiter aus, dass Gott nirgends eine unfehlbare Überlieferung der Schrift verheißen hat und nur der autographische (urschriftliche) Text der Originaldokumente inspiriert ist. Festzuhalten ist an der Notwendigkeit der Textkritik, dies als Mittel zum Aufdecken von Schreibfehlern, wenn sich im Laufe der Textüberlieferung in den Text Fehler eingeschlichen haben könnten. Das Urteil der Wissenschaft lautet, dass der hebräische und griechische Text erstaunlich gut erhalten und überliefert ist. So ist die Autorität der Schrift in keiner Weise durch die Tatsache, dass die Abschriften nicht völlig ohne Fehler sind, infrage gestellt. 6
Irrtumslosigkeit und Widerspruchslosigkeit - nur „fundamentalistische“ Begriffe?
Wie Schirrmacher auch schreibt, hält es die evangelikale Theologie aber für angemessen, „die Heilige Schrift als inspiriertes Wort Gottes, das autoritär von Jesus Christus zeugt, als unfehlbar und irrtumslos zu bezeichnen. Der Begriff „unfehlbar“ bezieht sich auf die Qualität, dass etwas weder in die Irre führt, noch irrgeleitet ist und schützt so kategorisch die Wahrheit, dass die Heilige Schrift ein gewisser, sicherer und zuverlässiger Grundsatz und eine Richtschnur in allen Dingen ist. In ähnlicher Weise bezeichnet der Begriff „irrtumslos“ die Qualität, dass etwas frei von allen Unwahrheiten oder Fehlern ist, und schützt so die Wahrheit, dass die Heilige Schrift in allen Aussagen vollständig, wahr und zuverlässig ist. Die Schrift ist nicht irrtumslos im Sinne einer absoluten Präzision nach modernem Standard, sondern in dem Sinne, dass sie ihre eigenen Ansprüche erfüllt und jenes Maß an konzentrierter Wahrheit erreicht, das seine Autoren beabsichtigen.“7
Es braucht dabei nicht unterdrückt zu werden, dass Abschreibfehler vorgekommen sind. Es ist aber bekannt, dass beim Auffinden derselben die Abschreiber diese nicht einfach entfernten, sondern die Abschrift neu verfassten. Es wird angenommen, dass man so auch mit den Urschriften verfuhr, so dass diese möglicherweise deshalb nicht erhalten geblieben sind. Diese Verfahrensweise trug dazu bei, dass die Abschriften äußerst präzise angefertigt wurden, weil sich die Abschreiber über tausende von Jahren hinweg möglichst größter Genauigkeit befleißigten. Manchmal differieren die Zahlenangaben. Die trifft besonders für Chroniken und Geschlechtsregister zu. Die unterschiedlichen Angaben beruhen auf divergierenden chronologischen Systemen in MT (Übersetzungstext der Masoreten aus dem Hebräischen) und dem der LXX (Septuaginta), übertragen ins Griechische.
Für die erstaunliche Übereinstimmung der Übersetzungen dürfte der Heilige Geist gesorgt haben, wie dies sich auch besonders beim Vergleich der Texte, die in Qumran gefunden wurden, mit den ca. 1000 Jahre später angefertigten Abschriften der Masoreten (Bibelabschreiber) aus dem Hebräischen, erwiesen hat.
Wir wissen aus der Bibel, dass beispielsweise die Jeremiarolle von dem amtierenden jüdischen König Jojakim mit einem Schreibmesser stückweise abgeschnitten und dem Feuer übergeben und damit vernichtet wurde. Und wir wissen weiter, dass die Schriftrolle von Jeremia auf Gottes Befehl neu abgefasst wurde. In Jeremia 36,32 wird berichtet, dass dazu eine andere Schriftrolle von Jeremia dem Schreiber Baruch übergeben wurde. Wörtlich:
„Der schrieb darauf, so wie ihm Jeremia vorsagte, alle Worte, die auf der Schriftrolle gestanden hatten … und es wurden ihnen noch viele ähnliche Worte hinzugetan.“
Fakt ist, dass sich beispielsweise auch der unter so widrigen Umständen neu entstandene Text der Jeremiarolle, der auch in Qumran aufgefunden wurde, von dem von den Masoreten viel später übersetzten Text nur ganz unwesentlich unterscheidet. Gerade an diesem Beispiel erkennt man, mit welcher Präzision die Abschreiber gearbeitet haben, wofür natürlich wieder der Geist Gottes gesorgt haben dürfte.
Es gibt sogar viele Belege dafür, dass die Abschriften der Masoreten aus der hebräischen Bibel mit den archäologischen Funden von Qumran in eindrucksvoller Weise fast völlig übereinstimmen. Die umfangreichen Funde betreffen allerdings nicht sämtliche Bücher des AT. Einige wurden nicht gefunden. Allerdings besteht kein Zweifel daran, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Deponierung, vorhanden gewesen sein müssen.
Wann und von wem wurde die Thora geschrieben?
Es wird behauptet, dass diese keineswegs so alt sei, wie angenommen wird. Man vertritt inzwischen die Auffassung, dass Mose die Thora überhaupt nicht hätte schreiben können, weil er kein Alphabet besaß. Man glaubt, dass seine Bücher überhaupt erst im sechsten Jahrhundert v. Chr. aus dem Gedächtnis aufgeschrieben worden seien, so dass Mose gar nicht der Verfasser gewesen sein könnte. Die Heilige Schrift selbst widerspricht aber dieser These auf das Entschiedenste.
Im Text von Johannes 5,46 spricht Jesus z. B. davon, dass Mose über ihn geschrieben hat (1. Mose 3,15). Auch aus anderen Bibeltexten geht deutlich hervor, dass Mose der Autor seiner Bücher war. Auch wenn er sich manchmal vielleicht eines Schreibers bediente, muss er selbst des Schreibens kundig gewesen sein. Trotzdem sind auch selbst Theologen weithin gegenteiliger Auffassung.
In ihrem Buch „Die Entstehung der Bibel“ vertreten beispielweise die Autoren Konrad Schmid und Jens Schröter, dass Mose vermutlich nur eine historische Figur war. Es hätte zu seiner „mutmaßlichen Lebenszeit“ noch kein Hebräisch gegeben, weil sich die alphabetische Schreibweise zuerst aus dem Phönizischen entwickeln musste und dass also ohne Alphabet die Bibel gar nicht hätte geschrieben werden können. Auch hätte die literaturgeschichtliche Analyse der Thora gezeigt, dass die Texte nicht in das 2., sondern das 1. Jahrtausend v. Chr. gehörten. Sie bezweifeln u. a. auch z. B. die Historizität des Auszugs der Israeliten aus Ägypten oder den Tempelbau unter König Salomo und sagen, dass diese Ereignisse nicht länger als historisch gelten. 8
Der historische Nachweis kann aber schon deshalb nicht gelingen, weil man sich auch archäologisch im falschen Zeitraum befindet. Der Auszug Israels aus Ägypten fand nämlich wie archäologisch und historisch belegt werden kann nicht - wie allgemein angenommen wird - im 12. Jahrhundert, sondern bereits im 15. Jahrhundert v. Chr. statt. Wie gezeigt werden kann, stimmt dieser frühere Zeitpunkt mit den chronologischen Daten der Bibel überein. Da die Bibel außerdem mehrfach bezeugt, dass Mose schreiben konnte, kann er dies nur mit Hilfe eines Alphabets getan haben, weil jede andere - zu dieser Zeit übliche Schreibweise - dies tatsächlich unmöglich gemacht hätte. Daraus ergibt sich die Frage:
Wer hat das Alphabet erfunden?
Unter diesem Titel kommt Betina Hahne-Waldscheck in einem Artikel im factum-Magazin 09/19 auf den Film des Dokumentarfilmers Timothy Mahoney zu sprechen, der sich die Frage stellte:
„Wenn Mose nicht die Thora geschrieben hat, welchen Aussagen der Bibel können wir dann noch vertrauen?“
Deshalb steht in seinem Film „Patterns of Evidence: Die Mose Kontroverse“ die Suche nach dem frühesten Alphabet im Mittelpunkt und die Frage, ob Mose ein solches zur Verfügung gestanden haben muss, um die Thora schreiben zu können. Denn auf der Basis von Hieroglyphen und anderen Schriftzeichen wären dafür nicht vorstellbare kilometerlange Papierrollen gebraucht worden, was nicht funktioniert hätte. Das Vorhandensein eines Alphabets war deshalb von ausschlaggebender Bedeutung.
Bettina Hahne-Waldcheck beschreibt in Ihrem Artikel eine weitere - jetzt persönliche - Bewandtnis, die Mahoney dazu brachte, den Dokumentarfilm zu produzieren, mit folgenden Worten:
„Die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Bibel wurde ihm aus persönlichen Gründen so wichtig, dass er sich ganze 14 Jahre lang auf die Suche nach Belegen machte und bahnbrechende Entdeckungen zutage brachte, die für Christen als Grundlage zur Verteidigung des eigenen Glaubens wichtig sind“ und sagt weiter:
Auf der Thora-Skepsis und der Annahme, dass Mose nicht der Autor der ersten fünf Bücher sein kann, ist die ganze moderne Bibelkritik aufgebaut. Die Bibel bezeugt aber, dass fast alles von Mose aufgeschrieben worden ist. Gott selber gab ihn mehrmals den Auftrag: „Schreibe dies in ein Buch“ (z. B. 2. Mose 17,14). Auch im Text von Johannes 5,46 beruft Jesus sich auf Moses Schriften, wenn er sagte:
„Denn wenn ihr Moses glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben.“
Die Autorin kommt nun darauf zu sprechen, was diese These der Thora-Skepsis erschüttert, nämlich Mose hätte zu seiner Zeit kein Alphabet zur Verfügung haben können. Wie sie nachstehend beschreibt, handelt es sich um zwei bemerkenswerte Funde, die in der Wüste Sinai und in Ägypten gemacht wurden:
„1905 fand der als >>Vater der Archäologie<< bekannt gewordene Flinders Petri Inschriften einer noch unbekannten Schrift und Sprache in einer Mine von Sinai. Flinders Petri hatte bereits die berühmte Israel Stele entdeckt. 1915 gelang dem Ägyptologen Alan Gardiner die Entzifferung dieser neu gefundenen Schrift vom Fundort Serabit el-Khadim, die sich eindeutig von ägyptischen Schriften unterschied. Sie hieß von da an proto-sinaitische Schrift. Eine weitere Schrift dieser Art fand man 1999 in Wadi el-Hol in der Nähe von Theben in Ägypten. Professor Rollston, ist Professor für nordwestsemitische Sprachen an der >>George Washington University<<. Dieser ordnet die Schriften eindeutig als semitische Schrift ein und sagt, dass es Semiten waren, die das Alphabet erfunden haben. und nicht die Phönizier, wie oft in den Schulbüchern steht.“
Dies steht im völligen Gegensatz zu der Aussage der Autoren Konrad Schmid und Jens Schröter, die sagten, dass erwiesen sei, dass sich die Alphabetschrift zuerst aus dem Phönizischen entwickelt habe. Dieser Meinung liegt auch zugrunde, dass die Mainstream-Wissenschaft annimmt, dass der Exodus zur Zeit des Pharao Ramses II im 13. Jahrhundert v. Chr. stattfand. Dann lässt sich tatsächlich eine Verbindung zum Volk Israel nicht herstellen, obwohl man sich dabei auf die Bibel beruft.