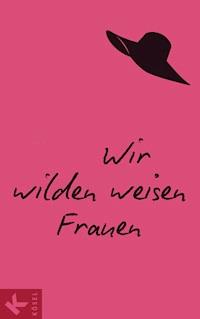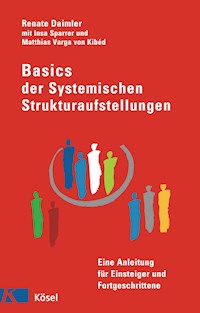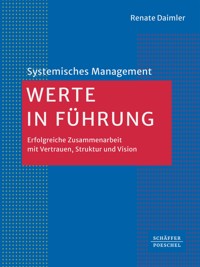
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Systemisches Management
- Sprache: Deutsch
Die Konfliktforschung zeigt, dass unklare Anweisungen, Arbeitsabläufe, Schnittstellen, Strukturen, mangelnde Kommunikation und Wertschätzung in Organisationen versteckte Kosten verursachen. Wertschätzende Führung basiert auf dem Wertedreieck, in dem klare Visionen und Aufgaben, Vertrauen und Wertschätzung sowie sinnvolle Strukturen, einen sicheren Rahmen bieten. Wenn Führungskräfte und Mitarbeitende sich im "Raum der Werte" bewegen, wird eine positive Unternehmenskultur und damit eine erfolgreiche Zusammenarbeit gefördert. Das Buch bietet wertvolle Erkenntnisse und praxisnahe Ansätze zur Verbesserung der Unternehmenskultur und der Zusammenarbeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtImpressumVorwort1 Werte in Führung2 Die Systemischen Grundsätze im Unternehmensalltag2.1 Einführung2.2 Wir stellen uns ehrlich den TatsachenDer Systemische Grundsatz in Aktion2.3 Wir klären, wer dazu gehörtDer Systemische Grundsatz in Aktion2.4 Wir schätzen Erfahrung durch langjährige ZugehörigkeitDer Systemische Grundsatz in Aktion2.5 Wir unterstützen neue Systemmitglieder oder SystemelementeDer Systemische Grundsatz in Aktion2.6 Wir leben Hierarchien klar und wertschätzend und würdigen höhere LeistungenDer Systemische Grundsatz in Aktion2.7 Wir fördern die Begabungen und die Fähigkeiten unserer MitarbeiterInnenDer Systemische Grundsatz in Aktion2.8 Wir engagieren uns für eine gute Balance zwischen Geben und NehmenDer Systemische Grundsatz in Aktion3 Was sind Systemische Strukturaufstellungen?3.1 Was ist repräsentierende Wahrnehmung?3.2 Wissenschaftlicher Nachweis4 Das Wertedreieck als schützender Rahmen4.1 Einführung4.2 Gebrauchsanweisung für das Wertedreieck4.3 Die drei Qualitäten des Wertedreiecks im Detail4.4 Die persönliche Eintrittspforte ins Wertedreieck4.5 Ein Team, gut aufgehoben im Wertedreieck, ein Beispiel4.6 Das Wertedreieck spart Konfliktkosten4.7 Den Raum der Werte im Unternehmen nachhaltig etablieren4.8 Den Raum der Werte im eigenen Inneren etablieren5 Sicheres Wachstum im Wertedreieck5.1 Einführung 5.2 Die Pionierphase5.3 Die Differenzierungsphase5.4 Die Integrationsphase5.5 Die Assoziationsphase6 Sprache verbindet oder trennt – wertschätzende Kommunikation6.1 Einführung6.2 Das Wertedreieck dient der psychologischen Sicherheit6.3 Wer spricht wann mit wem? – Systemische Grundsätze in der Kommunikation6.4 Kommunikation im Konfliktfall6.5 Von der Sprache als Minenfeld zur geglückten Kommunikation6.6 Wertschätzende Sprache ist »das Herz gesellschaftlicher Veränderung«6.7 Die vier Schritte der wertschätzenden Kommunikation6.7.1 Fallen für eine geglückte Kommunikation6.7.2 Sprache braucht ein »Echtheitszertifikat«6.8 Wir fördern mit wertschätzender Sprache unsere emotionale Kompetenz6.9 Unser Gehirn braucht ein neues Programm7 Die Familie am Konferenztisch – Überzeugungssysteme und Glaubenssätze7.1 Einführung7.2 Wie unsere Glaubenssätze entstanden sind7.3 Glaubenssätze und ihre Wirkung7.4 Glaubenssätze in Aktion7.4.1 Lebensthema: Sicherheit und VertrauenMartinLisaAndreas7.4.2 Lebensthema: Versorgung, Abhängigkeit IMathilde7.4.3 Lebensthema: Versorgung, Abhängigkeit IIBerndt7.4.4 Lebensthema: FreiheitViola7.4.5 Lebensthema: Echtheit, Authentizität IGerhard7.4.6 Lebensthema: Echtheit, Authentizität IICharlotte7.4.7 Lebensthema: Wert IAnton7.4.8 Lebensthema: Wert IIRita7.5 Unseren automatischen Reaktionen auf der Spur7.6 Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung und Selbstfürsorge8 Destruktive Konflikte sind teuer8.1 Einführung8.2 Konfliktkostenkategorien8.3 Ein Veränderungsprozess als Lernfeld8.3.1 Der Veränderungsprozess im Wertedreieck8.3.2 Die Einordnung des Veränderungsprozesses in die Systemischen Grundsätze8.4 Die Konfliktkostenkategorien im Detail8.4.1 Dimension Person8.4.2 Dimension Team8.4.3 Dimension Organisation8.5 Konflikte können auch sinnvoll sein9 Von der Welt der Probleme in die Welt der Lösungen9.1 Einführung9.2 Ein kleiner Leitfaden für lösungsfokussierte Gespräche9.3 Die Arbeit mit Unterschieden9.4 Die Qualität des Wunders ins Unternehmen einladen9.5 Die Wunderfrage9.6 Der Unterschied zwischen Ziel und Wunder9.7 »Softversionen« für Unternehmen, die Lösungen lieben10 »Know-how« und »Know-why« sind Geschwister11 Innehalten ist gut investierte Zeit12 Wozu brauchen Führungskräfte Wissen über Hirnforschung?Eine Verbeugung vor meinen Lehrerinnen und LehrernDanke Euch allenÜber die AutorinBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Reihe Systemisches Management
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-6197-9
Bestell-Nr. 12044-0001
ePub:
ISBN 978-3-7910-6198-6
Bestell-Nr. 12044-0100
ePDF:
ISBN 978-3-7910-6199-3
Bestell-Nr. 12044-0150
Renate Daimler
Werte in Führung
1. Auflage, November 2024
© 2024 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
Reinsburgstr. 27, 70178 Stuttgart
www.schaeffer-poeschel.de | [email protected]
Bildnachweis (Cover): © Stoffers Grafik-Design, Leipzig
Produktmanagement: Dr. Frank Baumgärtner
Grafik: Renate Daimler/Birgitta Auerswald
Lektorat: Ulrike Buergel-Goodwin, München
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Ein Unternehmen der Haufe Group SE
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Vorwort
Wir alle wollen glücklich sein. Das ändert sich auch dann nicht, wenn wir unseren Arbeitsplatz betreten, an dem viele von uns mehr Zeit verbringen als mit ihren Familien oder Freunden. Und unabhängig davon, ob wir EigentümerInnen, Führungskräfte, MitarbeiterInnen auf unterschiedlichen Hierarchieebenen oder deren BeraterInnen sind, nicht immer glückt es uns, mit einem Lächeln am Abend nach Hause zu gehen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Einer der häufigsten jedoch ist die Tatsache, dass wir unsere Gefühle nicht zu Hause lassen können und unser Inneres sensibel auf die Bedingungen reagiert, die wir vorfinden und manchmal auch selbst erschaffen.
Jedes einzelne Kapitel dieses Buches ist eine Einladung für einen leichteres, freudvolleres Arbeitsleben und ist, in vielen Bereichen, auch im Privatleben hilfreich. »Das Wertedreieck« und die »Systemischen Grundsätze« sind eine gute Grundlage für weise Entscheidungen und eine verlässliche Landkarte, mit der wir jede einzelne unserer Handlungen auf Sinnhaftigkeit überprüfen können.
Eine wertschätzende Kommunikation, die auf ein »Miteinander« und nicht auf ein »Gegeneinander« ausgerichtet ist, ist das Kernstück jeder guten Unternehmenskultur, fördert unsere Gesundheit und verhindert Konfliktkosten.
Und dann geht es auch noch, wenn wir ein gutes Leben haben wollen, um unser Innenleben, unsere Überzeugungssysteme und Glaubenssätze, die wir aus unserer Kindheit mitgebracht haben und die meist unbewusst mit uns am Konferenztisch sitzen. Wenn wir sie erkennen und regulieren können, werden sie zu kostbaren Ressourcen und zu unserem stärksten Potenzial.
Damit in unserem Alltag vielleicht auch die Qualität »Glück« einen guten Platz hat, lohnt es sich, unser Gehirn, das Probleme besser erkennt als Lösungen, so zu trainieren, dass es möglichst viele »Ausnahmen zum Problem« finden kann. Dann betonen wir das, was gut ist und was so bleiben soll oder sich noch entwickeln darf, und lassen den Schwierigkeiten, die es im Unternehmen unweigerlich immer wieder gibt, weniger Raum.
Inzwischen hat die Wissenschaft nachgewiesen, dass unser Bewusstsein ein mächtiger Faktor in unserem Leben ist. Wir erschaffen mit der Kraft unserer Gedanken Wirklichkeit, und ob wir einen guten Tag haben werden, hängt auch damit zusammen, wie wir unser »Mindset« ausrichten und was wir in die Welt hinaussenden. Wenn wir immer wieder einmal innehalten und uns Zeit für Reflektion nehmen, dann schenken wir unserem guten Leben im Unternehmen die gebührende Aufmerksamkeit.
Für mich ist es nun an der Zeit meine Schatzkiste zu teilen, die ich in meinem langen eigenen Arbeitsleben mit Kostbarkeiten gefüllt habe. Ich lade Sie herzlich dazu ein, sich daraus zu nehmen, was Ihnen gefällt und es zu Ihrem Eigenen zu machen. Möge mein »Handbuch für eine leichtere, freudvolle Zusammenarbeit« Sie dabei unterstützen, mit einem Lächeln in Ihre Arbeit und mit einem Lächeln wieder nach Hause zu gehen.
Und falls Ihr Unternehmen sich grundsätzlich dafür nicht eignet, gehen Sie woanders hin.
Die Autorin im November 2024
1 Werte in Führung
Wenn Sie über diese Überschrift gestolpert sind, dann ist das gut so. Denn in meinem Buch geht es nicht um »Werte in der Führung«, sondern darum, dass es hilfreich ist, wenn wir uns bei allen Handlungen von übergeordneten Werten führen lassen. Sie geben uns Orientierung und machen unser (Arbeits-)Leben leichter und erfüllter. Sie haben das Potenzial, in Ihrem Unternehmen eine freudvolle Veränderung auszulösen, wenn es genug Menschen gibt, die bereit sind, Ihnen zu folgen. Doch selbst, wenn nur Sie allein als Leuchtturm an Ihrem Arbeitsplatz stehen, macht das Sinn.
Bevor Sie sich jetzt tiefer einlassen, möchte ich Sie einladen, sich symbolisch auf einen Sessel in die Mitte des Wertedreiecks zu setzen. Oder, wenn Sie eine Frau oder ein Mann der praktischen Tat sind, sich tatsächlich so ein Dreieck mit Vision, Vertrauen und Struktur mit beschrifteten Zetteln in Ihrem Büro oder auch gerne in Ihrem Wohnzimmer auf den Boden zu legen und darin gemütlich Platz zu nehmen.
Jetzt sind Sie umgeben von einem sicheren Rahmen und können, wenn alle drei Werte für Sie in Ihrem (Arbeits-)Leben wirksam sein dürfen, sicher sein, dass Sie das Beste aus jeder Situation machen können, unabhängig davon, wie die Geschichte ausgeht. Denn natürlich haben wir nicht alles in der Hand, was geschieht. Doch wir können uns immer entscheiden, wie wir mit dem, was geschieht, umgehen.
In unserem Leben wimmelt es nur so von Werten, doch nicht alle davon sind gute Ratgeber. Es kann sogar sein, dass besonders jene, die in unserem Inneren zu Hause sind, uns ganz schön zu schaffen machen, weil manche von ihnen gar nicht wahr sind. Ich bin sicher, dass Sie zum Beispiel lieber wertvoll sind, ohne etwas dafür leisten zu müssen, oder dass Sie gerne geschätzt werden möchten, ohne sich dabei selbst zu vergessen (siehe Kapitel 7).
Daher ist das Wort »übergeordnete« Werte hier von Bedeutung. Einen Wert, der übergeordnet ist, erkennen Sie daran, dass er wie eine Quelle unerschöpflich fließt. Sie können davon nehmen, ohne dass er weniger wird. Er braucht nichts von Ihnen, außer, dass Sie ihn erkennen.
Und das ist schwierig genug, denn manche der Werte sind von unserer persönlichen Biografie »verstellt«. Wir haben keinen klaren Blick auf sie, weil z. B. die Ordnung, hier Struktur genannt, in unserer Kindheit etwas Leidvolles war. Oder vielleicht sind Sie misstrauisch, wenn es um Vertrauen geht, weil Sie es nie wirklich kennengelernt haben. Vielleicht sind Ihnen Visionen suspekt, weil Sie gelernt haben, dass man »kleine Brötchen« backen muss.
Falls Sie jetzt, tatsächlich oder imaginär, in der Mitte des Wertedreiecks auf einem Sessel sitzen, möchte ich Sie zu einem kleinen Forschungsprojekt einladen und Ihnen ein paar Fragen stellen. (Wenn Sie keine Lust dazu haben, bitte überblättern Sie diesen Teil einfach, ich möchte Sie keinesfalls gegen mich und mein Buch aufbringen.)
Sind Ihnen alle drei Werte sympathisch? Oder haben Sie gegen einen oder mehrere Vorbehalte?
Falls Sie einen der drei Werte nicht besonders mögen oder ihn nicht für wichtig halten, welche Geschichte aus Ihrer Kindheit passt dazu?
Wenn Sie ganz schnell, z. B. in einer Krise, handeln müssen, durch welche Pforte treten Sie ins Wertedreieck ein? Suchen Sie zuerst eine strategische Lösung? Finden Sie zuerst Verbündete und kümmern sich um Vertrauen? Oder ist Ihre Spezialität in diesem Moment, das große Bild im Auge zu behalten, damit die Vision nicht verlorengeht? Üblicherweise haben wir mindestens eine Qualität, in der wir besonders gut sind und mit der wir, besonders in schwierigen Situationen, uns selbst und dem Unternehmen am besten dienen können.
Prüfen Sie, ob in Ihrer Vorstellung eine der drei Qualitäten »besser ist« als die anderen. Es könnte sein, dass Sie dann vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die eine andere »Eintrittspforte« ins Wertedreieck als Sie haben, abwerten. (Die denkt doch immer nur strategisch, der ist doch viel zu emotional, von diesen Visionen können wir uns auch nichts kaufen etc.) Die Gleichwertigkeit der drei Qualitäten garantiert Ihnen, dass das Wertedreieck intakt bleibt. Denn ohne gute Strukturen schwindet Vertrauen, und ohne diese beiden können Visionen oder Ziele schlecht erreicht werden.
Spätestens wenn Sie am Ende dieses Buches angelangt sind, werden Sie hoffentlich alle drei Qualitäten schätzen, weil ein gutes Leben nur mit dem gesamten Trio möglich ist. Und das betrifft alle Bereiche Ihres (Arbeits-)Lebens. Ein stabiles Wertedreieck, das Sie schützt und zur gleichen Zeit beflügelt, ist das Ziel aller folgenden Kapitel.
2 Die Systemischen Grundsätze im Unternehmensalltag
2.1 Einführung
Wenn Sie mich fragen: »Was sollten Sie in Ihrem Leben immer griffbereit haben«, dann fällt mir die Antwort leicht: »Die Systemischen Grundsätze und das Wertedreieck«. Am besten wäre es, wenn die beiden einen guten Platz in Ihrem Gedächtnis hätten, wo sie in Sekundenschnelle abrufbar sind. Sie können Ihnen Sicherheit in allen Lebenslagen geben und unterstützen Sie dabei, weise Entscheidungen zu treffen.
Ich ziehe sie immer zu Rate, wenn es etwas zu klären oder zu entwickeln gibt. Sie haben ihre Nützlichkeit in den vielen Jahren, die sie nun schon meine Begleiter sind, unzählige Male bewiesen und sind das Fundament meiner systemischen Arbeit – für jede Art von Fragestellung. Meinen Zugang zu den Systemischen Grundsätzen und dem Wertedreieck verdanke ich Insa Sparrer und Matthias Varga von Kibéd. Im Rahmen unseres gemeinsamen Buches »Basics der Systemischen Strukturaufstellungen« habe ich diese »Werte in Führung« mit Begeisterung vertieft und für meine Arbeit in Organisationen im Lauf der Jahre vereinfacht und weiterentwickelt. (Daimler, Sparrer, Varga von Kibéd, 2024).
Unzähligen Menschen, die ich beraten oder ausbilden durfte, ist dieses Fundament zu einem wichtigen Werkzeug geworden. Und immer noch entdecke ich neue Facetten und Feinheiten. Ein Leben reicht nicht aus, um den großen Schatz zu heben, den uns diese Sicht auf die Welt ermöglicht. Und ich bin zuversichtlich, dass Sie Ihre eigenen kostbaren Entdeckungen machen werden.
Wer sind sie, diese beiden »Tools« – die Systemischen Grundsätze und das Wertedreieck –, die mehr eine Haltung sind als nur ein Handwerkszeug?
Ich beleuchte die Systemischen Grundsätze zuerst, weil das Wertedreieck ohne sie nicht existieren könnte. Wir brauchen sie, damit Vertrauen entsteht und/oder bleibt, wir finden in ihnen die Begründung, warum gute Strukturen sinnvoll sind, sie helfen uns, den Weg zu unseren Visionen leichter zu gehen.
Wie sind die Systemischen Grundsätze entstanden?
Niemand hat sie erfunden. Sie sind über viele Jahrzehnte aus systemtheoretischen Überlegungen und den Erfahrungen von BeraterInnen, dass jede Handlung in einem System andere Elemente des Systems beeinflusst, entstanden. In Deutschland war es zum Beispiel Thea Louise Schönfelder, eine Psychiaterin, die als erste Frau einen Lehrstuhl für Kinder – und Jugendpsychiatrie innehatte und Pionierarbeit leistete. Auch Les Kadis und Ruth McClendon gehörten zu den Pionierinnen. Bert Hellinger war einer ihrer Schüler und wurde mit seinen »Ordnungen der Liebe« bekannt, die durch ihren dogmatischen Charakter auch starke Kritik auslösten. Die kalifornische Psychotherapeutin Virginia Satir zeigte eindrücklich auf, wie sehr das Familiensystem die Gesundheit ihrer KlientInnen beeinflusste und publizierte dazu. Eine wichtige Rolle spielt auch der Ansatz von Ivan Boszormenyi-Nagy, auf den einerseits die Idee der Wichtigkeit generationsübergreifender Muster und andererseits die Betonung des Ausgleichs zwischen Geben und Nehmen zurückgeht. Gunthart Weber, Fritz Simon und Gunter Schmidt von der »Heidelberger Schule« haben, so wie die ÖsterreicherInnen Siegfried Essen, Guni Baxa und Christine Essen, ebenfalls wertvolle Entwicklungsarbeit geleistet. Insa Sparrer und Matthias Varga von Kibéd haben die Systemischen Grundsätze weiterentwickelt und ihre konstruktivistische Haltung eingebracht. Es waren also viele die einen Einfluss auf die Entwicklung dieses Fundaments hatten. (Daimler, Sparrer, Varga von Kibéd, 2024, S. 25, und ÖfS Österreichisches forum Systemaufstellungen, 2024)
Anfänglich wurde die Beobachtung, dass aus der Dynamik in Systemen Muster erkennbar waren, die sich wiederholten, nur für Familien angewendet. Später haben immer mehr systemische Schulen erkannt, dass sich viele der Systemischen Grundsätze auf Organisationen übertragen lassen. Erfahrungen aus dem Unternehmensalltag, die sich häufig wiederholen, zeigen auf, dass es sinnvolle Haltungen und Handlungen gibt, die ungünstige Dynamiken verhindern oder unterbrechen können. Zur gleichen Zeit sind die Systemischen Grundsätze keinesfalls dogmatisch zu verstehen, sondern auf Heilung ausgerichtet: »Wenn wir uns darauf einigen können, dass es eine Vielfalt von Facetten dieser Grundsätze gibt, die in ihrer Komplexität hier nicht erfasst werden können, dann macht diese Aufzählung Sinn.« (Varga von Kibéd in: Daimler, Sparrer, von Kibéd, 2024, S. 39)
Wozu brauchen wir die Systemischen Grundsätze im Unternehmen?
Die Systemischen Grundsätze dienen dem Erfolg des Unternehmens, weil sie ein Garant für ein besseres Miteinander sind und Sie dabei unterstützen, Reibungsverluste im Unternehmensalltag in Grenzen zu halten. Speziell dann, wenn kleinere oder größere Veränderungen anstehen, kann die Beachtung dieser Basics unerwünschte Nebenerscheinungen verhindern oder zumindest abschwächen – wie geringere Bindung an das Unternehmen der MitarbeiterInnen, höhere Kündigungsabsichten, verringerte Arbeitszufriedenheit, negative Wahrnehmung der Vertrauenswürdigkeit der Organisation und die Zunahme von Resignation bei gleichzeitiger Abnahme des Engagements. Gemeinsam mit dem Wertedreieck sind sie ein verlässlicher Kompass, der Sie dabei unterstützt auf einem guten Weg zu bleiben.
Die folgenden Inhalte sind von mir durch einige Vereinfachungen und Erweiterungen für Organisationen adaptiert worden und sinngemäß unserem Grundlagenbuch entnommen (Daimler, Sparrer, Varga von Kibéd, 2024, S. 39 – 61).
Die systemischen Orientierungen im Überblick
Eine Organisation sollte sich bewusst sein, dass klare Orientierungen von Bedeutung sind und ihre Handlungen entsprechend ausrichten:
Existenzsicherung. Für die meisten Organisationen ist die Sicherung der eigenen Existenz wesentlich. Dazu brauchen sie Grenzen, die ganz klar festlegen, wer dazugehört. Systemmitglieder haben zwar kein lebenslanges Recht auf Zugehörigkeit wie in Familien, wenn sie jedoch unrechtmäßig gekündigt oder hinausgemobbt werden, schadet das der Organisation.
Wachstumsorientierung. Wenn die Möglichkeit des Wachstums für eine Organisation wesentlich ist, dann ist die Herstellung guter Bedingungen dafür essenziell. Dazu gehört, dass nicht nur die Grenzen des Systems klar sein müssen, sondern auch, dass eine Art Vorrang derer, die früher da waren, abgesichert sein sollte. Nach dem Motto: Wir bleiben hier für immer die ersten, auch wenn wir von fünf auf hundert MitarbeiterInnen gewachsen sind. Das ist nicht nur für Organisationen, sondern auch für andere Systeme von Bedeutung. Bei einem neuen Logo könnte es zum Beispiel wichtig sein, dass alte Teile des Logos, die übernommen werden, wenn das Logo wächst, als »die älteren Teile des Systems« gewürdigt werden. Selbst Funktionen können sich beleidigt zeigen, wenn vergessen wird, dass sie schon länger existieren als andere. Grundsätzlich sind Wertschätzung und Würdigung von langjähriger Zugehörigkeit wichtig für alle Arten von Systemen. Bei MitarbeiterInnen fördern sie Verbundenheit und Loyalität.
Allerdings gibt es auch Systeme, die nicht mehr wachsen können. Zum Beispiel bleiben GründerInnen unter sich, weil niemand später dazukommen kann. Die Gruppe bleibt auf jene beschränkt, die ursprünglich dabei waren und denen die Organisation ihre Existenz verdankt. Auch das gemeinsame Überleben von Katastrophen führt zu einer Art Gemeinschaft, die nicht mehr wachsen kann, wie z. B.: »Wir waren die, die den Brand der Geschäftsräume gelöscht und überlebt haben.«
Fortpflanzungsorientierung. Wenn es für eine Organisation wesentlich ist, dass sie sich fortpflanzen kann, das heißt, dass sich neue Systeme ähnlicher Art aus dem ursprünglichen bilden können, zum Beispiel Tochtergesellschaften, so sollten nicht nur die Systemgrenzen gut geklärt sein. Es sollten auch Bedingungen geschaffen werden, die solche Neubildungen fördern. Dazu gehört, dass das junge System für die Dauer seiner Grenzbildung besonders geschützt wird. Ein Konzern, der eine Tochtergesellschaft ins Leben ruft, sollte auf der einen Seite die Grenzen des neuen Systems respektieren und ihm genug Raum für Entwicklung geben, auf der anderen Seite sollte er ihm vorübergehend mehr Ressourcen zur Verfügung stellen als den zum Beispiel schon vorhandenen älteren Tochtergesellschaften. Dieser Prozess der »Bevorzugung auf Zeit«, muss, wenn das junge System sich etabliert hat, wieder rückgängig gemacht werden, weil sonst die älteren Systeme benachteiligt werden.
Orientierung auf Immunkraftbildung. Auf längere Zeit überlebensfähige Systeme entwickeln üblicherweise Handlungsabläufe und Funktionen, die als eine Art Immunsystem angesehen werden können. Es ist dann für die langfristige Überlebensfähigkeit wichtig, die Immunkraft weiter zu stärken, damit es sich im Notfall gegen Angriffe von außen verteidigen kann. Insa Sparrer schreibt dazu: »In menschlichen Systemen entspricht die Immunkraft der Kommunikationsfähigkeit, der Übernahme von Verantwortung und der Einsatzbereitschaft. Je besser die Mitglieder eines Systems miteinander kommunizieren können, umso schneller kann neue Information verarbeitet und verbreitet werden. Je höher die Einsatz-bereitschaft der Mitglieder ist, umso eher gelingt es, Krisenzeiten zu überstehen.« (ebd., S. 42)
Orientierung auf Individuation. Die Anerkennung und Förderung der individuellen Fähigkeiten der einzelnen Mitglieder einer Organisation ist dann wichtig, wenn ein System sich weiterentwickeln und lernen möchte. Wenn MitarbeiterInnen ihren Fähigkeiten entsprechend eingesetzt werden und kreative Prozesse und Spezialisierungen möglich gemacht werden, stärkt das die Organisation. Ihr Einsatz sollte auch dann gewürdigt werden, wenn z. B. das Projekt nicht sofort erfolgreich war.
Die Berücksichtigung der Reihenfolge ist hilfreich im Sinn einer Priorität von Schritten. Sie stellt keine Wertung der Wichtigkeit dieser Themen für ein System dar.
Die Systemischen Grundsätze im Überblick
Wir stellen uns ehrlich den Tatsachen:
Prinzip der Nichtleugnung – übergeordnet über alle folgenden Grundsätze
Wir klären, wer dazu gehört (zum Unternehmen, zum Team): Recht auf Zugehörigkeit – sichert die Grenzen des Systems
Wir schätzen Erfahrung durch lange Zugehörigkeit: Anerkennung der zeitlichen Reihenfolge – sichert Möglichkeit des Wachstums
Wir unterstützen neue Systemmitglieder oder Systemelemente: Das Prinzip der vorübergehenden Umkehr der zeitlichen Reihenfolge ermöglicht Fortpflanzung
Wir leben Hierarchien im Unternehmen klar und wertschätzend und würdigen höhere Leistungen: Anerkennung des höheren Einsatzes – stärkt die Immunkraftbildung
Wir fördern Fähigkeiten und Potenziale von MitarbeiterInnen: Der Vorrang von höheren Leistungen und Fähigkeiten – fördert die Konkurrenzfähigkeit
Wir engagieren uns für die Balance zwischen Geben und Nehmen: Systemische Ausgleichsprinzipien – sorgen für Balance im System
2.2 Wir stellen uns ehrlich den Tatsachen
(Das Prinzip der Nichtleugnung von Gegebenheiten)
Hier geht es in der Organisation um eine Haltung, die für alle folgenden Grundsätze wichtig ist. Dieses Prinzip ist so etwaswie ein Dach über allen Grundsätzen und den anderen übergeordnet.
Alles, was einen Einfluss auf das System hat, sollte berücksichtigt und nicht »unter den Tisch gekehrt« werden. Transparenz ist essenziell, Offenheit im Umgang mit Schwierigkeiten vertrauensstärkend. Das, was in einem Unternehmen trotz Relevanz nicht angesprochen wird, findet meist informelle Wege, um dennoch an die Oberfläche zu gelangen, wie z. B. dunkle Kapitel in der Geschichte des Unternehmens, wie die nicht Würdigung von Gründern und Gründerinnen, das langfristige Verschweigen von Schwierigkeiten, wie z. B. eine schlechte Geschäftslage, die zu Kündigungen führen wird, usw.
Besonders in Zeiten der Veränderung sollten wir uns immer die Frage stellen: Was bedeutet eine Handlung für das Gesamte, die MitarbeiterInnen, die Projekte, die KundInnen etc.? Das Bewusstsein, dass es dabei nicht nur um Systemmitglieder, sondern auch Systemelemente, wie z. B. Werte, geht, hilft uns, durch Achtsamkeit das Unternehmen stabil zu halten. Verdrängung oder Missachtung von Gegebenheiten führt häufig langfristig zu Schwierigkeiten. Wenn Neues Erfolg haben soll, braucht es zunächst die Anerkennung des Ausgangszustands, sonst können später Widerstände aufgrund übersehener Tatsachen auftreten.
Eine Analyse, die nicht nur Gewinne und Verluste berücksichtigt, sondern auch systemische Faktoren, fragt immer auch: Was bedeutet eine Entscheidung, eine Strategie usw. für das Gesamte? Lange Phasen der Unsicherheit bei Veränderungsprozessen und mangelnde Information lassen das Engagement der MitarbeiterInnen drastisch sinken. Alles, was wir zu leugnen versuchen, weil es unangenehm ist, schafft durch die unterbrochene Verbindung – weil das Ungesagte »dazwischen« steht – Distanz zwischen den Menschen im Unternehmen.
Zusätzlich füllt jeder Einzelne automatisch Lücken in der Kommunikation/Information mit Vermutungen. Dadurch entstehen meistens Gerüchte, die den realen Tatsachen selten entsprechen.
Der Systemische Grundsatz in Aktion
Eine Gründerin geht verloren
»Es ist, als ob ein Schatten auf meinem Geschäft läge«, sagt meine Kundin, die eine Maßschneiderei mit drei Filialen in unterschiedlichen österreichischen Bundesländern besitzt. Der »Schatten«, von dem sie spricht, betrifft ihr Stammhaus in der Steiermark, in dem es immer wieder einen Wechsel bei der Führungskraft der Schneiderei gibt. Entweder stellt sie jemanden ein, der sich später als unfähig erweist, oder »die Neue wird von den Altgedienten nicht akzeptiert, so als ob sie ein Fremdkörper wäre, an dem etwas nicht passt«.
Eine Systemanalyse zeigt weder einen grundsätzlichen Widerstand des Personals noch andere Probleme. »Unser Betriebsklima ist sehr gut«, sagt die Eigentümerin.
Also tauchen wir in die Geschichte des Unternehmens ein. Das ist immer dann der Fall, wenn sich an der Oberfläche nichts finden lässt, was ein System in Schwierigkeit bringen könnte.
Die Fragen sind dann immer die gleichen:
Wer hat die Schneiderei gegründet, war es eine Person oder mehrere?
Ist jemand im Unfrieden ausgetreten oder wurde hinausgemobbt?
Sind wichtige Werte nicht beachtet worden oder verlorengegangen?
Gibt es eine Person in der Vergangenheit, mit einem Recht auf Zugehörigkeit zum Unternehmen, die vergessen oder nicht gewürdigt wurde?
»Es war mein Vater, der die Schneiderei gegründet hat«, sagt Marlene Deutsch ohne irgendeinen Zweifel in der Stimme. »Er hat ein winziges Lokal im Tiefparterre eines Hauses gemietet und angefangen, Textilien zu reparieren. Nach einiger Zeit hatte er sich so einen guten Namen gemacht, dass seine Kundinnen sich auch neue Kleidung schneidern ließen. Er übersiedelte in eine bessere Gegend, und als er starb, hat er mir ein blühendes Geschäft hinterlassen.«
Wenn eine Systemanalyse zu keinem Ergebnis kommt, beginnen wir nach »Unsichtbarem« zu suchen, meistens mit Unterstützung einer Strukturaufstellung (siehe Kapitel 3).
Im Bild sehen wir den Vater von Marlene, ihm gegenüber steht die Schneiderwerkstatt von damals. Der Repräsentant, der ihn darstellt, wendet seinen Blick ab und sagt: »Ich kann nicht hinschauen, es ist so traurig, damit will ich nichts zu tun haben.«
Die Schneiderwerkstatt dreht und wendet sich kokett und sagt: »Du siehst mich gar nicht, ich bin sooo schön.«
Als wir die Figur, das, »was den Vater traurig macht«, ins Bild stellen, fängt der Repräsentant des Vaters an zu weinen und sagt: »Ich vermisse dich so sehr, wir wollten das doch alles gemeinsam machen.«
Marlene Deutsch sitzt am Rand des Bildes und springt plötzlich auf: »Jetzt weiß ich, was passiert ist. Meine Mutter hat mir nach dem Tod meines Vaters erzählt, dass sie nur seine zweite Wahl war. Sie sagte es nicht böse oder traurig, es war einfach so. Und weil mein Vater auch nicht ihre erste Wahl war, sie mussten heiraten, weil ich unterwegs war, sind sie gut miteinander ausgekommen und haben sich respektiert. Doch in seinem Herzen hatte er wahrscheinlich ein Loch, das nie geheilt ist.«
Marlene besuchte ihre Mutter und erfuhr die ganze Geschichte, die beide Eltern vor ihr geheim gehalten hatten.
Marlenes Vater hatte gemeinsam mit seiner ersten großen Liebe die kleine Schneiderei gegründet. Sie kannten einander seit dem Kindergarten und waren unzertrennlich. Es war im April 1945, und der Krieg war eigentlich schon zu Ende. Sie wollten im Mai heiraten, und Marlenes Vater hatte seiner zukünftigen Frau ein bodenlanges, weißes Kleid aus einem Vorhang geschneidert. Da wurde das Haus, in dem sie lebte, am letzten Kriegstag bombardiert und seine Braut und Geschäftspartnerin starb in den Trümmern. Den Namen der Frau kannte die Mutter nicht oder hatte ihn verdrängt.
Marlene ging auf die Suche. Sie fand in den alten Fotoalben ein Bild ihres Vaters mit einer jungen Frau an seiner Seite. Die beiden saßen vor zwei Nähmaschinen und lächelten in die Kamera. Auf der Rückseite stand: »Josef und Bernadette am Eröffnungstag.« Das Foto hängt inzwischen vergrößert in jeder der Filialen, und wer jetzt auf die Webseite des renommierten Unternehmens geht, findet das junge Paar von damals als Gründer und Gründerin.
Und noch etwas hat sich im Unternehmen geändert. Marlene fand ein eigenes Thema in der Geschichte: »Ich bin jetzt 69 Jahre alt. Mein Mann arbeitet seit mehr als 40 Jahren im Unternehmen mit und hat es mit mir gemeinsam groß gemacht. Und trotzdem ist er nach wie vor der Mann der Chefin, und es ist noch immer mein Geschäft. Ich habe ihm bis heute seinen Platz, den er verdient, nicht gegeben, und er ist zu bescheiden, als dass er ihn eingefordert hätte. Ich habe auf andere Weise ein Stück der Geschichte wiederholt. Auch das werde ich ändern. Und unsere beiden Kinder, die das Unternehmen in einiger Zeit übernehmen werden, sollen all das wissen und würdigen. Das ist mir wichtig!«
Ein Unternehmen, das mit drei Beinen hinkt, und ein Loyalitätskonflikt
Martin ist ein Kollege, den ich bei einem internationalen Austausch kennengelernt habe und den ich zu einem beruflichen Thema beraten habe. Im Vorgespräch zu einer Strukturaufstellung erzählt er: »Wir waren vier BeraterInnen und zur gleichen Zeit Ehepaare und haben uns auf einem systemischen Kongress in Berlin kennengelernt. Es hat sofort zwischen uns gefunkt. Wir haben die gleiche, lösungsorientierte Haltung geteilt, wir sind in und für Unternehmen tätig. Und nachdem wir alle rund um Berlin leben, haben wir uns wiedergesehen und sind Freunde geworden. Es war meine Idee, ein gemeinsames Unternehmen zu gründen. Wenn wir unsere Energie bündeln, habe ich damals gesagt, dann können wir ein unschlagbares Beratungsteam sein. In dieser Aufbruchsstimmung haben wir unseren Namen ›Change-Option‹ gefunden und gemeinsam eine GmbH gegründet. In den ersten Jahren lief alles gut, doch dann ist Otto plötzlich gegangen, ohne mit uns vorher zu reden. Er war plötzlich an anderen Themen interessiert und hat sich mit anderen Partnern verbunden. Seine Frau Sybille, meine Frau Hanna und ich, haben dann zu dritt weitergemacht und uns gegenseitig versichert, dass alles in Ordnung ist zwischen uns. Doch irgendwie war die Luft dann draußen, und heute müssen wir uns eingestehen, dass wir nicht mehr so erfolgreich sind wie damals, als wir zu viert waren. Die Geschichte mit Otto hat uns viel Kraft gekostet, und ich muss jetzt klären, wie es für mich, für uns, weitergehen kann.«
In der Strukturaufstellung (siehe Kapitel 3) schauen wir uns die jetzige Konstellation in »Change-Option« mit den verbliebenen drei GesellschafterInnen an.
Schon das erste Bild zeigt, dass das Unternehmen so nicht funktionieren kann. Martin steht eng neben seiner Gesellschafterin Hanna, die zur gleichen Zeit seine Frau ist. In einem Abstand, der so groß ist, dass eine starke Lücke entsteht, sehen wir Sybille, die als erste Wortmeldung sagt: »Mich zerreißt es fast. Ich möchte so gerne näherkommen, aber ich kann nicht.«
Ich frage Martin, ob er und seine Frau noch mit dem Paar befreundet sind. »Mit Sybille schon, mit Otto gibt es seit seinem unfairen Ausstieg aus dem Unternehmen sehr wenig Kontakt.«
Die Repräsentantin von Sybille, die diese Bemerkung meines Klienten von draußen natürlich mitgehört hat, ruft verzweifelt: »Genau darum geht es, ich bin ständig in einem krassen Loyalitätskonflikt. Ich will loyal zu meinem Mann sein, und zur gleichen Zeit habe ich das Gefühl, ich müsste hier etwas wieder gutmachen. Sein Ausstieg hat dem Unternehmen sehr geschadet.«
Von Martin erfahre ich, dass Otto und Sybille formal noch ein gemeinsames Unternehmen haben und dass Sybille, als Teil dieses Unternehmens, weiter mit »Change-Option« arbeitet.
Der Versuch, Sybille wieder näher zu »Change-Option« zu stellen, scheitert.
»Ich wäre so gerne nahe bei euch«, bittet Sybille um Verständnis, »doch das kann ich nicht, es zieht mich weg.«
Martin ist berührt und sagt: »Genauso ist es, wir verstehen uns mit Sybille nach wie vor sehr gut und haben gemeinsame Projekte. Sie kann ja nichts dafür, dass ihr Mann ausgestiegen ist. Zur gleichen Zeit ist das wie eine Wunde zwischen uns, die nicht richtig heilt.«
Die beiden RepräsentantInnen von Martin und Hanna sehen einander an, und Hanna sagt bedauernd: »Das hat doch so keinen Sinn. Wir brauchen ›Change-Option‹ nicht, wir sind eine gute Marke auch zu zweit.«
Die Repräsentantin des Unternehmens »Change-Option«, die vorher zwischen Martin, Hanna und Sybille unruhig hin und hergegangen ist und irritiert gemeint hat: »Ich kenne mich hier nicht aus«, sagt ohne große Emotion: »Mich braucht es hier nicht mehr.«
In einem weiteren Bild stellen wir dem Repräsentanten von Martin seine eigene, unabhängige Marke vor, die es ja schon gibt, weil er viele seiner Beratungen auch als Einzelunternehmer macht. Da strahlt er und sagt: »Hier sehe ich Neues auf mich zukommen, jetzt wo ich auch allein gut stehen kann. Ich brauche kein Unternehmen mehr, um mich verbunden zu fühlen.« (Die persönliche Geschichte von Martin lesen Sie im Kapitel 7.)
2.3 Wir klären, wer dazu gehört
(Das Recht auf Zugehörigkeit)
Jedes System braucht klare äußere Grenzen, wenn es gut funktionieren soll. Dieses Prinzip sorgt für Stabilität und Sicherheit. Während Familienmitglieder ihr ganzes Leben lang zum System gehören, erlischt die Zugehörigkeit zum Unternehmen üblicherweise, wenn MitarbeiterInnen das Unternehmen verlassen. Bei ungerechten Kündigungen oder Mobbing kann es allerdings sein, dass die gekündigte Person weiter im System wirksam bleibt und z. B. jemand, der diesen Platz einnimmt, in ähnliche Schwierigkeiten gerät. Es wirkt fast so, als ob es eine Art Firmengedächtnis gäbe, das daran erinnert, dass hier Unrecht geschehen ist. Daher ist das Recht auf Zugehörigkeit ein Wert, mit dem ein Unternehmen nicht leichtfertig umgehen sollte. Achtloses Outsourcing, die Duldung von Mobbing oder das »Vergraulen« von MitarbeiterInnen durch eine beschädigende Unternehmenskultur schaden dem System durch verminderte Leistungsbereitschaft und teure MitarbeiterInnen-Flktuation. Auf der anderen Seite führt dieses Recht auf Zugehörigkeit auch zu Verpflichtungen. Loyalität und Einsatzbereitschaft sollten die Gegenleistung sein.
GründerInnen eines Unternehmens haben ein dauerhaftes Recht auf Zugehörigkeit, weil ihnen das System seine Existenz verdankt. Wenn sie nicht gewürdigt oder sogar hinausgemobbt werden oder in Vergessenheit geraten, bringt das üblicherweise Unruhe und Schwierigkeiten mit sich. Es lohnt sich, ihnen einen guten Platz zu geben, und sie in der Firmenchronik zu erwähnen, auch wenn sie nicht mehr anwesend sind. Dem Bemühen um Zugehörigkeit für neue MitarbeiterInnen, die z. B. durch Merger oder Acquisition (Zusammenschluss oder Verkauf eines Unternehmens) ihre berufliche Heimat verloren haben und in ein »fremdes Land« kommen, sollte ausreichend Raum und Zeit gewidmet werden. Integration geschieht nur durch verbindende Handlungen und nicht durch erzwungene Zusammenarbeit, die zum Widerstand einlädt.
Doch auch innerhalb des Unternehmens gibt es Systemgrenzen und Rechte auf Zugehörigkeit, deren Beachtung eine wichtige Ressource darstellen. Die Frage, wer gehört zum Team, wer gehört zur Projektgruppe, sollte immer beantwortbar sein, auch wenn die Zusammenarbeit nur vorübergehend ist. Unklarheit führt dazu, dass sich MitarbeiterInnen mit der Verteidigung von Grenzen oder dem Bemühen, Grenzen zu ziehen, beschäftigen und dadurch ihre Produktivität leidet. Daher sind eine klare Aufgabenverteilung und Schnittstellen zwischen Abteilungen wichtig.
Doch auch Werte können sich »beleidigt zeigen«, wenn man ihnen das Recht auf Zugehörigkeit verweigert. In diesem Sinne ist es bei Merger & Acquisition besonders hilfreich, wenn die unterschiedlichen Unternehmenskulturen, aus denen MitarbeiterInnen kommen, berücksichtigt werden. Die Frage: »Was ist gut, was soll so bleiben?«, hilft dabei, wichtige Kulturmerkmale, wie z. B. ein respektvolles Miteinander, zu berücksichtigen.
Der Systemische Grundsatz in Aktion
Eine Funktion braucht Anerkennung für ihre Sonderstellung
Das Führungsteam erwartet sich viel von dem Tag, den wir gemeinsam zur Verfügung haben. »Wir möchten, dass Gabriela bleibt«, sagen sie ohne Unterschied in unserer Eingangsrunde. »Sie wäre die vierte Leitung der Pflege, die das Geburtshilfezentrum nach wenigen Jahren verlässt.« Die Angesprochene macht einen unglücklichen Eindruck und zieht zweifelnd die Schultern hoch: »Ich kann so nicht weitermachen. Es gibt immer wieder neue Spannungen mit den ÄrztInnen.«
Die Strukturen sind passend aufgesetzt, das Organigramm sieht vorbildlich aus und scheint auch gelebt zu werden. Die Leitungen der ÄrztInnen und des Pflegepersonals sind gleichberechtigt auf einer Hierarchieebene, die Kompetenzen klar.
In diesem Krankenhaus in der Schweiz, das sich auf Frauen spezialisiert hat, ist eigentlich alles so, wie wir in Österreich es gerne hätten und nur davon träumen können. Bis auf die Tatsache, dass Gabriela die vierte Leiterin des Pflegepersonals ist und gerade dabei ist, zu kündigen. »Es ist deprimierend. Wir haben alle unsere Aufgabenbereiche und arbeiten offiziell auf Augenhöhe. Es könnte so gut laufen und zur gleichen Zeit habe ich immer das Gefühl, als ob wir von der Pflege nicht richtig dazugehörten«, sagt sie, und man merkt Gabriela an, wie sehr sie dieses Gefühl des Ausgeschlossenseins berührt.
Es gibt eine Regel, von der es wenige Ausnahmen gibt. Wenn sich eine Funktion als Schleudersitz herausstellt, dann kann man davon ausgehen, dass es in der Geschichte dieser Funktion Schwierigkeiten gab, die bis heute nachwirken.
Wir machen uns also gemeinsam auf den Weg, um die Hintergründe zu erforschen. Das kleine Privatkrankenhaus war von einer engagierten »Pflegefachfrau« gegründet worden. Sie wollte mittellosen Müttern einen Ort bieten, an dem sie in Sicherheit ihre Kinder zur Welt bringen konnten. Das Geld dafür hatte die Krankenschwester, so wurden Frauen im Pflegeberuf damals noch bezeichnet, von unterschiedlichen Organisationen erbettelt und sich jahrelang dafür eingesetzt. Es war eine grandiose Idee und ein grandioser Erfolg.
Die Gründerin übernahm selbst die Führung des Krankenhauses und war zur gleichen Zeit Leiterin der Pflege.
Dann kam der schmerzliche Bruch. Das Ärzteteam, das sie eingestellt hatte, sorgte dafür, dass ihr die Führung »wegen mangelnder Führungsqualitäten« entzogen wurde, ein männlicher Direktor wurde ihr vor die Nase gesetzt. Das war möglich, weil das Krankenhaus inzwischen einer Stiftung gehörte und der Stiftungsrat die Entscheidung im Sinne der vorwiegend männlichen Ärzte traf.
Die Gründerin verließ nach langen Kämpfen verbittert ihr eigenes Lebenswerk – sie wollte und konnte sich nicht unterordnen. Ihr Recht auf Zugehörigkeit zu dem Krankenhaus, das sie gegründet hatte, wurde nicht erfüllt. Nach dieser Erkenntnis starteten wir unseren Heilungsprozess:
In einem bewegenden Ritual stellten sich in einer Strukturaufstellung (Kapitel 3) das gesamte Leitungsteam als »Funktionen« zur Verfügung.
Gabriela stand in der Funktion der Gründerin, die zur gleichen Zeit Leiterin des Krankenhauses und der Pflege war, an oberster Stelle im Organigramm und sagte bewegt: »Ich bin die Erste hier. Es war meine Idee, und ich habe dieses Krankenhaus gegründet.« Die Funktion für die ärztliche Leitung stand in der zweiten Reihe und sagte ganz erstaunt: »Das stimmt, du hast uns dazu geholt, dir verdanken wir, dass wir hier sind.«
Alle anderen Funktionen, vor allem die »mobile Geburtenbetreuung« und die »Personalabteilung«, waren überrascht und meinten: »Das wussten wir nicht mehr, du hast recht.«
Es war ein emotionaler Moment, als sich alle Funktionen in der zeitlichen Abfolge ihres Dazukommens in eine Reihe stellten, sich die Hände reichten und gemeinsam bereit waren, dem Geburtshilfehaus zu dienen.
Für das nächste Bild verließ das Team die Rollen der Funktionen wieder, und wir legten dafür Bodenanker in den Raum. Jetzt standen an der linken Seite der Funktionen die »echten« Personen, Gabriela als erste, in der Reihe, und ich bat sie folgendes zu sagen und dabei auf ihre Funktion zu zeigen: »Meine Funktion ist die Älteste im Krankenhaus, darum stehe ich jetzt am Anfang dieser Reihe. Zur gleichen Zeit bin ich das jüngste Teammitglied. Ich bin nach euch allen in dieses Krankenhaus gekommen.« Und mit diesen Worten wechselte Gabriela ihren Platz und stellte sich ans Ende der Reihe. Ihre Kollegen und Kolleginnen nickten zufrieden und nahmen ebenfalls ihre Plätze in der Reihenfolge ein, wie sie als Personen ins Unternehmen gekommen waren.
Auch das gehört zu der Nichtleugnung von Gegebenheiten und damit zu den Tatsachen: Die Unterscheidung zwischen den Funktionen und den Personen, die diese Funktionen im Unternehmen innehaben, hilft uns, Schwierigkeiten dort zu klären, wo sie hingehören. Die Vermischung von Funktion und Person führt häufig zu Überlastungen nach dem Motto: »Ich bin die Funktion und trage alle Lasten, selbst die aus der Vergangenheit.« In unserem Fall war es die schmerzliche Geschichte der Gründerin.
Auf meine Frage, ob es im Krankenhaus ein sichtbares Zeichen der Gründerin gäbe, verneinte das Team und beratschlagte, in welcher Weise sie diese mutige, engagierte Frau von nun an würdigen könnten. Sie entschieden sich für ein Portraitfoto, das jetzt in der Eingangshalle und in jedem einzelnen Bereich hängt.
Gabriela, die Leiterin der Pflegeabteilung, ist geblieben. Und noch heute arbeite ich mit dem Team immer wieder zu Themen, die sie beschäftigen.
Die Männer müssen weg
Die meisten Geschichten handeln von Frauen, die in einer Männerwelt untergegangen sind. In dieser Geschichte ist es umgekehrt. Hier hat die »Frauenpower« etwas bewirkt, was dem Feminismus nicht nützt, sondern schadet. Zoe hatte das Unternehmen von ihren Eltern geerbt. Das war nicht so vorgesehen, weil eigentlich ihr Bruder die Nachfolge des Vaters antreten sollte. Zoe war übergangen worden, obwohl sie die Ältere war. Dann starb ihr Bruder bei einem Motorradunfall, und plötzlich war sie wieder interessant. »Ich bin schon in Rage ins Unternehmen eingetreten und hatte ein tiefes Bedürfnis, mich zu rächen. Diese jahrelange Zurücksetzung durch meine Eltern, nur weil ich eine Tochter bin, hat mich zutiefst gekränkt. Heute weiß ich, dass meine Rache dem Unternehmen geschadet hat, doch damals war es einfach großartig, dass ich plötzlich das Sagen hatte. Ich bin in einen richtigen Rausch verfallen.«
Zoe ist eine Zugbekanntschaft. Wir sind mit unseren beiden Hunden von Wien nach Salzburg gefahren, und weil sich die Hunde und wir so gut verstanden haben, sind wir gemeinsam durch den Mirabellgarten spaziert. Und während Barco und Milena den ganzen Park abgeschnüffelt haben, hat sie mir ihre Geschichte erzählt, und ich habe für sie in einen Kiesweg am Rand des Gartens das Wertedreieck mit einem Stöckchen gezeichnet. Es wurde dadurch ganz leicht klar, dass sie zunächst alle drei Qualitäten vernachlässigt hat, als sie das Unternehmen übernommen hatte.