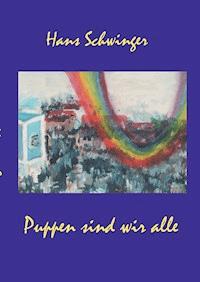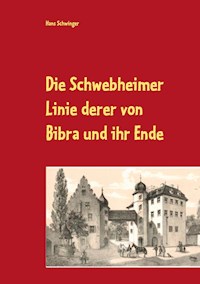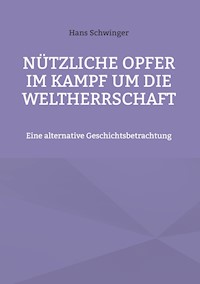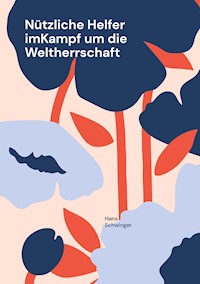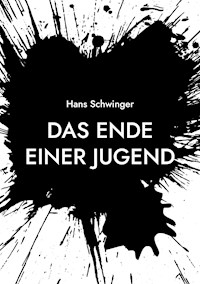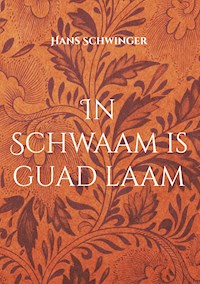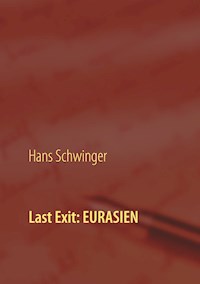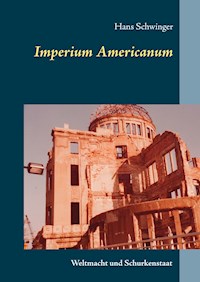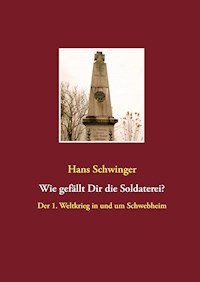
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nicht die große Welt des 1.Weltkriegs steht im Brennpunkt. Es sind Einzelschicksale und -beobachtungen, die unter der Gegenwart des Krieges im Mittelpunkt stehen, die individuellen Sorgen und Freuden, die der kleinen Welt des Dorfes Schwebheim in Mainfranken und die seiner Menschen. Diesen Krieg sieht man zunächst gar nicht als Bedrohung. Fast kommt er wie eine Erlösung, wird freudig begrüßt. Gott steht ja auf unserer Seite und so muß der Sieg unser sein. "Das Abitur wird mir auf den Buckel geworfen", freut sich der Abiturient. Wie das mit der Soldaterei sei, will er vom Freund wissen, bereit und erfreut, wie alle seine Mitschüler, nun endlich Soldat zu werden und "dem Franzmann eine zu verpassen". Stolz erfüllt die Väter über solche Söhne. Allmählich aber kippt die Stimmung. Zu lange dauert schon der Krieg. Immer ungewisser wird das Schicksal der Angehörigen draußen "im Feld". Es gibt keine schnelle Verständigung, ein "…und laß' bald wieder etwas von Dir hören" liest man immer häufiger am Ende von Briefen an die Front. Grausamer werden die Schrecken des Krieges. Die Zahl der Opfer steigt, die Erzählungen von Kriegsurlaubern über das Geschehen draußen schüren Ängste. Nur noch das Ende dieses Schreckens wird schließlich ersehnt und erfleht, und die Hilfe Gottes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Oh, dieser unselige Krieg hat viel Unheil gebracht,
wie hat man vorher so glücklich gelebt und zufrieden.“
(Simon Rosenbusch[1])
(1) Ein Freund der Schwebheimer Lehrersfamilie. Als Jude lebte er früher in Schwebheim. Nun ebenfalls im Dienst für das Reich, an der Westfront.
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Die Weltlage
3. Drei Freunde
3.1. Jugendzeit
3.2. Wegweiser
3.3. Kriegszeit
4. Die Heimatfront
5. Draußen im Feld
5.1. Der banale Krieg
5.2. Briefe als Zeitzeugen
5.2.1. In Garnison – August 1914 bis März 1915
5.2.2. An der Front 1915
5.2.3. Das Jahr 1916
5.2.4. Und weiter im Jahr 1917
5.2.5. April 1918 – Das Ende der Soldaterei
6. Schlußbetrachtung
1. Einführung
„Wie gefällt Dir die Soldaterei?“, so der Titel dieses Buches. Ich habe diesen Titel dem Brief eines Gymnasiasten aus Fürth entnommen, der voller Neugier von einem etwas älteren Freund, der bereits „dient“ erfahren will, was auch ihm nach dem Abitur bevorsteht. Dieses Abitur, das er zuvor noch bestehen muß, „bekomm’ ich auf den Buckel geworfen“, wie er weiter schreibt. Das ist alles nicht mehr von Bedeutung. Der Dienst fürs Vaterland, das teuere, ersetzt alles andere. Und so kann er es kaum mehr erwarten, nun selbst Soldat zu werden und wie die meisten seiner Altersgenossen in den Krieg zu ziehen.
Abb.1 Die Frage nach der Soldaterei
Man hätte dem Buch auch den Titel „Das Ende einer Jugend“ geben können. Denn alles, was Jugend war, was Fortschritt war, starb mit der Urkatastrophe dieses unseligen Krieges. Nichts war nach diesem schrecklichen Ereignis mehr zu spüren von der Aufbruchstimmung zu Beginn des neuen Jahrhunderts. Die Welt hatte eine andere Richtung gewählt. Nicht die des weiteren Fortschreitens gesellschaftlicher Werte im „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ der Revolution, nicht die einer weiteren Steigerung der großartigen kulturellen Leistungen des 19. Jahrhunderts in Musik, in Literatur, in der Malerei, und auch auf dem Gebiet der Technik schienen die wesentlichen Entwicklungen getan.
Sicher, es gab Ansätze zur Weiterentwicklung in den zwanziger Jahren. Jäh unterbrochen jedoch wurden diese durch gewaltige Krisen und Umwälzungen hin zum zweiten, noch furchtbareren Teil eines erneuten Dreißigjährigen Krieges. An dessen Ende stand die Welt in einem unerklärten Krieg, dem Kalten Krieg, und in der Angst eines atomaren Endes allen Lebens. Gewonnen haben die Kräfte der Finanzwelt und der Wirtschaft, Kräfte, die zur Käuflichkeit und Kaufbarkeit jedweden materiellen und immateriellen Gutes einzusetzen sind.
Es werden in dem vorliegenden Buch nun nicht die großen Ereignisse und Zusammenhänge beschrieben, die zu dieser Katastrophe von 1914 führten. Erlebnisse, Meinungen, Erfahrungen, Hoffnungen von Menschen, von einzelnen Individuen, sind es, mit denen wir hier konfrontiert werden. Es sind nicht die Kaiser, Könige, Minister und Generäle und es sind nicht die Zentren der Macht, es sind einfache Bürger, einfache Soldaten und Schwebheim, ein Dorf in Deutschland, welche die Hauptrolle spielen.
Noch ein Wort zu Schwebheim. Dieses Dorf, im Süden der ehemaligen Freien Reichsstadt Schweinfurt gelegen, hatte um die Zeit des 1.Weltkriegs um die 700 Einwohner. Der Ort war vornehmlich landwirtschaftlich geprägt. Wegen seines intensiven Heilkräuteranbaus auch als Apothekergarten Frankens bekannt. Mittelpunkt des evangelischen Dorfes war der Kirchplatz mit dem Schloß der „Herrschaft“, der Freiherren von Bibra, die über Generationen als Lehensherren den Ort beherrschten. Auch wenn sie zur Zeit dieses Krieges längst ihrer alten Rechte verlustig waren, waren sie noch tief respektiert, Nachwehen jahrhundertelanger Abhängigkeit und Unterdrückung.
Dennoch zuvor einige Bemerkungen zur großen Politik, zur Weltlage.
2. Die Weltlage
Es schien eine gute Zeit für und in Europa zu werden, betrachtet man diese ersten Jahre des 20. Jahrhunderts. Man zehrte von den grundlegenden Forschungen der vorangegangenen 100 Jahre. Man setzte in der Technik diese grandiosen Entwicklungen fort, in der Mechanik, in der Elektrik, in der Architektur. Gleiches gilt für die ebenso gewaltigen Leistungen auf den Gebieten der Kunst, der Malerei, der Musik, der Dichtung. Freilich es war auch eine Zeit der Dekadenz, einer Lust am Untergang angesichts der gefühlten Langeweile des späteren Zeitalters. Aus solcher Stimmung könnte die Sehnsucht nach dem reinigenden Gewitter eines Krieges erwachsen sein. „Hoffentlich geht’s im nächsten Jahre los. Eine kleine Abwechslung tät gut.“ schreibt der junge Ernst im Jahre 1912 an seinen Freund. Es sollte nicht bei der kleinen Abwechslung bleiben.
Es gab viele Themen, die vor 1914 für Streit und Ärger sorgten. So die Frage der Kolonien, die Frage nach der Herrschaft auf den Weltmeeren, die den Briten von Deutschland streitig gemacht wurde, es gab von Seiten Frankreichs noch zuviele nicht verarbeitete Erinnerungen an den verlorenen Krieg 1870/71. Österreich-Ungarn konnte die Zwistigkeiten in seinem riesigen, multikulturellen Herrschaftsgebiet immer weniger unter Kontrolle halten. Und auch der Mittlere und Nahe Osten, und damit das Osmanische Reich, waren bereits ein Gebiete, um die wegen der dortigen Ölfelder ein kräftiges Gerangel entstanden war. Erinnert sei hier an den Bau der Bagdad-Bahn 1900 bis 1914 durch das Kaiserreich.
Durch ein Dickicht von Verträgen und Beziehungen, auch von verwandtschaftlichen der Herrscherhäuser, schien eine gewisse Sicherheit vor außenpolitischen Katastrophen gewährleistet. Gerade diese Absicherung aber führte in der wachsenden Krise dazu, daß das ganze Kartenhaus an wechselseitiger Absicherung im August 1914 zusammenstürzte, ausgelöst durch das mindere Ereignis der Schüsse von Sarajevo am 28. Juni 1914. Nur am Rande sei erwähnt, daß kurz vorher – im Dezember 1913 – mit List und Tücke von den Mächtigen dieser Erde eine Institution gegründet worden war, deren Ziel es war und heute immer noch ist, die Welt auszuplündern. Wir sprechen hier von der FED, angeblich als Notenbank der USA, wie sie landläufig bezeichnet wird, eine nur scheinbar staatliche Institution, in Wirklichkeit jedoch bis heute als private Bank im Besitz der Finanzwelt, mit hoheitlichen Rechten ausgestattet. So mit dem Recht, Geld zu drucken und vom Steuerzahler dafür Zinsen zu fordern. War es nur Zufall, daß diese Bank so schnell und heimlich noch rechtzeitig vor dem Krieg gegründet wurde? Die Gründung dieser FED war jedenfalls die Voraussetzung zur Finanzierung der gewaltigen, kommenden Kriegskosten. Hatte man deshalb diese Bank gegründet, um den anstehenden Krieg zu finanzieren oder wagte man den Krieg im Bewußtsein, daß der dank der FED finanzierbar war, d.h. hohe Profite versprach?
Ab 1914 kam es endlich zu dem vielfach ersehnten Krieg. Es standen sich die Mittelmächte mit Deutschland, Italien, Rumänien, dem Osmanischen Reich und Österreich-Ungarn den Ländern der sogenannten Entente, Großbritannien, Frankreich und Rußland, gegenüber. Noch heraus hielten sich die USA. Doch bereits 1915 gab es vor allem aus Großbritannien Versuche, die USA als Bündnisgenossen in den Krieg hineinzuziehen. Freilich scheiterte dies zunächst an der Stimmung der US-Bürger. Warum sollte man sich in dieses blutige Abenteuer stürzen? Was wäre zu gewinnen? Und so mußte eine Finte her, die den USA nie fehlte, wenn es galt, ihr Volk und die Welt zu hintergehen. Diesmal sollte es ein Handelsschiff, die Lusitania, sein, das man als Köder, vollbepackt mit 2.000 ahnungslosen Passagieren, darunter vielen Kindern, und über 10 to Kriegsmunition im Mai 1915 trotz der Warnungen der Deutschen Botschaft ohne jeden Geleitschutz auf die Fahrt nach Europa schickte, mit dem sicheren Wissen, daß die Deutschen reagieren mußten. Winston Churchill, Lord der Admiralität in England, soll hinter dieser Finte gestanden haben. Ein deutsches U-Boot torpedierte wie erwartet die Lusitania. Es gab 1.200 Tote, darunter 128 US-Bürger. Die Angelegenheit verschlechterte zwar die Stimmung in den USA gegen Deutschland, noch reichte es aber nicht zum Kriegseintritt. Doch er war vorbereitet. Indes erst im November 1917, als klar war, wer letzten Endes siegen würde, griffen die Vereinigten Staaten auf Seiten der Entente in das Kriegsgeschehen ein. Rechtzeitig zum Verteilen der Beute. Und sie machten, wie wir wissen, reiche Beute. Wurden zur Weltmacht. Daß sie einen weiteren Krieg, besser gesagt, eine Fortsetzung benötigten, um zur wirklich einzigen Weltmacht zu werden, sei hier am Rande erwähnt.
Und so brachte dieser Krieg für Europa gewaltigen Verlust an Macht. Frankreich’s Norden lag verwüstet, gar nicht zu reden von den menschlichen Opfern, Großbritannien hatte neben hohen Verlusten an jungen Menschen immens an Bedeutung in Europa, noch weit mehr aber gegenüber Nordamerika verloren, Rußland taumelte, tief getroffen und gespalten, in die Geburtswehen einer, sicher notwendigen und auch hoffnungsvollen Revolution hinein, Österreich-Ungarn schließlich war aufgelöst, war verschwunden.
Und Deutschland? Tief getroffen und gespalten auch dieses Land. Tiefer noch hineingestürzt von den Siegermächten durch einen Vertrag, den von Versailles, der die Grundlagen für einen weiteren Krieg in sich trug. Unruhig das Volk, das man über die kommenden Wirtschaftskrisen und eine gewaltigen Inflation noch tiefer ins Verderben trieb. Und dies alles nutzend, finanzierte man mit Mitteln aus Industrie und den USA insbesondere Deutschland, wo man mit Hitler einen geeigneten Partner installiert hatte, um noch mehr Profite aus den kommenden angedachten Waffengängen zu ziehen und um das Imperium in Nordamerika weiter zu begründen. Um dies zu erreichen, mußten sich die Völker Europas weiter bekämpfen und mußten die ausbluten. Der schlimme 1. Weltkrieg war ganz einfach wegen der Kriegsmüdigkeit der Völker zu früh beendet worden. Und wie einem Volk ein solcher Verdruß wie Kriegsmüdigkeit ausgetrieben werden kann, das belegt die weitere deutsche Geschichte, nicht nur die ab 1933, sondern auch die ab 1989.
3. Drei Freunde[2]
Drei junge Leute, Fritz Wagner, Ernst Hoffmann und Hans Baum, waren Jugendfreunde aus gemeinsamen Schwebheimer Jahren. Zu Beginn des Krieges hat sich Fritz, mittlerweile Bankbeamter in Augsburg, bereits als Freiwilliger gemeldet, einundzwanzig Jahre jung. Der gleichaltrige Ernst beginnt eine Ausbildung als Apotheker in der „Sonnenapotheke“ zu Speyer, Hans, der achtzehnjährige, bereitet sich in Fürth auf sein Abitur vor. Nebenbei ist er ein begeisterter Fußballspieler.
3.1. Jugendzeit
„Wie hat man vorher so glücklich gelebt und zufrieden“, schrieb ein verzweifelter Simon Rosenbusch nach dem Jahrhundertkrieg an seinen jugendlichen Freund Fritz. Auch heute noch scheinen uns die Jahre vor Ausbruch des Krieges irgendwie verklärt.
Werfen wir einen Blick in Briefe dieser jungen Burschen aus diesen Jahren, bevor sie der Krieg „zu richtigen Männern“ machte.
So schreibt Ernst 1910, gerade mal 16 Jahre alt aus Speyer, wohin die Familie Hoffmann aus Schweinfurt umgezogen ist. Die Ferien stehen vor der Tür und da geht’s nach Schwebheim zu den alten Freunden. Ihr gemeinsamer Freund Hans aus Fürth wird auch kommen, wie all die Jahre.
„Doch will ich Dir etwas von Ferienplänen mitteilen. Ich habe ungefähr in den letzten Tagen 6 Mark zusammengebracht und lasse mir vielleicht noch 4 Mark von meiner Mutter geben. Da fehlt es also nicht. Dann habe ich mir ein paar Steigeisen gekauft (5,50 Mark), die ich vielleicht in den Ferien benutzen kann. Um die Zeit totzuschlagen ohne Gesellschaft, habe ich mir 16 Hefte von einem Käferbuch angeschafft (á 1 Mark) und schaffe mir noch ein paar von denselben an. Im ganzen sind es 24. Sehr interessant und furchtbar gelehrt, doch gute Bilder. Dann werde ich noch Experimente machen. Jetzt aber bin ich daran, gute Rezepte zu sammeln (über Fisch, Wild, Eingemachtes).
Hans und ich können ja dann vielleicht allein unter der Woche alles vorbereiten und am Sonntage dann...... Du hast doch sicherlich da frei; denn dies wäre sonst ja schauerlich.
Mit den Schleudern wird es nicht viel sein, ich glaube, ich treffe nicht einmal mehr ein Scheunentor, so bin ich außer Übung. Meine Schleuder liegt ja wohl verwahrt in Schwebheim. Und Deine?“
Dann ein anderer Brief, kurz vor den Ferien 1911:
„Wir haben in den 4 Wochen noch 6 Schulaufgaben, 1 Hausaufgabe und ich habe noch einen sehr umfangreichen Vortrag für die Schule zu liefern. Ich habe als Thema „Die Ameisen“ gewählt.
Ich hoffe, daß Du am Samstagabend im Pfarrgarten bist, 19 Uhr ungefähr.“
Und auch auf das andere Geschlecht achtet man nun schon, man ist ja bereits 17 Jahre alt:
„Über die hiesigen Mädchen[3] kann ich nicht dasselbe sagen wie über die Schweinfurter. Teils sind sie schon in festen Händen, teils von Hausdrachen in Verwahrung gehalten, oder solche, die schon die halbe Stadt in ihren dreckigen Pfoten gehabt hat. Neuer Import fand nicht statt.“
Doch die Schleuder zählt immer noch:
„Meine Schleuder ist Mittwoch ins bessere Jenseits gegangen. Ich schoß da zum ersten Mal seit den großen Ferien und traf gleich auf den ersten Schuß sehr weit einen alten Spatzen, später noch einen Stieglitz und diverse Frösche. Alles das wurde am Donnerstag gebraten.“
Ein Jahr später (1912):
„Meinem Studierfenster in der Apotheke gegenüber ist ein Konfektionsgeschäft und eine kleine, nette, süße Ladnerin himmelt immer so sehnsüchtig herüber, daß meine großen Formeln und endlose Namen auf dem Papier einen wahren Höllentanz aufführen. Und ich einen Satz sechsmal lesen muß und doch nicht weiß, was darinnen steht. Doch ist mein Herz noch frei und ich werde mich umso mehr in die tiefste Wissenschaft stürzen.“
Und:
„Heiraten tue ich nicht so schnell, denn die Weiber ekeln mich an, ich höre zuviel (Alle Tage: Tripper, Syphilis, weißer Fluß, Regel – pfui!).“
Wir schreiben jetzt das Jahr 1913, Ernst steckt tief im Beruf — Der Ernst des Lebens hat den Ernst gepackt.
„Jetzt ist unsere Apotheke die reinste Knochenmühle; ich bin jeden Tag wie gerädert und todmüde.
Für mich gibt es nur noch Waagen, Morphium, Codein, Strychnin, Coffein, Pyramidon, Antipyrin und wie die Dinge alle noch heißen.“
Abb.2 Die Sonnen-Apotheke in Speyer – heute
Nicht außergewöhnlich für junge Menschen, diese Briefe, diese Ansichten, Wünsche und Sorgen, in Deutschland und Österreich/Ungarn wie in Frankreich, England, Rußland, Italien, Rumänien, Bulgarien, dem Osmanischen Reich und…Doch schon erwartete diese jungen Menschen der Krieg, um ihre Sicht aufs Leben zu prägen.
3.2. Wegweiser
Und es waren mächtige Kräfte, die diesen jungen Menschen den rechten Weg in den Krieg wiesen.
In Deutschland ist es der Kaiser persönlich, der am 6. August 1914 sein Volk aufruft:
„An das deutsche Volk!
Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Bemühen gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten und im Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu fördern. Aber die Gegner neiden uns den Erfolg unserer Arbeit. Alle offenkundige und heimliche Feindschaft von Ost und West, von jenseits der See, haben wir bisher ertragen im Bewusstsein unserer Verantwortung und Kraft. Nun aber will man uns demütigen. Man verlangt, daß wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rüsten, man will nicht dulden, daß wir in entschlossener Treue zu unserem Bundesgenossen stehen, der um sein Ansehen als Großmacht kämpft und mit dessen Erniedrigung auch unsere Macht und Ehre verloren ist.
So muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu Waffen! Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande.
Um Sein oder Nichtsein unseres Reiches handelt es sich, das unsere Väter sich neu gründeten. Um Sein oder Nichtsein deutscher Macht und deutschen Wesens. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie ward Deutschland überwunden, wenn es einig war.
Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.“
Was hätte ein junger Mensch diesen Worten und einem gesteuerten öffentlichen Klima allerorten entgegensetzen können?
Und wie in Deutschland, so auch in den anderen Nationen.
So Georg V., König des weltweiten British Empire, in seiner Botschaft im August 1914 an die ersten seiner Truppen, die an die Front gingen:
„Ihr verlaßt die Heimat, um für die Sicherheit und die Ehre unseres Reiches zu kämpfen. Belgien, das wir verpflichtet sind zu verteidigen, wurde angegriffen und der gleiche mächtige Feind dringt gerade in Frankreich ein. Ich habe Vertrauen ohne jeden Vorbehalt in euch, meine Soldaten. Pflicht ist euere Losung und ich bin sicher, ihr werdet euere Pflicht in bester Weise erfüllen. Ich werde alle euere Taten mit höchster Aufmerksamkeit verfolgen und mit größter Genugtuung jeden Tag euerer Erfolge festhalten. Euer Wohlergehen wird mir immer am Herzen liegen.
Ich bete zu Gott, daß er euch segnen und beschützen möge und euch siegreich wieder heimbringe.“
Und nicht viel anders in Frankreich, wo wir in Präsident Raymond Poincares Kriegsadresse vom 4. August 1914 unter anderem sinngemäß lesen können:
„…Jetzt, wo der Kampf beginnt, kann Frankreich feierlich erklären, sich bis zum letzten Augenblick aufs äußerste bemüht zu haben, den Kriegsausbruch abzuwenden…Unsere gut gerüsteten, mutigen Soldaten stehen bereit, die Ehre unserer Fahne und unseres Landes zu verteidigen. Als Präsident der Republik übermittle ich unseren Soldaten zu Land und zur See die Hochachtung und das Vertrauen aller Franzosen. In enger Verbundenheit wird unsere Nation in gelassener Selbstbeherrschung stehen, wie sie es seit Beginn der Krise täglich gezeigt hat…In dem nun beginnenden Krieg hat Frankreich das Recht auf seiner Seite…Heldenhaft wird unsere Nation von allen ihren Söhnen verteidigt werden; nichts kann unsere geheiligte Einheit zerbrechen; alle stehen wir heute als Brüder vereinigt in Entrüstung gegen den Aggressor und im Vertrauen auf das Vaterland.
Treu steht uns Rußland bei, unser Verbündeter; in loyaler Freundschaft unterstützt uns Großbritannien. Aus allen Ländern der zivilisierten Welt erreichen uns Symathiebezeugungen und gute Wünsche. Denn unsere Nation steht wieder einmal für Freiheit, Gerechtigkeit und Vernunft auf dieser Erde.
Fassen wir uns ein Herz. Es lebe Frankreich!“
Doch nicht nur die Staatsführer, auch die Vertreter Gottes auf Erden meldeten sich zu Wort. So lesen wir in einem von den deutschen Bischöfen und Erzbischöfen unterzeichneten Hirtenbrief zum Weihnachtsfest 1914 unter anderem:
„…Der Krieg war eine strenge Adventschule, er hat uns und unser Volk dem Heiland näher gebracht…Wie ein Sturmwind fuhr der Krieg hinein in die kalten Nebel und bösen Dünste des Unglaubens und der Zweifelsucht und die ungesunde Atmosphäre einer unchristlichen Überkultur. Das deutsche Volk besann sich wieder auf sich selbst; der Glaube tat wieder in sein Recht; die Seele schlug ihr Auge auf und erkannte den Herrn.
Folgend dem Zug der Gnade, folgend der Stimme seiner Hirten und der Mahnung seines gottesfürchtigen Kaisers, zog das Volk in die Kirche und fand dort den Heiland; viele fanden Ihn wieder, die weit von Ihm abgeirrt waren. In schicksalsschwerer Stunde brach die Erkenntnis durch, daß Er allein der Heilige, Er allein der Herr, Er allein der Allerhöchste sei. Wir hörten Ihn ernst und tröstlich zu uns sagen: Wenn ihr höret von Kriegen und Kriegsgerüchten, erschrecket nicht, denn solches muß geschehen. In Ihm war und blieb die Verbindung hergestellt zwischen uns und den Unsrigen im Felde, zwischen den kämpfenden Heeren draußen und den Heeren der Beter daheim, eine unüberwindliche, siegverbürgende Einheit aller in Christus Jesus, unserem Herrn.