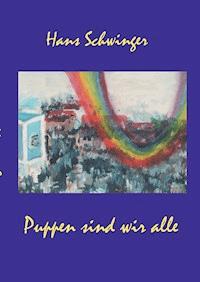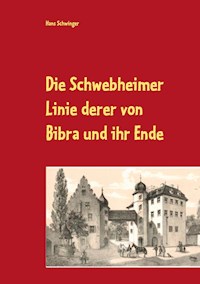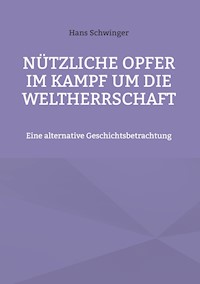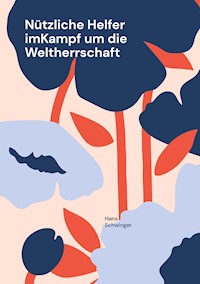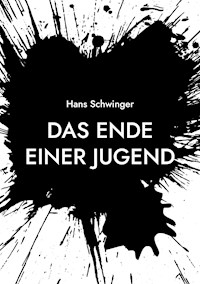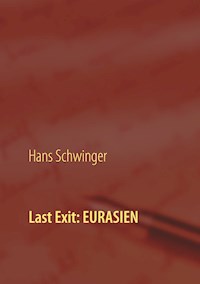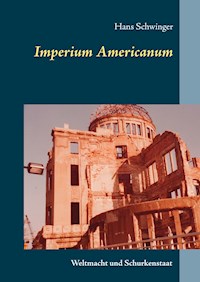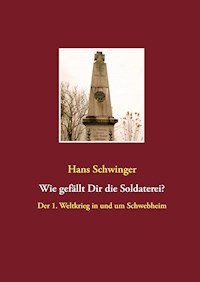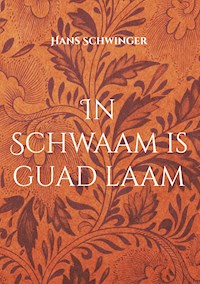
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Schwaam, Schwebheim, ein Dorf in Unterfranken, nicht weit entfernt von der ehemaligen Freien Reichsstadt Schweinfurt. Schwebheim hat heute um die 4.000 Einwohner, es gilt als vorbildlich in Sachen Umwelt und Naturbeachtung. Einen Namen hat Schwebheim als über viele Jahre zentraler Ort für Anbau und Verarbeitung von Heilkräutern. Das Apothekergärtchen Frankens, so wird es auch heute noch bezeichnet. Dieser Band beleuchtet diesen Ort aus verschiedenen Quellen seiner ferneren und näheren Vergangenheit und er gibt Ausblicke in eine denkbare Zukunft. Er enthält neben dem Abdruck eines Werkes des ehemaligen Ortspfarrers Otto Schwarz über Schwebheim aus dem Jahre 1906, der Ortschronik eines Lehrers aus dem 19. Jahrhundert und von sorgfältig dokumentierten Wetterbeobachtungen eines kaum bekannten Schwebheimers für die Jahre 1886 bis 1903. In einer Beschreibung aus dem 17. Jahrhundert schildert Johann Michael Fehr die Schwebheimer Flur als das Abbild eines verlorenen Paradieses. Das nahe Schweinfurt, der das Dorf prägende Heilkräuteranbau, die Kriegszeiten der Neuzeit und das Schicksal von jüdischen Mitbürgern sind ebenso Themen wie die Hürden einer ökologischen Flurbereinigung gegen die Widerstände bürokratischer Amtsstuben und die Biographien einiger mit Schwebheim verbundener Personen: eines wiedertäuferischen Ketzers (Johann Huth), eines Feldzeugmeisters des Prinzen Eugen (Johann Ernst von Bibra), des Nestors der Wirtschaftspädagogik (Abraham Adler) und des Urahns und Ältestem des psychedelischen Stammes (Ernst von Bibra).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Denn wer recht stiehlt und Gott vertraut, der kriegt
doch stets das größte Kraut und auch die größten
Rüben“
Zum Autor
Hans Schwinger, Jahrgang 1939. 1958 Abitur am Humanistischen Gymnasium Schweinfurt, 1958 - 1963 Universitätsstudium mit dem Abschluss Diplom-Volkswirt. 1963.
Ab 2000 als Autodidakt Autor verschiedener Buchtitel unter anderem mit historischen (Ein Humboldt aus Franken, Wie gefällt Dir die Soldaterei?, Die Schwebheimer Linie derer von Bibra und ihr Ende, Erinnerungen an Ernst von Bibra) und gesellschaftskritischen Inhalten (Puppen sind wir alle, Wache Geister in wirren Zeiten, Imperium Americanum: Weltmacht und Schurkenstaat, Last Exit: Eurasien).
Schwebheim, Juli 2021
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Der Name „Schwebheim“
Schwebheim in Chroniken seiner Vergangenheit
3.1. Ortschronik der Landgemeinde Schwebheim
3.2. Wetterbeobachtungen in den Jahren 1886 – 1903
3.3. Einiges zu Schwebheim im 1. Weltkrieg
3.4. Bilder von gestern
Aus der Vergangenheit eines Bauerndorfes.
4.1. Die Orte der Toten
4.2. Der Markgrafenhof
4.3. Die Ritter von Wenkheim
4.4. Johann Jakob Huth
4.5. Heinrich von Bibra
4.6. Der dreißigjährige Krieg
4.7. Ein Streik im 18. Jahrhundert
4.8. Dr. Ernst von Bibra
Nochmals Johann Huth
Tod in Bergamo: Johann Ernst von Bibra
Ernst von Bibra: eine etwas andere Biographie
Abraham Adler, Nestor der Wirtschaftspädagogik
Schwebheimer Geschichten
9.1. Das Feddebrod
9.2. Denn wer recht stiehlt und Gott vertraut, der kriegt doch stets das größte Kraut
9.3. Juden in Schwebheim
9.4. Ein Liebesbrief aus dem 19. Jahrhundert
9.5. Eine Aktiengesellschaft – in Schwebheim
Eine andere Vergangenheit
Die Schwebheimer Linie derer von Bibra
Das Schloß zu Schwebheim
Nachruf und Grabrede
Und noch ein Blick zurück
Schweinfurt
15.1. Eine liebevolle Beschreibung
15.2. Zur Geschichte der Stadt
Schwebheim unter Wasser? – Die Entstehung der Mainlandschaft um Schweinfurt
Schwebheim und seine Drogen
17.1. Erkenntnisse eines Forschers
17.2. Heilkräuteranbau in Schwebheim
Im Apothekergarten Frankens
Die Baldriansuche und das Eibischputzen
Geschichte eines verlorenen Paradieses
Ein Pfad durchs Paradies
Ökologische Flurbereinigung in Schwebheim
Das Flurbereinigungsdenkmal
Das Atomkraftwerk Grafenrheinfeld
Schwebheim gestern - heute - und morgen
Fritz Roßteuscher - ein Nachruf
1. Vorwort
Ursprünglich wollte ich nur das 1906 vom damaligen Schwebheimer Pfarrer Otto Schwarz geschriebene Büchlein „Aus der Vergangenheit eines Bauerndorfes“ drucken lassen und es somit für unsere Zeit erhalten. Denn was Schwarz in diesem kleinen Werk an Vergangenheit unseres Dorfes Schwebheim zusammengetragen hat, ist viel zu wertvoll, als daß es in Vergessenheit geraten dürfte. Als ich dann in Erfahrung brachte, daß ein Reprint des Büchleins von Schwarz durch den Ortsgeschichtlichen Arbeitskreis Schwebheim aus dem Jahre 1992 existierte, entschied ich mich, mit dem vorliegenden Buch weitere Erinnerungen an die Vergangenheit Schwebheims festzuhalten. So wurde aus dem geplanten Nachdruck eines Einzelwerkes, das freilich vielfache Aspekte der Ortsvergangenheit anspricht, eine Sammlung von ganz unterschiedlichen, scheinbar auch zufällig ausgewählten Vergangenheitsbildern, die aber gerade in dieser Auswahl sowohl dem Kenner der örtlichen Vergangenheit als auch dem neugierigen Laien Einsichten bringen können.
In einem anderen Werk von Otto Schwarz, „Beiträge zur Geschichte Schwebheims“ aus dem Jahre 1903, findet sich eine Erklärung des Ortsnamens von Schwebheim als das „Heim eines Swabo“. Fritz Wagner, ein ehemaliger Schwebheimer Ortsbürger, schrieb das handgeschriebene Werk des Pfarrers in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts mühsam mit der Schreibmaschine ab, um es somit der Nachwelt zu erhalten[1]. Beim Abschreiben kamen ihm, der ein Laie auf dem Gebiet der Geschichtswissenschaft war, einige Zweifel an dieser Version und er setzte sich mit damals anerkannten Wissenschaftlern in Verbindung. Dabei kam es zu einer völlig anderen Namenserklärung. Interessant an dieser Geschichte ist dabei nicht nur der sachliche Teil sondern auch der Einblick in Rivalitäten und Vorbehalte, wie sie offenbar schon in jener Zeit zwischen Experten zu finden waren. Um diese Geschichte einer alternativen Namenserklärung geht es im ersten Kapitel „Der Name Schwebheim“ dieses Buches.
Es schließen sich drei Ortschroniken an, wobei in einem strengen Sinn nur die erste, die Ortschronik der Landgemeinde Schwebheim, diesen Namen verdient. Diese wurde wohl im Auftrag der Gemeinde von dem damaligen Schwebheimer Lehrer Friedrich Wagner und anschließend von seinem Nachfolger Heinrich Kaiser erstellt. Sie beginnt weit in der Vergangenheit Schwebheims und endet mit dem Jahre 1886.
Die anschließende „Ortschronik“ ist eigentlich eine umfassende Beschreibung der Wetterverhältnisse der Jahre 1886 bis 1903 vor allem in Schwebheim. Sie berichtet aber auch über so manche Ereignisse dieser Jahre und kann deshalb durchaus als Chronik durchgehen. So nebenbei bekommen wir einen guten Einblick über die Preise landwirtschaftlicher Produkte und ihrer Schwankungen in jenen Jahren, meist bedingt durch Wettereinflüsse, und natürlich damit über die Abhängigkeit des dörflichen Lebens vom Wettergeschehen. Adam Fasel, ein Tagelöhner aus Schwebheim bei der Gutsherrschaft, hat diese Wetterbeobachtungen gewissenhaft aufgezeichnet.
„Einiges zu Schwebheim im 1. Weltkrieg“ ist keine systematische Chronik mehr. Es sind Auszüge aus einem umfassenden Briefverkehr der Schwebheimer Lehrerfamilie Wagner von und zu der Front mit Bezug zu Schwebheim. Gerade in der losen Aneinanderreihung der Inhalte gibt dieses Kapitel ein treffendes Bild über die Zufälligkeit und die Wirrnis jener Jahre 14/18.
Dann folgt der Abdruck des bereis erwähnten Werkes von Pfarrer Otto Schwarz.
Es schließt sich die Geschichte von vier bekannten Männern an, in deren Leben Schwebheim eine mehr oder weniger wichtige Rolle gespielt hat.
Zunächst Johann Huth, dem bereits Pfarrer Schwarz ein Kapitel gewidmet hat. Deutlicher als bei Schwarz zeigt uns diese Schilderung mit romanhaften Zügen den Lebensweg und die Zeit dieses Rebells gegen die christliche Obrigkeit. Ihn zu foltern und zu ermorden genügte dieser Obrigkeit nicht. Man mußte selbst seinen Leichnam noch öffentlich verbrennen…und seine Tochter ersäufen.
Der zweite, Johann Ernst von Bibra, Söldner und Diplomat, war kaum je in Schwebheim zu sehen. Als Vertrauter des Würzburger Bischofs und des Prinzen Eugen aber war er an fast allen Kriegsschauplätzen seiner Zeit anzutreffen.
Als weiterer folgt dessen Ur-Enkel Dr. Ernst von Bibra, der Forscher, der Weltreisende und der Schriftsteller. Auch er blieb nicht für sein ganzes Leben in Schwebheim. Er übersiedelte nach Nürnberg, wo er für seine Forschungsarbeiten und die Ausbildung seiner drei Kinder bessere Bedingungen vorfand.
Und schließlich gilt es zu berichten über einen weiteren, hier geborenen Schwebheimer, über den Juden Dr. Abraham Adler. Er wurde zum Nestor der Wirtschaftspädagogik in Deutschland.
Die erste der „Schwebheimer Geschichten“, mit der Überschrift „Das Feddebrod“ handelt von einem richtigen Lausbubenstreich, den zwei echte Schwebheimer Lausbuben, Armin Wagner und Georg Karb, um das Jahr 1925 einem Jäger und Förster, dem Tyczka, spielten. Einer der beiden Lausbuben, Armin Wagner, ein begnadeter Erzähler, hat diese Geschichte Jahre später einmal in lustiger Gesellschaft wiedergegeben. Seine launige Schilderung existiert noch heute in einer Tonaufzeichnung. Ob sie geschrieben die bunten Nuancen des Erzählers wiedergeben kann?
Etwas schleierhaft und leider auch lückenhaft scheint mir die folgende Geschichte „Denn wer recht stiehlt…“ in Gedichtform, die wohl ebenfalls von dem oben erwähnten Adam Fasel stammt. Wollte er damit vielleicht die Schandtaten einiger Schwebheimer Mitbürger darstellen? Man müßte ihn fragen können. Aber alleine durch diesen Zweizeiler mit Ewigkeitswert „Denn wer recht stiehlt und Gott vertraut, der kriegt doch stets das größte Kraut und auch die größten Rüben“ verdient diese „Predigt“, festgehalten zu werden.
Ein traurigere Geschichte ist die der „Juden in Schwebheim“. Es ist natürlich keine umfassende Geschichte aller dieser Mitbürger jüdischen Glaubens. Es sind beispielhaft wenige Blitzlichter über zwei Menschen, nur wenigen Älteren noch in Erinnerung, mit die letzten Juden in Schwebheim. Sie zeigen, wie gut eingebunden in die Dorfgemeinschaft diese Menschen waren, sie zeigen im Fall von Hannchen Oppenheimer die opportunistische Abkehr von ihr, der doch so langjährigen und geschätzten Mitbürgerin. Kann ein Satz treffender die Lage im Deutschland von damals charakterisieren als das „Ihr habt das Lachen verlernt“ der Jüdin?
Ein Liebesbrief aus dem Jahr 1859 schildert in bewegten Worten den Trennungsschmerz des jungen Lehrers Christian Wagner, Vater des späteren Schwebheimer Lehrers Hans Wagner von Frau und Kind.
In den wirren Nachkriegsjahren mit einer Superinflation hatte man sogar den Mut zu einer Aktiengesellschaft in Schwebheim. Nur kurze Zeit überlebte diese, schnell war sie vergessen.
„Eine andere Vergangenheit“ gibt einen kurzen Einblick in Kriegs– und Nachkriegszeit von Weltkrieg II anhand einiger Briefzitate. Man hatte in Deutschland mehr als nur das Lachen verlernt. Zynisch die Einstellung „People suffer justly“ von US–Soldaten. Man wird bei einer solchen Haltung daran erinnert, mit welch einer Selbstgerechtigkeit eben diese US–Amerikaner anderen Völkern heute mehr denn je ihre faulen Werte als die wahren aufzwingen.
Auch zu August Kolb, den ersten Bürgermeister nach 1945, gibt es einiges zu berichten. Er scheint vergessen, obwohl er, ein aufrichtiger Sozialdemokrat, in schwierigsten Zeiten im Amt war.
„Die Schwebheimer Linie derer von Bibra beschreibt das folgende Kapitel 11. Im folgenden Kapitel 12 lassen wir das Schloß zu Schwebheim über seine Vergangenheit zu uns reden. Und in Kapiel 13 ist es Pfarrer Rotter, der mit einer Grabrede auf die letzte Verstorbene derer von Bibra an die Vergangenheit derer von Bibra erinnert.
Wie das Dorf bis zum 2. Weltkrieg weiter wuchs, über die Freuden und Leiden beim Fußballspielen in den ersten Nachkriegsjahren, darüber berichtet das folgende Kapitel 14.
Das nächste Kapitel 15 ist Schweinfurt gewidmet. Ereignisse und Entwicklungen in dieser nahe gelegenen ehemaligen Freien Reichsstadt prägten die umliegenden Orte, so sicher auch Schwebheim. Denken wir nur an die aufkommende Industrialisierung in Schweinfurt mit ihren vielen Beschäftigten aus den Dörfern ringsum.
War da, wo heute Schwebheim liegt, einstmals ein weiter, großer See? Oder zumindest ein riesiges Schwemmgebiet der Mainfluten? Die Arbeit eines Schweinfurter Lehrers schildert Entstehung und geologische Struktur der Mainlandschaft um Schweinfurt (Kapitel 16).
Doch Schwebheim ist nicht nur von der Industrialisierung geprägt. Seit etwa Mitte des neunzehnten Jahrhunderts entwickelten sich hier Anbau und Verarbeitung von Heilkräutern und Drogen einschließlich eines weltweiten Handels mit diesen. Schwebheim wurde zum Apothekergärtchen zumindest Frankens (Kapitel 17). Vorangestellt ist ein Auszug aus „Die narkotischen Genußmittel und der Mensch“, einem Werk aus dem Jahre 1855. Geschrieben hat es der in Schwebheim geborene Dr. Ernst von Bibra, Urahn und Ältester des psychedelischen Stammes. Um Drogen geht es in diesem grundlegenden Werk und um deren Nutzen für die Menschheit. Es folgt die zum Teil selbst miterlebte Geschichte und Darstellung des Heilkräuteranbaus in Schwebheim und der für den Ort wichtigsten Heilkräuter nach Aufzeichnungen von Altbürgermeister Fritz Roßteuscher.
Dann folgt ein Zeitungsbericht, der beschreibt, wie man Schwebheim mit Heilkräuteranbau und –verarbeitung im Jahre 1933 von außen gesehen hat (Kapitel 18).
Und zum Abschluß dieses Drogenteils noch Geschichten um Baldrian und Eibisch, wie sie vermutlich nur noch ältere Ortsbürger kennen Kapitel 19).
Aus Schweinfurt stammt Johann Michael Fehr, der eigentliche „Held“ des Kapitels 20, der „Geschichte eines verlorenen Paradieses“. Fehr war Mitbegründer der Wissenschaftsgesellschaft „Leopoldina“. Mit den emotionalen Worten seiner Zeit, die an noch ältere Vergangenheiten erinnern, beschreibt er uns ein Paradies und ein Stück Natur in den Fluren Schwebheims, wie es bestand vor den folgenden Jahrhunderten der Industrialisierung und der Umweltmißachtung nach dem biblischen Motto „Macht Euch die Erde untertan“. Ein Schwebheimer Bürger, der Altbürgermeister Fritz Roßteuscher, griff die Bilder eines Johann Michael Fehr auf und brachte für Schwebheim mit viel Mühe, mit vielen Helfern und mit viel Überzeugungsarbeit wenigstens ein kleines Stück Natur zurück.
Beschrieben wird dann ein Lehrpfad, den die Schwebheimer Naturfreunde durch dieses Paradies anlegten (Kapitel 21).
Im Kapitel 22 erleben wir den Altbürgermeister Fritz Roßteuscher, wie er voller Engagement über die ökologische Flurbereinigung in Schwebheim berichtet.
Ausführungen zum Flurbereinigungsdenkmal (Kapitel 23), dem Atomkraftwerk Grafenrheinfeld (Kapitel 24), Gedanken des Autors zu Schwebheims und seines Schlosses Gegenwart und Zukunft (Kapitel 25) und ein Nachruf auf den Ehrenbürgermeister Fritz Roßteuscher (Kapitel 26) folgen.
Noch eine redaktionelle Bemerkung: Fußnoten mit Kleinbuchstaben sind Fußnoten des jeweiligen Originals, numerische Fußnoten stammen vom Autor.
(1) Inzwischen existiert ein von Richard Ludwig und dem Ortsgeschichtlichen Arbeitskreis Schwebheim veranlaßter Nachdruck.
2. Der Name „Schwebheim“
Im folgenden geht es um zwei Theorien zur Entstehung des Namens von Schwebheim. Die eine ist die von Pfarrer Schwarz, gestützt auf die Kompetenz eines Dr. Julius Miedel[2], die andere die eines kritischen Laien auf dem Gebiet der Namensforschung, der sich auf den Wissenschaftler Dr. Joseph Schnetz[3] beruft.
In den „Beiträge zur Geschichte Schwebheims“ des damaligen Schwebheimer Pfarrers Otto Schwarz aus dem Jahre 1903 findet sich ein Kapitel zur Entstehung des Ortsnamens Schwebheim. Dort schreibt Pfarrer Schwarz, und er beruft sich dabei auf einen entsprechenden Schriftverkehr aus dem Jahre 1901 mit einem Oberstudienrat Dr. Julius Miedel aus Memmingen:
Mittelbar geht es also doch auf einen Schwaben zurück, denn nur ein solcher wird seinen Sohn bei der „Taufe“ im Namen den Wunsch haben mit auf den Lebensweg geben können, er möge ein ‚gebietender‘ (waltender) oder ‚glänzender‘ Schwabe werden.“
Als Fritz Wagner, Sohn des ehemaligen Schwebheimer Oberlehrers Hans Wagner, dieses Werk, das zu dieser Zeit nur als handgeschriebenes Manuskript vorlag[4], im Laufe des Jahres 1932 abschrieb, um es somit der Nachwelt zu erhalten, kamen ihm als Laien auf dem Gebiet der Namensforschung Zweifel, ob diese Begründung der Entstehung des Ortsnamens von Schwebheim denn die richtige sei.
Zunächst fand er in dem Manuskript von Pfarrer Schwarz zu verschiedenen Zeiten verschiedene Schreibweisen für das heutige Schwebheim, das, nach Pfarrer Schwarz, erstmals im Jahre 1094 n. Ch. urkundlich mit dem Namen Suebehaim erwähnt wird. An Schreibweisen findet sich im Schwarz’schen Manuskript der Name Svebeheim (1254), Swebeheim (1313), Swebheim (1337, 1341, 1385, 1388 und 1442) und schließlich schon unter den Jahren 1456, 1513, 1515 und 1542 der heutige Name Schwebheim. Verschiedentlich trifft man um die Mitte des 16. Jahrhunderts auch noch auf den Namen Schweben.
Da diese verschiedenen Ortsnamen einige Fragen zur Miedel/ Schwarz’schen–Theorie (hier hätte der Ort ja Swabinheim oder Swebinheim heißen sollen, das Heim eines Swabo) aufwarfen, suchte Fritz Wagner Belege daraufhin für die Swabo–Theorie in der Mundart. Diese Untersuchungen aber führten zu weiteren Zweifeln an der Swabo– Theorie.
Schwebheim wird heute in der Mundart „Schwaam“ ausgesprochen. Sucht man aa–Dialektwörter, so findet man, daß diese sich aus einem alten e entwickelt haben (Leben – Laam, geben – gaam, Weg – Waag, Nebel – Naabl, nehmen – namm, Sessel – Sassl, Ernst – Arnst).
Würde es sich aber um ein durch i zu ä umgelautetes a handeln (ahir zu Aehre), so würde dieses in der Mundart zu einem geschlossenen e bzw. zu einem ä führen (Gäste – Gest, Lämmer – Lemmer, Gräber – Greber, fährt – fehrt, kräftig – krefti, fest – fest, Elle – Ella, besser – besser, legen – läign, heben – häim), also definitiv nicht zu „Schwaam“.
Mit Schreiben vom 27.5.1933 wandte sich Fritz Wagner nun ratsuchend an Dr. Miedel. Leider findet sich dazu keine Antwort. Vermutlich ist auch keine gekommen.
Auf Anraten seines Freundes Dr. Max Ludwig[5] hatte Fritz Wagner bereits am 19.3.1933 Kontakt zu dem Oberstudienrat Dr. Joseph Schnetz aus München aufgenommen.
In einer ersten schnellen Antwort vom April 1933 schloß sich Schnetz der Ansicht Miedels an, daß Schwebheim/Swebehaim soviel sein müsse, wie „Heim des Swabo“. Allerdings war er wegen des konstanten Fehlens des n (Swabinheim etwas verunsichert und bat deshalb um weitere Auskünfte.
So wollte er wissen, ob Schwebheim auf einer Höhe, in einer Niederung oder auf sumpfigem Boden liege.
Ferner wollte er wissen, wie man in Schwebheim mundartlich a) leben, ledig, nehmen, geben und b) legen, Gäste, Lämmer, brennen, heben, fest ausspreche. Sofern ein Unterschied in der Aussprache des betonten Vokals in der a–Reihe gegenüber der b–Reihe bestehe, in welche Reihe passe dann das e von Schwebheim.
Dr. Schnetz erfährt umgehend von Fritz Wagner, daß Schwebheim (218 m über dem Meeresspiegel) im Flachland liege, der Boden zumeist sandig sei, gegen Südosten lehmartig und daß er dann in Moorboden übergehe (Ried).
Die mundartliche Aussprache für die a–Reihe sei laam, läidi, namm und gaam, für die b–Reihe läigen, Gest, Lemmer, brönn, häim und fest. Schwebheim heiße in der Mundart Schwaam und sei somit eindeutig in die a–Reihe einzuordnen.
Die Antwort von Dr. Schnetz kam umgehend und eindeutig: „Da in der Mundart nämlich Schwaam gesprochen wird, kann der Name nicht von dem Personennamen Swabo hergeleitet werden; die Auskunft, die Miedel gegeben hat, ist also falsch; denn das e von Schwebheim gehört zur a–Reihe, das sind aber Wörter, die kein altes a (also nicht Swabo!) gehabt haben“
Ein von Fritz Wagner im Mai 1933 erstellter Abschlußbericht, der von Dr. Schnetz korrigiert wurde und mit ihm abgestimmt ist, faßt dies alles zusammen:
„Herr Oberstudienrat Dr. Jos. Schnetz, München, Herausgeber der Zeitschrift für Ortsnamenforschung (Zonf) und Vorsitzender des Verbandes für Flurnamensammlung in Bayern, kommt zu einem Ergebnis, das die Auffassung von Herrn Dr. Miedel, Memmingen, auf Grund der mundartlichen Verhältnisse widerlegt.
Miedel hatte als Urform ‚Swabinheim‘ angesetzt, also altes a angenommen und geglaubt, daß dieses a durch das folgende i zu e umgelautet worden wäre[6]. Allein Schwebheim wird heute im Dialekt ‚Schwaam‘ gesprochen. Das aa der Mundart kann aber nur aus altem e hervorgegangen sein, wie folgende Beispiele zeigen mögen:
Schreibweise
Heutige Aussprache
leben
laam
nehmen
namm
geben
gaam
Weg
Waag
Sessel
Sassl
Nebel
Naabl
Ernst
Arnst
Das durch i umgelautete a dagegen spiegelt sich in der heutigen Mundart als geschlossenes e wieder; Beispiele hierfür sind:
Schreibweise
Heutige Aussprache
Gäste (aus gasti)
Gest
Lämmer
Lemmer
Gräber
Greber
fährt (aus ahd. farit)
fehrt
kräftig
krefti
fest (aus ahd. fasti)
fest
Elle
Ella
besser
besser
In anderen Fällen erscheint altes umgelautetes a als heutiges ä (legen – läign, heben – häim), aber nie als aa. Die Worte, die früher ein a enthielten, werden also heut mit e gesprochen, zum größten Teil sogar mit einem geschlossenen e.
Es geht daraus hervor, daß in dem Wort Schwebheim auch im Althochdeutschen kein a enthalten gewesen sein kann. Das urkundlich erstmals 1094 auftretende ‚Suebehaim‘ kann sich also nicht aus ‚Suabihaim‘ entwickelt haben, wie Herr Dr. Miedel annimmt. Wenn das Vorkommen des Eigennamens ‚Suabo‘ (ein Leibeigener) sich aus einer Urkunde des Jahres 791[a] ergibt, so ist das kein Grund, diesem Leibeigenen (!) die Entstehung des Ortsnamens zuzuschreiben.
Die mundartliche Aussprache legt vielmehr im Verein mit der Lage des Ortes eine andere Erklärung für die Entstehung des Ortsnamens nahe, die von Herrn Dr. Schnetz vorgeschlagen wurde.
Diese Annahme würde das ‚Suebehaim‘ entstehen lassen aus ‚Suebihaim‘ (ahd. die suebi, mhd. die suebe, nhd. die Schwebe). Das wäre zu verdeutschen: Heim bei der Schwebe. ‚Schwebe‘ muß früher in der Bedeutung ‚schwebender Boden‘ (Boden, der sich unter den Fußtritten hebt und senkt, unfester Boden) gebraucht worden sein, vgl. das Wort ‚Schwebwasen‘, d. i. Wasen, der unter den Fußtritten sich hebt und senkt[b].
Nun befindet sich in der nächsten Umgebung des Ortes das ‚Riedholz‘ mit ausgesprochenem Moorboden auf ausgedehnter Fläche und den sogenannten ‚Gründleslöchern‘ (grundlosen Löchern). Die Gemarkung wird durchschnitten vom Unkenbach, der zu beiden Seiten von sumpfigen Geländestreifen begleitet wird. Im ‚Raflder Holz‘ (Grafenrheinfelder Holz) ist das ‚schwarze Loch‘[7], ein kleiner See, umgeben von moorigem Schilfgelände. Auch der ‚Röstsee‘[8] mit einem Teil seiner Umgebung wäre in diesem Zusammenhang zu erwähnen[9].
Es gibt also in der Gemarkung Schwebheims im Gegensatz zur sonstigen weiteren Umgebung viel Moorland und Sumpfland, wenn die durchgeführte Regulierung des Unkenbaches nach dem Kriege auch einen Teil dieser Gebiete für landwirtschaftliche Zwecke verbessert hat. Aus alten Urkunden, sowie aus den heutigen Flurnamen läßt sich aber ersehen, daß Schwebheim früher mehr Gewässer in der Umgebung hatte als heute. Herr Pfarrer Schwarz berichtet in seinen ‚Beiträgen zur Geschichte Schwebheims‘ von einem Weiher in der Umgebung des Ortes, auf Grund einer Urkunde aus dem Jahre 1094[c] und erwähnt hierbei, daß er ‚nicht allzu klein gewesen sein kann, da sich wenigstens zwei Herren in seinen Besitz teilten‘. Die noch bestehenden Flurnamen ‚Schellensee‘ und ‚Haidseelein‘ erschweren ihm anscheinend das Urteil, wohin er den See verlegen soll. Immerhin geht aus dem Vorhandensein der beiden Flurnamen, von denen der eine für eine Mulde südlich des Ortes und der andere für ein Waldgebiet nördlich von Schwebheim gebraucht wird, hervor, daß der Vorschlag des Herrn Dr. Schnetz bei einer tiefergehenden Erforschung der Geschichte Schwebheims wahrscheinlich noch viel mehr Stützpunkte erhalten würde.
Zusammenfassend läßt sich wohl sagen, daß Schwebheim früher von Moor– bezw. Seengelände umgeben war (Riedholz südlich, ‚Schellensee‘ südlich, ‚Schwarzes Loch‘ westlich, ‚Haidseelein‘ nördlich des Ortes, die Markung selbst durchschnitten vom Unkenbach, der zu beiden Seiten sumpfigen Boden aufweist). Die Lösung des Herrn Dr. Schnetz für die Entstehung des Ortsnamens läßt sich also mit der Lage Schwebheims, das tatsächlich von moorigen Landstrecken umgeben ist, gut erklären und hinreichend begründen[10].“
Soweit die Deutung des Ortsnamens durch Dr. Schnetz. Es ist natürlich schon etwas gewagt, anzunehmen, daß der vor nahezu eintausend Jahren hier gesprochene Dialekt dem des zwanzigsten Jahrhunderts entsprach. Nach einer noch älteren Urkunde geht der Ort Schwebheim sogar auf das Jahr 765 n. C. zurück. Danach wäre die Mundartdeutung noch unwahrscheinlicher. Der Name könnte so auch auf keltischen Urprüngen beruhen. Dann aber bliebe jeder Versuch einer Erklärung mangels sprachlicher Überlieferung vergeblich. Und sicher gibt es mittlerweile noch andere Theorien, vielleicht sogar eine unbestreitbar richtige.
Was aber hinter solch wissenschaftlichen Ergebnissen schon damals an Emotionen stand, dazu diene abschließend noch eine kleine Ergänzung. Auf den Hinweis von Fritz Wagner, er beabsichtige Herrn Dr. Miedel vom Ergebnis der Namensforschung Schwebheims zu unterrichten, schrieb Dr. Schnetz: „…wenn Sie ihm schreiben, ist es besser, mich aus dem Spiele zu lassen. Denn seitdem ich den Dilettantismus, den er in einer gewissen Abhandlung an den Tag gelegt hat, kritisiert habe, ist er auf mich äußerst schlecht zu sprechen und geradezu feindselig gegen mich gestimmt.“
Kaum anzunehmen, daß die Beziehungen zwischen Wissenschaftlern heute grundsätzlich andere sind. Es kommt hinzu, daß mit der fortschreitenden neoliberalen Privatisierung von Forschung und Wissenschaft und den zunehmend knappen Kassen der entsprechenden öffentliche Einrichtungen und Hochschulen wissenschaftliches Arbeiten mehr und mehr vom Geld privater Sponsoren abhängig ist. Diese fordern maximale Rendite ihrer eingesetzten Mittel. So werden noch mehr als vor nahezu hundert Jahren wissenschaftliche Ergebnisse in erster Linie den Auftraggebern und Sponsoren zu besseren Geschäften verhelfen müssen und nicht der Wahrheit, für die es keine Zinsen gibt. Und die gibt es für eine umfassende‚ Ortsnamensforschung eben auch nicht.
(2) Historiker und Archivar der Stadt Memmingen. Lebte von 1863 bis 1940)
(3) Dr. Schnetz (1873 – 1953) Honorarprofessor an der Universität München, gilt als einer der bedeutendsten Namensforscher im deutschsprachigen Raum. Er gründete 1925 die Zeitschrift für Ortsnamenforschung (Zonf) und war Vorsitzender des Verbandes für Flurnamensammlung in Bayern.
(4) Der „Ortsgeschichtliche Arbeitskreis e. V. Schwebheim“ ließ das Manuskript dann im Jahre 2004 endlich drucken.
(5) Dr. Ludwig (1881 – 1944) war ein bekannter Heimatforscher und Begründer des Historischen Vereins Schweinfurt im Jahre 1909.
(6) wie vorne ahir zu Ähre.
(7) Nach Auskunft von Fritz Roßteuscher könnte dieser See auf das Kloster Heidenfeld zurückzuführen sein. Es war ein Überwinterungsgewässer für die Karpfenzucht. Das Sommergewässer befand sich nördlich davon, getrennt durch einen Damm, der auch als Weg diente, mit einem Durchlaß.
Nach einer Legende soll hier vor langer Zeit ein Bauer mit seiner Kutsche versunken sein. Seine Leiche wurde jedoch nie geborgen. Er soll noch heute in jeder Nacht hier sein Unwesen treiben.
(a) Dronke, cod. dipl. Fuls. I, 100.
(b) Schmeller, Bayer. Wörterbuch II, 621.
(8) Dieser Weier ist als Flachsröste angelegt worden. Die geernteten Flachspflanzen wurden hier vor ihrer Verarbeitung mehrere Wochen in das Wasser eingelegt.
(9) Man sollte auch nicht vergessen, daß der über die Jahrtausende wechselnde Lauf des Mains mit seinen Seitenarmen die Grundfeuchtigkeit des Bodens bewirkte. Auf einer Schautafel im Grafenrheinfelder Naturschutzgebiet „Sauerstücksee“ liest man, daß bis nach dem 2. Weltkrieg die Bauern ihre waldnahen Äcker in Richtung Schwebheim wegen Überflutung oft nicht betreten konnten.
(10) Ein weiteres Indiz für diesen Charakter der Landschaft könnten die Schnakenplagen früherer Jahre sein, für die Schwebheim berüchtigt war.
(c) Mon. Boic. XXXI, 197.
3. Schwebheim in Chroniken seiner Vergangenheit
3.1. Ortschronik der Landgemeinde Schwebheim
3.1.1. Vorbemerkungen
Unter dem Titel „Statistische Beschreibung und Ortschronik der Landgemeinde Schwebheim, königlichen Landgerichts Schweinfurt“ erstellte Friedrich Johann Wagner im Jahre 1860 diese Ortschronik. Sie wurde einige Jahre später bis einschließlich des Jahres 1886 von Heinrich Kaiser fortgeführt.
Friedrich Johann Wagner (1800 bis 1878) war Lehrer in Schwebheim von 1829 bis 1870. Er handelte bei der Aufzeichnung der Ortschronik wahrscheinlich im Auftrag der Gemeinde, denn sie wurde am 3. Mai 1860 vom damaligen Bürgermeister Johann Georg Neinhardt, dem Gemeindepfleger und drei weiteren Mitgliedern des Gemeindegremiums unterzeichnet. Damit erhielt die Chronik einen amtlichen Charakter.
Heinrich Kaiser (1840 bis 1886), Schwiegersohn von Friedrich Wagner, war dessen Nachfolger als Lehrer in Schwebheim, und zwar von 1870 bis 1886.
Die folgende Abschrift basiert auf einer Abschrift von Fritz Wagner [11]aus Schwebheim.
(11) Neffe des in Kapitel 2 genannten Fritz Wagner.
3.1.2. Bezüglich der statistischen Verhältnisse[12]
Über den Ursprung und die Bedeutung des dahiesigen Orts namens „Schwebheim“ können keine zuverlässigen Nachweise aufgefunden und angegeben werden, da alle Urkunden und Hilfsquellen hierfür gänzlich mangeln. Muthmaßlich jedoch dürfte der Ortsname Schwebheim aus Suebenheim, Schwabenheim und letztlich Schwäbheim entstanden sein.
Die Zeit der Bildung der dahiesigen Gemeinde läßt sich nicht mit Gewißheit bestimmen, da gleichfalls sichere Nachweise hierfür nicht vorhanden sind. Ein in gutsherrlichen Archiven dahier vorhandener, aber erst anfangs der 1830er Jahre gefertigter Stammbaum beginnt mit einem gewissen Hans von Bibra, welcher im Jahre 1354 schon Besitzer des dahiesigen Burgschlosses und des damit verbundenen Rittergutes war.
Über die gleichzeitig örtlichen Verhältnisse überhaupt schwebt aber ein Dunkel, wiewohl ohne Zweifel um jene Zeit und gewiß schon früher ein Gemeinwesen auch von noch so kleinem Umfang, dahier bestanden hat.
Nach einer alten Sage soll anfänglich und vor vielleicht länger als 400 Jahren – exclusive der Ortsherrschaft mit ihrem Grundbesitze und mit ihrer Dienerschaft – der Umfang der Gemeindeglieder und ihres Grundbesitzes aus 7 Familien und 7 großen geschlossenen Bauernhöfen/ Gütern, von denen nur noch eine, zu Haus–Nr. 5 gehörig, als vollkommen geschlossen vorhanden ist, dann aus mehreren Beisassen und Schutzverwandten–Familien bestanden haben, welche anfängliche Bevölkerung auf eine Seelenzahl von höchstens 150 Seelen schließen läßt. Diese Sage von ursprünglich 7 Bauernhöfen möchte dadurch ziemlich annähernd als wahr empfunden werden, daß heute noch im Kirchhof zur Seite gegen Mittag 5 alte Gebäude, Gäden genannt, stehen, von denen jedes einen Keller und einen Speicher hat, dann daß an der Stelle der jetzigen Sacristei in frühester Zeit wirklich auch an dem Kirchthurm ein solcher Gaden angebaut war, und höchstwahrscheinlich ein siebenter an einem anderen Ort des Kirchhofs in frühester Zeit wegen Benützung des Platzes zu einem anderen Zwecke niedergerissen wurde. Später und zwar vor etwa nahe an 200 Jahren nahm die Gemeinde insoferne eine andere Gestalt an, als man anfing, öde Gemeindegründe als Artfeld und Wiesen zu cultivieren und solche in gleichen Anteilen mit 42 Hausnummern und resp. Hofriethen zu verbinden. Eine solche Hofrieth mit diesen einverleibten Gemeindetheilen hieß derzeit eine Sölde oder ein Söldengut, das noch bis jetzt als ein geschlossenes Ganzes betrachtet wird, und da diese Gemeindetheile genannt: große Gereuth, kleine Gereuth, Garten, große und kleine Blöß, große und kleine Rasen, obere, mittlere und untere Haid, Mählein, große, kleine und lange Wahl, seit unvordenklichen Zeiten immer in der Eigenschaft als Eigenthum durch Vererbung, Gutsabtretung, Verkauf und Tausch, von einem Besitzer auf den anderen übergingen, so wurde aus diesem ursprünglich gemeindlichen Grundbesitz mit der Zeit ein Privatgrundbesitz, welches letztere Verhältniß dahier zur Zeit noch fortbesteht und sich nun auf die einzelnen Grundsteuer–Cataster gründet.
Die Vertheilung dieser Gemeindeödungen ging aber nicht auf einmal, sondern im Verlaufe von etwa nahe an 200 Jahren zu verschiedenen Zeiten theilweise vor sich. In den Grundsteuer–Catastern sind diese in den frühesten Jahren vertheilten Gemeindeödungen unter dem Namen „Gemeindeantheile“ aufgeführt. Solche Gemeindeantheile, wie sie mit einem Söldengute verbunden sind, befinden sich auch bei dem Grundbesitze der Pfarreistiftung zu Schwebheim.
Nur die 42 Söldengutbesitzer waren von den frühesten Zeiten her und noch bis zum Jahre 1820 wirkliche Gemeindeglieder/ Ortsnachbarn/ und allein berechtigte Nutznießer des gemeindlichen Eigenthums. Alle übrigen Familien waren Beisassen oder gutsherrliche Schutzverwandte und vom Genusse genannter Rechte und Wohlthaten ausgeschlossen. Erst im Jahre 1820 löste sich dieses Verhältniß, und wurden von da an alle wirklich hier ansässigen Familien, die eine directe Steuer zahlten, auch wirkliche Gemeindeglieder, sohin auch gleichberechtigte Nutznießer der gemeindlichen Rechte und Wohlthaten, aber auch gleichverpflichtete Träger der gemeindlichen Lasten.
Zu Anfang der Bildung der dahiesigen Gemeinde aus 42 Söldnern mag mit Einrechnung der Beisassen und Schutzverwandten die Bevölkerung des Orts etwa 300 Seelen oder etwa 60 Familien gezählt haben.
Zur Gemeinde Schwebheim gehört auch die eine kleine halbe Stunde von hier gegen Grettstadt zu liegende Unkenmühle, dann die in der Nähe des Orts gegen Schweinfurt zu liegende Dorfmühle mit dem kleinen Weiler Aschenhütte.
Die Unkenmühle, welche am Unkenbache liegt, wurde im Jahre 1698 auf freiherrlich von Bibraische Grund und Boden erbaut und ging alsbald mit einigem, die Mühle umgebenden Grundbesitz durch Übernahme von Grundzinsen und Gülten an Privateigenthümer über. Der erste Besitzer dieser Mühle, welcher solche 1698 auf seine eigene Rechnung erbaut hat, war Hans Schwarz.
Die Dorfmühle, anfänglich neue Mühle genannt, wurde etwa um die Zeit 1650 gleichfalls auf gutsherrlichem Grund und Boden erbaut und sind Hans Andreä Irmißgebet sodann Wilhelm Heuring als erstbekannte Eigenthümer und Besitzer in alten Urkunden aufgeführt, die auf solche die Entrichtung von jährlichen Grundzinsen und Gülten übernommen haben.
Der kleine Weiler „Aschenhütte“ ist erst seit dem Jahre 1832 durch Aufführung von 9 Wohnhäusern entstanden. Der Name „Aschenhütte“ kommt von dem noch stehenden zweistöckigen Wohnhause, Haus–Nr. 80 und Aschenhütte genannt, weil in früheren Jahren in solcher Aschensiederei getrieben wurde, her. Dieses Aschenhüttengebäude war aber in frühester Zeit und noch bis zum Anfang der 1770er Jahre ein zweites Gastwirthshaus für die Gemeinde Schwebheim und mit einem gegenübergestandenen Brauhause Eigenthum der freiherrlich von Bibraischen Gutsherrschaft, und soll den Namen „das neue Wirthshaus“ geführt haben. Anfangs der 1770er Jahren wurde diese Gastwirtschaftgerechtsame von da hinweg in den Ort gezogen und mit dem Söldnergute und Wirthshause im Orte Hs.Nr. 69 vereinigt.
Der Gastwirth Bernhard Schneider Hs.Nr 69 ist nun Besitzer dieser Gastwirthschaft, sowie der erwähnten vormals gutsherrlichen Brauerei– Reale in seiner Behausung; das alte Brauhaus an der Aschenhütte wurde aber vor mehreren Jahren niedergerissen.
Die Gemeindemarkung Schwebheim grenzt gegen Morgen an die Gemeindemarkungen von Gochsheim und Grettstadt, gegen Mittag an die Gemeindemarkungen von Unterspießheim und Heidenfeld, gegen Abend an die Gemeindemarkungen Heidenfeld, Röthlein und Grafenrheinfeld und gegen Mitternacht an die Gemeindemarkung von Gochsheim.
Im Jahre 1750 hatte die Gemeinde Schwebheim etwa 75 Familien und 450 Seelen. Die Familien– und Seelenzahl besteht seit den frühesten Zeiten aus Protestanten, Katholiken und Juden. Die Protestanten machen aber die Mehrzahl aus.
Die Gemeinde Schwebheim war bis zum Jahre 1587 ein Fial von Gochsheim und wurde von einem Kaplan versehen, der von Gochsheim hierher kam. Im genannten Jahre aber bekannte sich der größere Theil der Familien und Einwohner zur Augsburgischen Konfession und bekam auch noch in demselben Jahre einen eigenen Pfarrer Namens Wolfgang Dintemann von Koburg. Im Jahre 1587 wurde auch das vorige bis zum Jahre 1830 noch bestandene alte Pfarrhaus neu aufgebaut. Nach Inhalt der Schweinfurter Chronik von Mählich und Hahn gab ihm der damalige Dorfherr Freiherr Heinrich von Bibra, welcher der evangelisch–lutherischen Kirche zugetan war, 10 Malter Korn und 10 fl. Geld, die Gemeinde aber 8 Malter Korn und 8 fl. Geld als Besoldung. Diese Besoldungstheile haben jedoch später eine Änderung erlitten und hat sich später die Pfarrbesoldung ganz neu gestaltet. Der Zeit ist Schwebheim eine Pfarrei mit einem protestantischen Pfarramte geblieben. Die katholischen Einwohner gingen nach Röthlein zur Kirche, wurden aber erst im Jahre 1833 förmlich dahin ausgepfarrt. Bis zu deren Auspfarrung wurden sie nach protestant. Ritus getauft, copuliert und beerdigt und zwar gegen Entrichtung der hierorts üblichen Gebühren.
Protestanten, Katholiken und Juden sind in Bezug auf gemeindliches Vermögen und politisch–gemeindlicher Interessen gegenseitig gleichberechtigt und gleichgestellt; das dahiesige Kirchenvermögen aber ist ausschließend einzig und allein nur Eigenthum der evangelisch–lutherischen Kirchengemeinde Schwebheim, und wurde dieses Recht bis jetzt von Seite der Katholiken auch niemals angefochten.
Der Begräbnisplatz für Protestanten und Katholiken war von jeher ein gemeinschaftlicher. Bei Auspfarrung der Katholiken im Jahre 1833 wurde gerichtlich festgestellt, daß diese nur die Hälfte des herkömmlichen jährlichen Quartalkorns und Gelds für Pfarrer– und Schullehrerbesoldung, sohin nur jenes im Interesse der Schule der protestantischen Schulstelle, die ihre Kinder von jeher mitbesuchen, entrichten, dann daß bei dem Leichenbegängnis eines Katholiken anfangs ein Zeichen mit der größten Glocke gegeben, beim Leichenzuge selbst gleich wie bei dem Leichenbegängniß eines Protestanten mit allen Glocken zusammengeläutet wird. Die betreffenden Auspfarrungsakte liegen bei den Akten des kgl. Landgerichts in Schweinfurt. Zwischen den verschiedenen Confessionsgenossen dahier herrscht von jeher Friede, brüderliche Liebe und Eintracht.
Die Gemeinde Schwebheim besitzt an gemeinheitlichen Gebäuden:
a) Ein neues 2stöckiges Pfarrhaus Hs.Nr.14 mit Scheune, Hofrieth, Holzhalle, Brunnen und Hausgarten, dann Keller unter der Schullehrerwohnung; das Pfarrhaus wurde 1833 neu gebaut.
Ein zweistöckiges Schulhaus mit Unterrichtszimmer zur Seite Kirche Hs.Nr. 59, mit Stallung, Heuboden, Waschhaus und Holzremise. Die Räumlichkeit des ersten Stockwerks im Schulgebäude nimmt übrigens ein Kellergewölbe und das Waschhaus ein. Das Schulhaus befindet sich im mittelmäßigen Zustande.
c) Ein Gemeinderathhauszimmer im 2ten Stocke oberhalb des Bäckerhauses Hs.Nr. 9, sehr beengt, alt und fast baufällig.
d) Ein Kirchthurm von Mauerwerk, viereckig, unförmig und mit baufälliger Bedachung. Kuppeldach gemauert mit einer Thurmuhr und 3er Glocken zu 8, 5 und 2 Centner schwer, mitten im Orte mit angebauter Kirche und seitherigem alten Leichenhof. Um 1662 wurde wahrscheinlich der Kirchthurm erhöht.
e) Ein einstöckiges unbedeutendes Hirten– und Armenhaus, Hs. Nr. 33 mit Schweinestall und
f) Ein Gaden. Öekonomiegebäude im Kirchhofe.
Ferner besitzt dieselbe folgende Stiftungsgebäude:
Eine Kirche/Langhaus/ Hs.Nr. 58, für die damalige Kirchengemeinde fast zu klein, sonst aber in ganz gutem baulichen Zustande mit Sacristei und Stiegenhaus, an schon erwähntem Kirchthurme angebaut.
Die Kirche ist mit folgenden Alterthumsdenkmälern geziert:
1. Innerhalb des Chors (Thurmes) der Kirche befindet sich an der Wand ein eingemauerter Stein mit der Jahreszahl 1494 mit einem erhabenen ausgehauenen Sacramentshäuschen und einer Monstranz von zweien Engeln gehalten.
2. Gleich zur Seite des vorigen Steines oberhalb der Sacristeithür befindet sich ein Gedenkstein mit einer ausgehauenen Überschrift, Inhalts deren ein gewisser Heinrich von Bibra im Jahre 1571 dieses Gotteshaus mit allen seinen Gebäuden wieder aufgebaut hat.
3. Ein aufrechtstehender Grabstein bei den Mädchenbänken, welcher mit Eisenklammern an der Wand befestigt ist und sich im Schiffe der Kirche befindet, hat mehrere erhaben ausgehauene adelige Wappen, die Darstellung einer Burgschlosses und mehrere trauernde Frauen vor einem Crucifix, und wurde einer gewissen Veronica von Bibra geb. von Erthal im Jahre 1600 zum Gedächtnis gesetzt.
4. Auf der entgegengesetzten Seite befindet sich ein eingemauerter Stein, welcher die adeligen Familien–Wappen von Bibra und Buttlar darstellt. Die Jahrzahl ist jedoch verwittert.
5. Oberhalb der beiden Hauptthüren befinden sich erhaben ausgehauene Steine eingemauert mit den Bildnissen: Christus am Kreuze und zu beiden Seite, Joseph und Maria. Der eine Stein trägt die Jahrzahl 1576 und der andere 1581. Auf beiden Steinen ist der Name Heinrich von Bibra eingehauen.
6. Innerhalb des Leichenhofes am Thurme befindet sich ein Ritter in Lebensgröße aus Stein gehauen aufgerichtet, mit der Inschrift, daß Hans Caspar Truchseß von Henneberg zum Herleshof am 21. Mai 1591 dahier gestorben ist. Dieser Stein stand früher in der Kirche bei den Mädchenbänken. Nach einer alten Sage ist dieser Truchseß im 21. Lebensjahre während eines Tanzes urplötzlich an einem Schlaganfalle dahier gestorben.
Das Verhältniß der Gemeinde Schwebheim zu den Nachbargemeinden ist ein sehr freundliches und friedliches, welches wohl seit 60 Jahren durch keine Grenzstreitigkeit gestört worden ist. Die Markungsgrenzen sind richtig versteint und steht deshalb für die Folge eine Grenzstreitigkeit gar nicht mehr zu erwarten.
Die sogenannten 80 Morgen gemeindlicher Hutrasen auf Schwebheimer Markung, welche seit 1813 urbar gemacht wurden und von welchen derzeit 62 Morgen als Artfeld verpachtete werden, waren mit einem anderen Theile Hutrasen auf Heidenfelder Markung in früheren Jahren eine Koppelgutgerechtsame zwischen der Cantonie Heidenfeld und der Gemeinde daselbst eines Theils, dann den freiherrlichen Gebrüdern von Bibra zu Schwebheim und der Gemeinde daselbst anderen Theils. Lt. einer dahin in der gemeindlichen Registratur vorhandenen Vergleichsurkunde vom 8. Oktober 1800 kam aber eine Theilung und Ausgleichung dahin zu Stande, daß hiesige Gemeinde auf ihren Antheil obige 80 Morgen erhielt, von denen jedoch die hiesige adelige Gutsherrschaft 18 Morgen unentgeltlich in Nutzung hat und zwar als Anspruch für ihre frühere Hutgerechtsame.
Wirft man einen vergleichenden Rückblick der gegenwärtigen Bevölkerung auf jene der Vorzeit, so ergibt sich ziemlich genau als wahr annehmbares Resultat, daß vor etwa 400 Jahren gegen jetzt die Familien– und Seelenzahl etwa die Hälfte der gegenwärtigen Bevölkerung, die nach der letzten Volkszählung 115 Familien und 668 Seelen nachweist, betragen haben mag.
Der Nahrungsstand ist im allgemeinen dahier ganz gut. Selbst die vielen geringen Tagelöhnerfamilien finden dahier das Jahr hindurch fast unausgesetzt Arbeitsgelegenheit und Verdienste. Jedoch aber gibt es neben der so ziemlichen Wohlhabenheit vieler dahiesigen Familien auch eine ziemliche Anzahl ortsangehöriger Familien und Einzelpersonen, die äußerst wenig oder gar kein Vermögen besitzen und sich und die Ihrigen auf sehr dürftige Weise nähren müssen.
Die Ertragsfähigkeit des Bodens auf hiesiger Gemarkung ist etwa zur Hälfte sehr gut, zu ¼ gut und zu ¼ gering.
Auf immer bessere Cultivierung und Tragbarkeit des Bodens wird dahier viel Fleiß verwendet, ja der industrielle Fleiß der dahiesigen Landwirthe im Allgemeinen ist nur zu loben und hat sich gegen früheren Jahren bedeutend gehoben. Auf Hebung des Kleebaues und Verbesserung der Wiesen wird namentlich viel Fleiß verwendet. Mit Ausschluß des so bedeutenden Grundbesitzes des Gutsherrn Ernst Freiherrn von Bibra zu 432½Tgew. –Dez. Artfeld[13], 80Tgew. Wiesen und 352½Tgew. Waldungen, stellt sich das Verhältniß des Privatbesitzes zur Familienzahl nach den einzelnen Abtheilungen nach Artfeld, Wiesen und Krautfeld in der Weise heraus, daß auf je eine von 115 Familien 10Tgew. Artfeld, 2Tgew. Wiesen und 1/12Tgew. Krautfeld oder Gartenland kommt.
Das dahiesige Gemeindevermögen umfaßt:
87Tgew. 67Dez. Gemeindewaldung, die sich im besten forstwirtschaftlichen Stande befindet, dann
54Tgew. 23Dez. Artfeld. Welches theilweise als Besoldungsgrundstücke benützt, größtentheils aber in Pacht hingegeben wird und sich im Interesse der Gemeinde sehr gut rentiert, und
36Tgew. 72Dez. Wiesen, die mit Ausnahme weniger Besoldungsgrundstücke gleichfalls sehr vorteilhaft verpachtet werden. In eigener Regie werden nur Waldungen bewirtschaftet, bei den Artfeldern und Wiesen scheint das nicht vorteilhaft.
Wiesenbewässerungen sind daher nicht notwendig, weil auf dahiesiger Markung die Wiesen überhaupt nach ihrer Lage ohnedies die erforderliche Feuchtigkeit haben. Dammbauaufführungen sind daher gleichfalls entbehrlich. Für Herstellung der nöthigen Wasserabzugsgräben ist da, wo es nöthig ist, allenthalben gesorgt.
Die dahier vorhandenen Wasserkräfte sind allenthalben reichlich benutzt. Im Orte selbst sind drei öffentliche Gemeindebrunnen und an der Aschenhütte sind zwei öffentliche Brunnen. Außerdem zählt der Ort Schwebheim eine Menge Privatbrunnen. Eigentlich wirklicher Wassermangel war selbst in den letzten 3 Jahren 1857, 1858 und 1859 dahier niemals. Die Brunnen werden stets in gutem Stand erhalten.
Der Verbindungsweg von Schweinfurt über Schwebheim nach Unterspießheim ist durchgängig eine Chaussee im besten Stande. Auch die Straße von hier nach Röthlein ist gut chaussiert. Der Verbindungsweg von hier nach Gochsheim ist thunlichst fahrbar hergestellt, aber nicht chaussiert. Das selbe ist auch bei dem Verbindungswege von hier nach Grettstadt der Fall. Weitere Verbindungswege sind dahier nicht vorhanden.
(12) Von Lehrer Friedrich Wagner
(13) Ein Tagwerk (Tgew.) hat eine Größe von 3.407,27m2, ein Dezimal (Dez.) ist der hundertste Teil eines Tagwerks.
3.1.3. Ortsgeschichtliche Darstellung – Chronik[14]
Merkwürdigkeiten, welche sich seit Entstehung der Gemeinde Schwebheim und bis zum Jahre 1500 an dahiesigem Ort ereignet haben, können für diesen Zeitraum gar keine aufgeführt werden, da hierfür die sogenannten Orts– und Volkssagen, sowie auch wirklich urkundliche oder geschichtlich nachweisbare Thatsachen gänzlich mangeln.
Erst vom Jahre 1525 anfangend gibt ein Gedenkstein, welcher in einer Seitenmauer des großen Schlosses des adeligen Gutsherrn Ernst Freiherrn von Bibra eingemauert ist, den Aufschluß, daß die beiden nebeneinander gestandenen Schlösser durch den Bauernaufruhr – im Bauernkrieg – abgebrannt hier aber vom Jahr 1526 anfangend von Hans von Bibra wieder aufgebaut wurden. Durch diesen Brand ist auch das damalige gutsherrliche Archiv mit allen seinen früheren Documenten ein Raub der Flammen geworden. Von dieser Zeit an bis zum Jahre 1587 kann gleichfalls nichts Geschichtlich merkwürdiges aufgeführt werden.
Mit der Gründung der protestantischen Pfarrei Schwebheim im Jahre 1587 war auch bis auf diesen Tag das Präsentationsrecht in Händen der jedesmaligen Herrschaft.
Die Reihenfoge der evangelisch–lutherischen Pfarrer bis zum heutigen Tag ist folgende:
1. Wolfgang Dintemann, angestellt im Jahre 1587 von Heinrich von Bibra, welcher auch der evangelisch–lutherischen Kirche zugetan war.
2. Der 2te Pfarrer war Nikolaus Volkmar, Schwiegersohn des vorigen Pfarrers von 1596 bis 1602.
Im Jahre 1602 haben Hans von Bibra zu Obereuerburg/Obereuerheim und dessen Gemahlin Maria Christina von Bibra geb. von Geiso den vorhandenen großen silbernen und vergoldeten Abendmahlskelch in dahiesiger Kirche gestiftet, was die unten am Fuße des Kelchs auf eine silberne Platte eingravierte Inschrift mit von Bibra und von Geiso Familienwappen besagen.
3. Der 3te Pfarrer Valentin Burger aus Schweinfurt war bis 1609 Pfarrer in Schwebheim. Unter ihm blieben 10 Kinder ungetauft, doch ohne seine Schuld, wie er selbst im Taufkalender bemerkte und sind auch ohne christliche, sonst gebräuchliche Ceremonien begraben worden.
4. Ihm folgte Johann Zehner aus dem Hennebergischen bis zum Jahre 1613.
5. Kaspar Haas aus Schweinfurt, der hierauf bis zum Jahre 1633 Pfarrer in Schwebheim gewesen ist, hat außer dem Schrecken des 30jährigen Krieges auch schwere Verfolgungen von den Heidenfelder Mönchen erlitten und wurde wahrscheinlich in Folge daran vertrieben. Nach einer Sage, die sich noch erhalten hat, flüchtete er sich, in einem Fuder Erbsenstroh versteckt, nach Schweinfurt. Hier mag das Erlebniß genannten Pfarrers und seiner Gemeinde im Jahre 1631 im wörtlichen Auszuge aus dem Pfarrbuche dahiesiger Pfarrei folgen[15]: „Traurige Ereignisse hat der 30jährige Krieg auch über Schwebheim gebracht. Ausgezeichnet ist das Jahr 1631, worüber auf Anordnung des damaligen Gutsherrn Valentin Hector von Bibra ein von einem kaiserlichen Notar zur Hälfte auf Pergament geschriebenes Instrument und eine getreue Copie hiervon hinlänglich Aufschluß geben. Inhalts derselben kamen an einem Sonntage den 6. Februar 1631 früh zwischen 9 und 10 Uhr, als man eben in die Kirche gehen wollte, der fürstlich Würzburgische Vogt zu Mainberg, Johann Hawmann und der Centgraf zu Gochsheim Hans Unser, neben dem Herrn Prior und Dechant zu Heidenfeld mit etlichen Würzburgischen Ausschuß, deren bei 100 Musquetieren ungefähr gewesen, fielen in Schwebheim ein und prädantierten zu verschiedenen Malen auf fürstlich– Würzburgischem Befehl die Kirchenschlüssel. Als diese ihnen verweigert wurden, verlangten sie von Kaiserlichen Soldaten, Holsteinische Compagnie, die damals in Schwebheim einquartiert lagen, sie sollten die Schlüssel mit Gewalt abnöthigen, was ihnen aber abgeschlagen wurde. Als ihrem Ansinnen kein Genüge geschah, haben sie mit Gewalt die äußere Kirchenthür geöffnet. Als hierauf der Gutsherr solches erfuhr, hat er durch seinen Diener incontinenti darwider protestieren lassen, hat ihm der Vogt geantwortet: Man hätte anjetzo nichts mit Bratwürsten zu thun, und ist darauf in die Kirche gedrungen. Die Sacristeithüre wurde hierauf ebenfalls mit Gewalt geöffnet und zwar, weil ein Zimmermann mit einem „Beihell“ es nicht vermochte, mit einem tischlangen Block, wobei die Thüre in zwei Stücke zersprang. Mit einem „Büschel Schrenker“ wollte nun der Probst von Heidenfeld eine Truhe in der Sacristei, darinnen der Kirchenornat verwahrt gewesen, öffnen. Ein dabeistehender kaiserlicher Fenderich habe dagegen bemerken wollen: „Solche Schlüssel zu führen sei nicht einmal den Soldaten erlaubt. Im Ländlein ob der Enns sei deshalb ein Soldat gehenkt worden.“ Da aber auch mit den Schrenkern die Truhe nicht geöffnet werden konnte, haben sie dieselbe umgeworfen und zerbrochen, die darin befindlichen „Hostien“ auf die Erde geworfen und mit Füßen darauf getreten. Ein silberner und vergoldeter Kelch samt Patine, darauf 3 Wappen, unter anderem auch das Heinrich von Bibraische mit der Jahrzahl 1584, in welchem Jahr sie renoviert wurde, ein zinnernes Receptaculum, „so sie ein Salzfaß genannt“, zwei Meßgewänther, zwei Alben, worüber der Herr Probst seinen Spott hatte, ein Rauchfaß, zwei große messinge Leuchter und das Kanzeltuch, das sie abgerissen, wurde in ihre Kutsche gepackt und mitgenommen.
Über diese Art zu reformieren äußerte sich selbst ein gefreiter Corporal, der der römisch–katholischen Religion ganz eifrig zugethan war, unzufrieden.
Am 7. Februar wurde von demselben Notar 8 Schwebheimer Einwohner im Schlosse zu Protokoll vernommen, welche aussagten:
Testis 1 Alexius Feller: Er sei am Sonntag morgens – 6. Februar – in seinem Hause von 10 Musquetiren, welche mit einer Axt die Hausthüre in gewaltthätiger Weise öffneten, unversehens überfallen, mit den Musqueten hart geschlagen und endlich nach vielem Verweigern neben zween Weibspersonen mit Gewalt in die Kirche geschleppt worden, den katholischen Kirchendienst anzuhören und nieder zu knien. Bei welcher Gelegenheit Herr Probst von Heidenfeld Messe gehalten. Nach dieser habe der Voigt einen schriftlichen Würzburgischen Befehl abgelesen, darinnen gestanden: Die Pfarr zu Schwebheim betr. sollten sie wissen, daß so fürter in der Gemein etwas wegen Hochzeiten, Kindstaufen, Begräbnissen und dergleichen vorging, sollte von Heidenfeld aus verrichtet, und die jährlichen geistigen Gefälle allezeit ins Kloster dahin gegeben werden, sollten hierfüro ihrer Pfarrer meiden, oder bei ernster Strafe eines anderen gewarten. Hierzu sollte ihnen Bedenkzeit bis künftige Ostern zugelassen sein. Unterdessen aber wollten sie den Junkerherrn an seiner Gerechtigkeit gar nichts nehmen, wären auch deshalb nicht, sondern nur allein der Geistlichkeit wegen dahie gekommen.
Testis 2 Nikolaus Werner bezeugt: Ähnliches auch noch Ärgeres erfahren zu haben. Bei ihm hätten 10 vom Ausschuß auch die Stubenthüren zerschlagen und ihm und den seinen gedroht, daß, wenn sie sich mit ihm zu gehen weigerten, sie zu Boden geschlagen würden. Zu dem obigen fügt er hinzu, daß auch ein Mönch, der neben Herrn Probst gestanden, Maß gehalten.
Testis 3 Hans Bartl, ein Greis von 88 Jahren, bezeugt: Musquetire hätten ihn aus dem Bette gerissen, und weil er nicht hätte gehen wollen, haben ihn 4 bis zur Kirchenthüre getragen. Er begehrte von ihnen, sie sollten ihn erschießen oder erschlagen, er könne doch nicht gehen. Sein Sohn, der seinen Vater auf dem Kirchthurme schreien hörte, eilte zu ihm und bat ihn, doch zu gehen, dem er folgte. Wegen Harthörigkeit und Bestürzung hat er in der Kirche nicht viel verstanden, als daß man die neuen Feiertage halten solle und daß etliche vom Ausschuß über ihn als Alten spotteten. Bemerkt wird von ihm noch, er sei mit vielen erbärmlichen Thränen nach Hause geschlichen.
Testis 4 Valentin Kessler sagt aus: Der Ausschuß habe ihn auf freier Strasse ergriffen, er aber sei auf den Kirchthurm geflüchtet, von wo aus er den alten Kümmel (Testis 3) wie ein unvernünftiges Vieh schleppen sehen. Von den Vorfällen in der Kirche wisse er nichts.
Testis 5 Hans Bartl, Sohn von Nr. 3, wurde, während er seinem alten Vater zu Hilfe kam, mit in die Kirche geschleppt und bestätigt die Aussage von dem Vorigen.
Testis 6 Hans Mann. Weil er den 5 Musquetiren, die mit Gewalt in sein Haus drangen, nicht zur Kirche habe folgen wollen, sei er mit einer Musquete an Kopf, Arm und in die rechte Seite geschlagen worden.
Testis 7 Hans Schäfers Eheweib hat Gleiches erfahren.
Testis 8 Michael Pfisters Wittib haben sie fortgeschleppt, in der Meinung, selbige in die Kirche zu bringen, als sie aber nit folgen wollte, haben sie dieselbe alsbald im Schweinestall versteckt. Das Pfarrhaus und die Kirche wurden von dem Tage an von 8 Mann Würzburger Ausschuß Tag und Nacht bewacht.
6. Von 1633 an folgt dem Vorigen der Pfarrer Lorenz Gundemann bis 1635. Mit diesem Jahre trat ein trauriges 6jähriges Interim für die Gemeinde Schwebheim ein. Von 1635 bis 1641 war kein Seelsorger im Orte, auch war die Gemeinde meistens zerstreut, denn der schwere Krieg und das damit verknüpfte Elend verscheuchten den Hirten mit der Herde.
7. 1641 kam Nikolaus Höhn als Pfarrer nach Schwebheim. Derselbe sagt: Sequentibus annis, nämlich von 1635 an, usque miserarum rerum statum tristissimam mortio (es wüthete die Pest und mit ihr die Viehseuche) et mortio saevitiam et subditorum hinc inde dispersionem extremamque paupertatem[16] (1 Malter Korn kostete 10 Thaler, 1 Laib Brot 1 Thaler, 1 Viertel von 1 Kalb 2 Thaler. Viele Leute nährten sich von Kleie, Wicken, Eicheln, gesottenem Grase, das weder gesalzen noch geschmalzt war, ja mit verrecktem Pferd– und Rindfleisch.)
8. Von 1643 bis 1645 war Johann Hartmann Rosenfelder aus Römhild Pfarrer dahier.
9. Christian Winter, ein Meißner, von 1645 bis 1649, der die Tage des langersehnten Friedens erlebte. Das Friedensfest von 1648 wurde dahier kirchlich gefeiert.
10. Auch Konrad Schultes von Coburg ist von 1649 bis 1651 Pfarrer dahier, sodann
11. Daniel Stepf aus Schweinfurt von 1651 bis 1655, und
12. Johann Oswald Krüger aus Greifenau 1656
13. Christian Eirich Worms aus Kirchberg wirkte von 1657 bis 1674
14. Abraham Johann Hofmann aus Ilmenau führte hier auch das Pfarramt bis 1678
15. Johann Link Pfarrer dahier von 1678 bis 1684
16. Jakob Münch aus Volkershausen war dahier Pfarrer von 1684 bis 1694. In seine Amtsführung fällt das erste Kirchenjubelfest 1687
17. Von 1694 bis 1714 verwaltete M.J.Elias Thaut aus Schweinfurt das Seelsorgeramt dahier.
18. Folgt dem Vorigen von 1714 bis 1738 Johann Imhof aus dem Bayreuthischen
19. von 1738 – 1740 sind Johann Stemph
20. von 1740 – 1745 W.Ch. Limbach
21. von 1745 – 1749 Joh. Mich. Fichtel
22. von 1749 – 1772 Gg. Daniel Haas alle vier aus Schweinfurt, Pfarrer dahier gewesen
23. des letzteren Nachfolger ist Fr. Peter Weiß aus Schwäbisch–Hall von 1772 – 1784
24. von 1784 – 1788 war Pfarrer J.–Gg. K. Walther aus dem Anspachischen Pfarrer in Schwebheim, welcher im Jahre 1788 Pfarrer in Sennfeld wurde und von dem noch eine gedruckte Kirchweihjubelpredigt von 1787 vorhanden ist.
25. Von 1788 bis 1827 war Johann David Crusius von Gülchsheim Pfarrer in Schwebheim und starb dahier.
26. Von 1828 bis 1831 war Johann Albrecht Höfer von Erlangen Pfarrer in Schwebheim, welcher dann Pfarrer zu Schweinfurt wurde.
27. Von 1831 bis 1834 war Johann Wolfgang Schmidt aus Unterbürg Pfarrer dahier und kam darnach nach Üttingen bei Würtburg.
28. Von 1835 bis 1844 war Carl Wilhelm Denger von Schweinfurt Pfarrer dahier und kam darauf nach Zeilitzheim.
29. Vom Jahre 1844 bis 1851 war Heinrich Thomas von Rügheim Pfarrer dahier und kam darauf nach Ermershausen
30. Seit 1851 ist Johann Adam Schmidt aus Bayreuth Pfarrer dahier.
Von anno 1587 anfangend waren die evangelisch–lutherischen Schullehrer dahier der Reihe nach folgende:
1. Wolfgang Johann Kirchmayer
2. Nikolaus Werner
3. Alexius Fehler
4. Johann Strauß
5. Heinrich Kost
6. Wolfgang Sigmund Buchner
7. Kaspar Ebert
8. Georg Reinmann
9. Johann Heimann
10. Georg Kaspar Göbel
11. Ludwig Karl Röder
12. Johann Stadler
13. Johann Peter Lang
14. Johann Adam Herr
15. Johann Adam Müller
16. Johann Adam Stadler, Sohn von Nr. 12
17. Jakob Wagner aus Vachdorf bei Meiningen von 1795 bis 1829
18. Der derzeitige Schullehrer Friedrich Wagner, Sohn des vorigen, von 1829 bis anhier.
Im Jahre 1680 wurde die erste Orgel in die dahiesige Kirche angeschafft. Im Jahre 1689 ist keine Leiche gewesen und 103 Jahre vorher auch nicht.
Der Friedensschluß des 7jährigen Krieges wurde am 15. Februar 1763 mit einem Dankfeste kirchlich gefeiert, wobei prächtige Musik, Gesang des Dedeum laudamus, mehrmaliges Geläute mit allen Glocken, Schießen mit Stücken, Trompetenklang und Paukenschall. Nach dem Gottesdienst bekam jedes Kind einen Weck, jeder Nachbar aber eine Maß Wein und einen Weck.
Nach einer sich anher erhaltenen Ortssage hat ein gewisser Johann Georg Klein, welcher, wie auch der dahiesige Kirchenkalender bezeugt, anfangs der 1760er Jahre Gemeindeschmied dahier war, etwa in den Jahren zwischen 1763 und 1768 auf diebische Weise vermittelst Öffnens der Thüren und Schlösser aus dem dahiesigen Gemeinderathhause mehrere gemeindliche Aktenstücke entwendet und dem damaligen Ortsherrn dahier überbracht, es hat aber Letzterer dieselben an die Gemeinde wieder zurückgegeben. Da nun der Gemeindeschmied vergeblich auf eine desfalls versprochene Belohnung gewartet, so habe er sich auch noch üble Äußerungen gegen den hohen Gutsherrn bedient. Infolgedessen sei er nun in einer Nacht unerwartet von zu Mainberg stationiert gewesenen Soldaten (Chasseurs) im Bette aufgegriffen, nach Würzburg zur Untersuchung abgeführt, zum Zuchthause dortselbst verurtheilt worden und nach 1½ Jahren darin gestorben. Nach eben dieser sich dahier erhaltenen Ortssage aber sollen seit jener Zeit der Gemeinde Schwebheim wirklich mehrere wichtige, ihre gemeindlichen Interessen betreffenden Documente abhanden gekommen sein. Welchen Betreff etwa kann zur Zeit nicht mehr mit Gewißheit angegeben werden.
Im Jahre 1772 herrschte dahier eine epidemische Krankheit, an welcher 35 Personen, worunter auch der Seelenhirte Pfarrer Georg Daniel Haas, starben. Diese Todesfälle waren im Verhältnis zur damaligen Bevölkerung sehr bedeutend.
Im Jahre 1777 hat eine Frau von Bibra zur Auflassung der Pfarreibesoldung der Pfarrei Schwebheim Schenkungen von 3 Morgen Artfeld im oberen, unteren und mittleren Lehen gegeben.
Im Jahre 1778 wurde die gegenwärtige Kirchenorgel akkordiert und von dem damaligen Orgelbauer Voit zu Schweinfurt gefertigt. Im Jahre 1786 wurde die kleine Thurmglocke umgegossen und die Kanzel in den Altar, der unter dem Chor (Thurm) steht, gebaut. Vorher befand sich die Kanzel im Schiff oder Langhaus der Kirche. Gleichzeitig wurden auch die Seitenflügel mit Rückwand des Altars und der Kanzel, sowie auch die Orgel vergoldet.
Nach Inhalt dahiesigen Pfarreikalenders starb dahier den 10. November 1787 mittags um 12 Uhr Wilhelm Ludev von Clermont im 104. Jahre seines Alters. Er war Ingenieur–Lieutenant bei Prinz Eugen und Dr. medicinae et alchym, evangelischer Confession. Er wurde dahier in der Stille begraben.
Laut einer vorhandenen gemeindlichen Urkunde vom 27. Septbr. 1791 hat die dahiesige Gemeinde für die Aufhebung von Frohnleistungen die sogenannte Haid von den Söldensguthaiden an und gegen Mitternacht bis zur Gochsheimer Grenze, die vorher theils Koppelhut der Gutsherrschaft und theils von der Gemeinde durch Anbau benutzt wurde, dann eine bedeutende Fläche von ihrem Gemeindewald, jetzt zum Theil Kammerholz und zum Theil gereuthes[17] Feld genannt, sowie das Edelmannsholz an die Freiherrn von Bibra dahier eigenthümlich abgetreten. Hierbei kamen auch vertragsmäßig die beiden Gemeindetheile „großer und kleiner Rasen“, die bis dahin gleichfalls Koppelhut waren, zur Vertheilung und zwar gleich den anderen Gütern der Söldner als deren Eigenthum betrachtet.
Im Jahre 1796 kam das erste französische Militär nach Schwebheim und wirthschaftete sehr übel. Was ihnen zum Lebensunterhalt nöthig schien, nahmen sie eigenmächtig ohne jegliche Vergütung aus den Häusern, Scheunen, Stallungen, Kellern. Gelderpressungen, Drohungen und Misshandlungen von Seiten derselben waren von jener Zeit dahier mehrere Jahre lang nichts Neues.
Gleichzeitig wüthete, wie andernwärts, so auch im hiesigen Orte, die Viehseuche auf eine merkwürdige Weise, so als dahier letztlich das Anspannvieh und die Kühe fast gänzlich mangelten und nach dem Sagen um einen außerordentlich hohen Ankaufspreis wieder ersetzt werden mußten. Inzwischen behalfen sich die Leute als Zughilfe hierfür mit Pferden und Ziegen.
Im Jahre 1797 wurde die gegenwärthige Thurmuhr dahier angeschafft, die ein Uhrmacher Namens Imhof von Schweinfurt verfertigte.
Laut einer Stiftungsurkunde vom 2. Septbr. 1808 hat die verlebte Fräulein Lucrezia von Bibra dahier der Gemeinde Schwebheim zur Gründung einer Wohlthätigkeits–Baustiftung 1000fl und zur Gründung einer weiblichen Industrieschule mehrere Grundstücke an Artfeld und Wiesen schenkungsweise gegeben. Seit dem Jahre 1821 traten diese Stiftungen ins Leben. Bis dahin aber blieb die Stiftungsgeberin noch die Nutznießerin hievon.
Den Rückzug der Franzosen aus Russland und nach der Schlacht bei Leipzig folgte unmittelbar von 1813 – 1814 ein allgemeines Sterben am Nervenfieber (auch hitzige Krankheit genannt), das auch im Orte Schwebheim seine Opfer forderte.
Im Jahre 1816 auf 1817 war eine allgemeine außerordentliche Theuerung. Das Malter[18] Waizen und Korn galten im höchsten Preise etwa 60fl und darüber. Das Malter Gerste 40fl und das Malter Kartoffel 10fl und darüber. Diese Theuerung war eine Folge von unausgesetzt anhaltendem Regenwetter, und musste die Ernte in feuchtem ja selbst nassem Zustand heimgeschafft werden.
Im Jahre 1821 sind dahier 32 Personen gestorben. Ein seit 1772 nicht wieder erlebter Fall.
Im Jahre 1825, den 4 Septbr. nachts zwischen 1 und 2 Uhr sind dahier in der Hadergasse, wahrscheinlich durch Brandstiftung, 4 Scheunen bei Haus Nr. 20, 21, 22 und 24 abgebrannt. Der Brandstifter konnte nicht mit Gewißheit ausgemittelt werden. Die Scheune Hs. Nr. 20 brannte zuerst.
Im Jahre 1834, den 6. Juli, an einem Sonntage nachmittags gegen 3 Uhr zog ein schweres Gewitter, verbunden mit Hagelschlag, über die ganze Gemeindemarkung Schwebheim. Über 2/3 der Getraideernte waren vernichtet, auch alle anderen Feldfrüchte waren bedeutend beschädigt. In demselben Jahre wurde auch das dahiesige freiherrliche von Bibraische Patrimonialgericht aufgelöst und es verblieb nur noch ein Patrimonialamt. Am 31. August 1837 des Abends um ½9 Uhr zog eine einzige einzelstehende große Gewitterwolke über Schwebheim. Es hat dabei in großen Tropfen so äußerst wenig geregnet, daß der Staub kaum zur Hälfte davon gelöscht wurde. Es erfolgte nur ein einziger Blitz, verbunden mit einem unmittelbar darauf gefolgten Donnerschlage. Der Blitz fuhr in die oberste Schloßscheune zunächst am Fruchtspeicher. Es brannten in Folge dessen die 3 Scheunen und die ganze an solcher angebaute lange Stallung ab, an welcher die sogenannte neue Gasse vorbeiführt.
Um dieselbe Zeit und auch noch in den folgenden Jahren ließ der Gutsherr Dr. Ernst Freiherr von Bibra auf dem gemeindlichen Sandhügel bei den Pfingsträsen Hunnengräber öffnen und durch Ausgrabung mehrere aus Thonerde verfertigter Urnen mit verschiedenen kleinen Beilagen zu Tage fördern.
Im Jahre 1839, den 19. Juni nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr zog ein schweres Gewitter, verbunden mit Hagelschlag, über den Ort und die Gemeindemarkung Schwebheim. Nahe an etwa 2/3 der Getraideernte waren vernichtet und die übrigen Feldfrüchte bedeutend beschädigt.
Vom Jahre 1839 an hat dahier das Schleim– und Nervenfieber grassirt und namentlich in den ersten Jahren viele Todesfälle gebracht. Hierbei starben protestantischer Seits der Familienname „Laudenbacher“, katholischer Seits der Familienname „Kraft“ und israelitischer Seits der Familienname „Groß“ dahier ganz aus.